Ans Licht geholt
Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank
Die Historische Gesellschaft präsentiert unbekannte Dokumente aus der bis 1870 zurückreichenden Geschichte der Deutschen Bank.
Es handelt sich dabei um eine bunte Mischung: Manches ist von großer Tragweite, anderes eher zum Schmunzeln oder zum Nachdenken. Den Originaldokumenten beigefügt ist ein erklärender Kommentar, der die Einordnung in ihren (bank-)historischen Kontext erleichtern soll.
Zeige Inhalt von 02.05.1870 - Chefsache in frühen Tagen: Eine Wasserrechnung
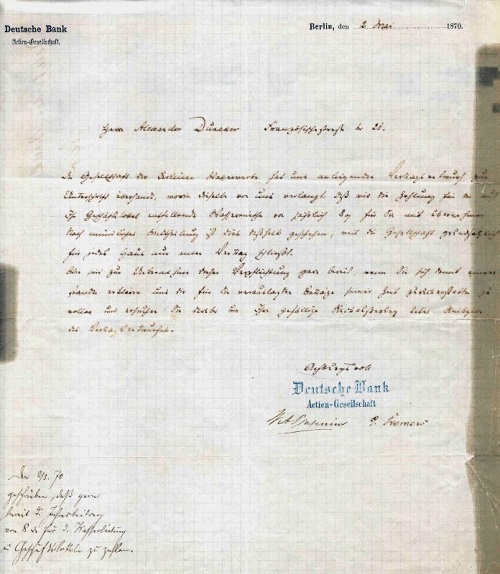 Deutsche Bank
Deutsche Bank
Actien-Gesellschaft
Berlin, den 2. Mai 1870
Herrn Alexander Duncker, Französische Straße Nr. 21
Die Gesellschaft der Berliner Wasserwerke hat uns anliegenden Vertragsentwurf zur Unterschrift übersandt, worin dieselbe von uns verlangt, daß wir die Zahlung für die auf Ihr Geschäftslokal entfallende Wassermiethe von jährlich 8 Thalern für Sie mit übernehmen. Nach mündlicher Mittheilung ist das deßhalb geschehen, weil die Gesellschaft grundsätzlich für jedes Haus einen neuen Vertrag schließt.
Wir sind zur Uebernahme dieser Verpflichtung gerne bereit, wenn Sie sich damit einverstanden erklären, uns die für Sie verauslagten Beträge seiner Zeit zurückerstatten zu wollen und ersuchen Sie darüber um Ihre gefällige Rückäußerung unter Rückgabe des Vertragsentwurfes.
Achtungsvoll
Deutsche Bank
Actien-Gesellschaft
W. A. Platenius G. Siemens
[Bemerkung]
den 2.5.70 geschrieben, dass gern bereit d. Jahresbeitrag von 8 Thalern für d. Wasserleitung im Geschäftslokale zu zahlen.
Kommentar
Es war gerade drei Wochen her, dass die Deutsche Bank am 9. April 1870 ihre Geschäfte in den äußerst bescheidenen Räumen der Französischen Straße 21 in der Berliner Friedrichstadt aufgenommen hatte, als sich das späterhin größte Kreditinstitut des Landes bereits mitten in Vertragsverhandlungen befand. Mit nichts – im tatsächlichen Sinn des Wortes – geringerem als der Wassermiete beschäftigt sich das älteste überlieferte Dokument zur Geschäftstätigkeit der Deutschen Bank. Georg Siemens persönlich hatte sich gemeinsam mit seinem (zu dieser Zeit einzigen) Vorstandskollegen W. A. Platenius der Sache angenommen. Bei der Handvoll Mitarbeiter, über die das Unternehmen zu dieser Zeit verfügte, dürften sie vermutlich auch die einzigen Zeichnungsberechtigten gewesen sein. Die beiden Jungbanker waren gerne bereit, ihrem Vermieter die von den Berliner Wasserwerken geforderten 8 Thaler vorzulegen - zinslos anscheinend. Das auf den 2. Mai 1870 datierte Schreiben an den Vermieter der Deutschen Bank-"Zentrale" Herrn Alexander Duncker stellt natürlich seinem Inhalt nach ein Kuriosum dar, wirft aber auch ein bezeichnendes Licht auf die Anfänge der Bank. Bei ihrer Gründung hatte sich die Deutsche Bank keinesfalls in einen repräsentativen Neubau einquartiert, sondern die ersten "Geschäftsräume befanden sich in einer Etage eines alten, baufälligen Hauses in der Französischen Straße (Nr. 21), dessen dunkler und nahezu lebensgefährlicher Treppenaufgang nach allen Schilderungen geradezu abschreckend gewirkt haben muß", wie Siemens' Schwiegersohn Karl Helfferich berichtet. Über fließend Wasser scheint die Liegenschaft immerhin verfügt zu haben. Hausbesitzer Alexander Duncker war der Inhaber der gleichnamigen Berliner Verlagsbuchhandlung. Sein Vater Carl Duncker zählte zur Gründergeneration des renommierten Wissenschaftsverlags "Duncker & Humblot". Die ersten Wochen der "frischgebackenen" Deutschen Bank liegen weitgehend im Dunkeln. Siemens' früher Mitstreiter Platenius hat später ganz freimütig zugegeben, wie unbeleckt von der Materie sie ihren ersten Arbeitstag begannen. Einer fragte den anderen: "Was machen wir nun? Haben Sie eigentlich Ahnung vom Bankgeschäft?" Beide verneinten und brachen dann in ein erlösendes Lachen aus. Gerechterweise muss man hinzufügen, dass sich das Führungsgespann Siemens/Platenius in den frühen Tagen der Bank auch bereits mit bedeutsameren Dingen als Wasserrechnungen auseinandergesetzt hat. Schon im zweitältesten Dokument zur Geschäftstätigkeit der Bank, das ein Tag später datiert (3. Mai 1870), sucht der Vorstand um die baldige Notierung der Deutschen Bank an der Berliner Börse nach - für ein als Aktiengesellschaft gegründetes Unternehmen gewiss kein unwichtiger Vorgang. Die beengten Geschäftsräume in der Französischen Straße konnte die Deutsche Bank schon ein Jahr später verlassen und ein eigenes Gebäude in der Burgstraße beziehen. Das Haus Französische Straße 21 wich bald einem aufwendigen Bau der Gründerzeit. Heute dehnt sich an dessen Stelle ein Teil des Gebäudekomplexes der Galeries Lafayette aus.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]
Zeige Inhalt von Oktober 1870 - Ein Masterplan aus dem Gründungsjahr: "Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft"
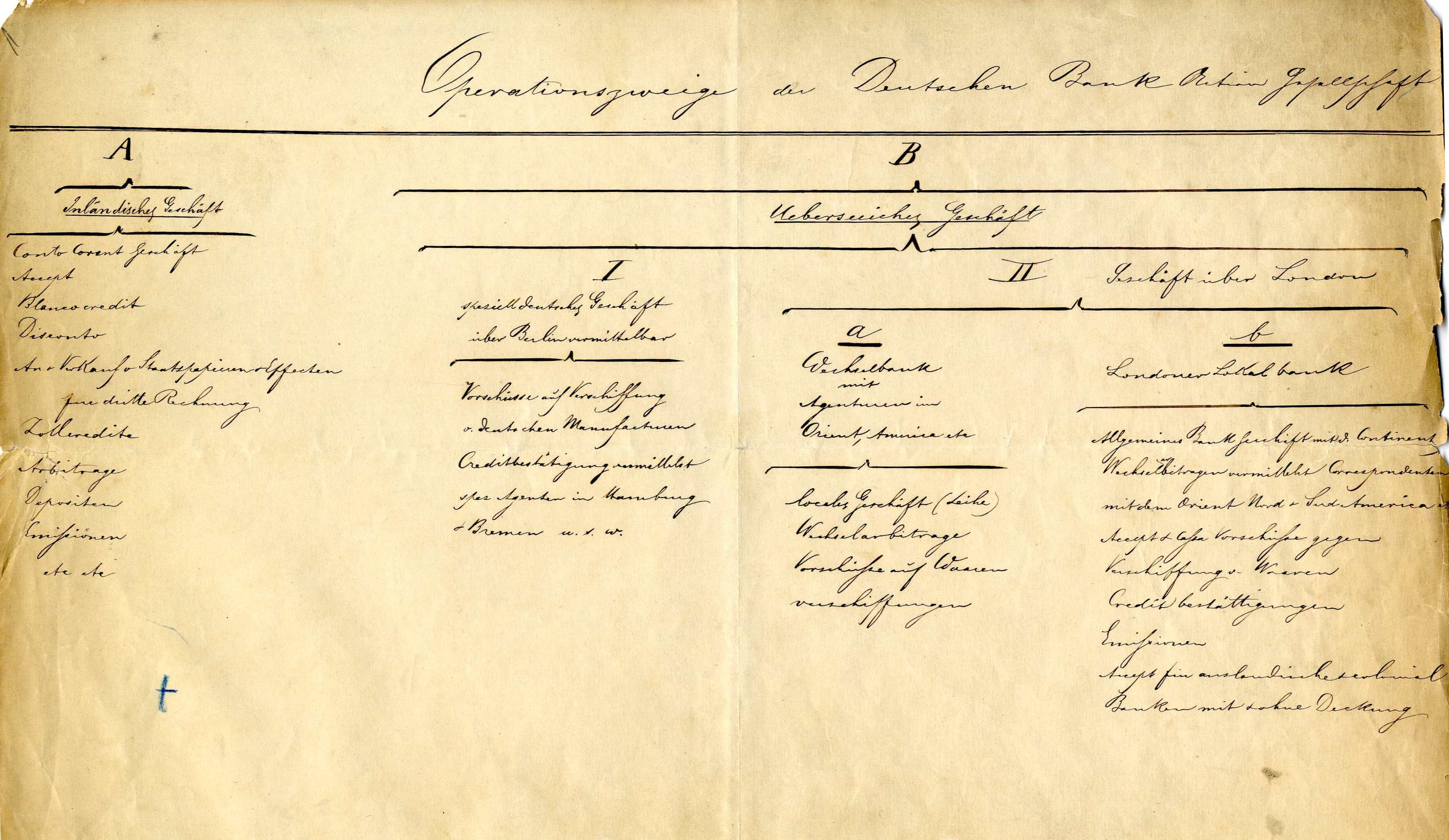 Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft [Organigramm, ca. Oktober 1870]
Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft [Organigramm, ca. Oktober 1870]
A. Inländisches Geschäft
Conto Corrent Geschäft
Accept
Blancocredit
Disconto
An- und Verkauf von Staatspapieren und Effekten für dritte Rechnung
Zollcredite
Arbitrage
Depositen
Emissionen etc., etc.
B. Ueberseeisches Geschäft
I. speciell deutsches Geschäft über Berlin vermittelbar
Vorschüsse auf Verschiffung von deutschen Manufacturen, Creditbestätigung
vermittelst spez. Agenturen in Hamburg und Bremen u.s.w.
II. Geschäft über London
a) Wechselbank mit Agenturen im Orient, America etc.
locales Geschäft (Leihe)
Wechselarbitrage
Vorschüsse auf Waarenverschiffungen
b) Londoner Lokalbank
Allgemeines Bankgeschäft mit dem Kontinent
Wechselarbitragen vermittelst Correspondenten mit dem Orient, Nord- und Südamerika etc.
Accept und Cassa Vorschüsse gegen Verschiffung von Waaren
Creditbestätigungen
Emissionen
Accept für ausländische und Colonial Banken mit und ohne Deckung.
Kommentar
Aus dem Gründungsjahr der Deutschen Bank datiert ein Schlüsseldokument für die Geschäftsstrategie der neuen Bank: „Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft“. Ausgearbeitet hat es Hermann Wallich (1833-1928), designiertes Vorstandsmitglied. Das Organigramm ist Teil eines ausführlichen Exposés, das Wallich dem Verwaltungsrat der Bank bei seinem Eintritt im Herbst 1870 vorlegt – gewisser Weise als Morgengabe.
Das auf der Gründungsversammlung am 22. Januar 1870 verabschiedete Statut der Deutschen Bank hatte die Richtung vorgegeben: „Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art, ins Besondere Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen Europäischen Ländern und überseeischen Märkten.“ Nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, galt es, diesen Auftrag – ein Spezialinstitut für den Außenhandel zuschaffen – Realität werden zu lassen. Zu diesem Zweck hatte man Hermann Wallich ins Boot geholt, einen ausgewiesenen Kenner des überseeischen Geschäfts, der seit 1863 für den französischen Comptoir d’Escompte in Ostasien tätig gewesen war. Gemeinsam mit Georg Siemens sollte er die Geschicke der Deutschen Bank in den kommenden Jahrzehnten prägen.
In sein Exposé von Oktober 1870 hat Wallich nicht nur seine Erfahrung im Auslandsgeschäft eingebracht, sondern er sieht am Vorabend der Reichsgründung sehr klar die geschäftlichen Perspektiven seines neuen Arbeitgebers. So ist die Entwicklung der Deutschen Bank in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens in Wallichs Ausarbeitung wie in einem Masterplan vorskizziert. Neben allgemeinen Geschäftsaufgaben, unter denen etwa das noch wenig entwickelte Einlagengeschäft aufgeführt ist, sind drei von vier Spalten des Organigramms dem Auslandsgeschäft gewidmet. Deutlich unterscheidet er, welcher Teil des überseeischen Geschäfts von Deutschland heraus betrieben werden kann und jenen Aufgaben, die nur über London, dem weltweit führendem Finanzplatz, bewältigt werden können. In den Folgejahren wird der Plan umgesetzt: Schon 1871 und 1872 entstehen Niederlassungen an den wichtigsten deutschen Standorten für den Außenhandel Bremen und Hamburg, 1873 wird die bis zu ihren Schließung 1914 wichtigste Filiale der Deutschen Bank in London eröffnet, 1886 kommt es zur Gründung der Lateinamerikatochter „Deutsche Ueberseeische Bank“. Das Ostasiengeschäft, eigentlich Wallichs Domäne, muss dagegen mit Widerständen kämpfen und Rückschläge hinnehmen. Zwei schon 1872 errichtete Filialen in Shanghai und Yokohama werden nach wenigen Jahren wieder geschlossen. Erst mit der Beteiligung der Deutschen Bank an der 1889 errichteten Deutsch-Asiatischen Bank kommt es hier zu einem dauerhaften Geschäftsaufbau. Als sich Hermann Wallich 1894 aus dem operativen Geschäft der Deutschen Bank zurückzieht, ist die in den "Operationszweigen" aufgestellte Agenda weitgehend abgearbeitet.
weiterführende Informationen
Hermann Wallich – Bankier in Paris, Shanghai und Berlin
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Zeige Inhalt von 17.08.1872 - Die Sache mit dem Kabel
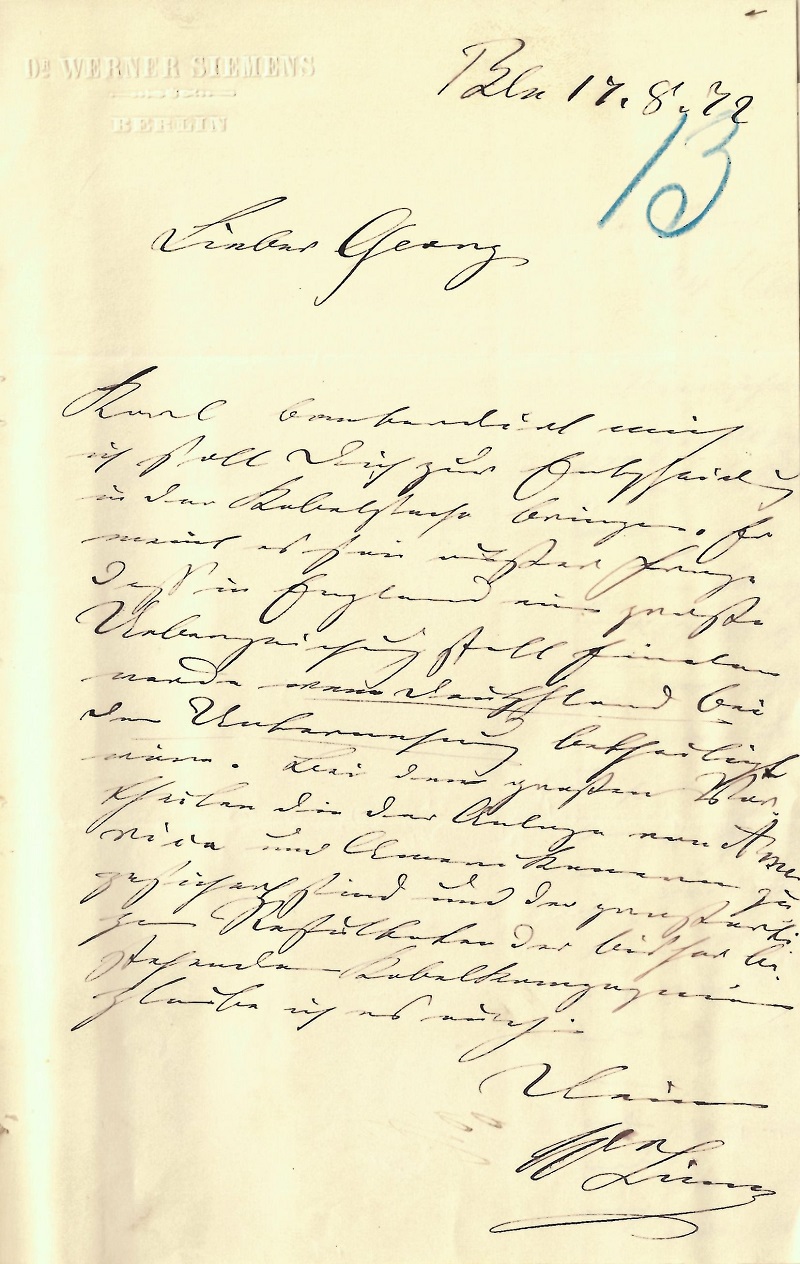 DR. WERNER SIEMENS B[er]l[i]n 17.8.[18]72
DR. WERNER SIEMENS B[er]l[i]n 17.8.[18]72
BERLIN
Lieber Georg
Karl bombardirt mich ich soll Dich zur Entscheidung
in der Kabelsache bringen. Er meint es sei außer Frage
daß in England eine große Ueberzeichnung stattfinden werde
wenn Deutschland bei der Unternehmung betheiligt werde.
Bei den großen Vortheilen die der Anlage von America und Amerikanern
zugesichert sind und den großartigen Resultaten der bisher bestehenden
Kabelkompagnien glaube ich es auch.
Dein
W. Siemens
Quelle: HADB, A134
Kommentar
Dieser Brief vom August 1872 ist Teil einer Korrespondenz zwischen dem Erfinderunternehmer Werner Siemens und seinem Neffen Georg Siemens, dem ersten Vorstandssprecher der Deutschen Bank (ihre Adelsprädikate erhielten beide erst lange nach diesen Ereignissen). Sie thematisiert die mögliche Beteiligung der Deutschen Bank an der Verlegung eines unterseeischen Telegraphenkabels von Irland bis an die nordamerikanische Küste durch die Firma Siemens & Halske. Ihren Anfang hatte die Idee bereits im März 1871 genommen, als Hermann Wallich, der 1870 in den Vorstand der Deutschen Bank berufen worden war, Werner Siemens nach einer Beteiligung an einer Transatlantikkabel-Gesellschaft gefragt hatte. Die Deutsche Bank wurde von amerikanischen Investoren damit beauftragt, das Geschäft auszukundschaften. Dies teilte Werner seinem Bruder Carl mit. Beflügelt durch den Gründerboom unmittelbar nach der Reichsgründung 1871 und der Gelegenheit, sich auf einem internationalen Arbeitsfeld zu betätigen, ließ Carl Siemens die Idee von der Verlegung eines Transatlantikkabels nicht mehr los und so begann er mit dem im Brief erwähnten „Bombardement“ auf Werner. Auch Carls persönliche wirtschaftliche Lage bewegte ihn dazu, die Kabelverlegung zu befürworten. Als Leiter von Siemens Brothers & Co. in England suchte er im Anschluss an den Bau der Indo-Europäischen Telegraphenlinie nach Großaufträgen für sein nicht ausgelastetes Kabelwerk. Doch längst nicht jeder sah in der Verlegung des Transatlantikkabels ein lukratives Geschäft. Innerhalb des Vorstands der Deutschen Bank begegnete man der Unternehmung aufgrund ihres hohen finanziellen Risikos überwiegend mit Skepsis. Mit der Gründung der „Direct United States Cable Company Ltd.“, einer Gesellschaft englischen Rechts mit Beteiligung der Deutschen Bank, war 1873 der Startschuss für das Projekt gegeben. Georg Siemens zeichnete auf eigenes Risiko den nicht untergebrachten Teil des Aktienkapitals der Gesellschaft und stellte einen Betrag von 20 000 Pfund (400 000 Mark) zur Verfügung, der eigentlich seine finanziellen Möglichkeiten um einiges überstieg. 1873 kam es zu einem großen Crash am Londoner Finanzmarkt, der das Resultat von Überspekulationen war. Dies führte Georg Siemens an den Rand des Ruins und Zerwürfnisse innerhalb der Familie waren die Folge. In einer Sache sollte Werner Siemens jedoch Recht behalten: Langfristig sollte sich die Verlegung des Transatlantikkabels für Siemens & Halske auszahlen. Obwohl die Telegraphenlinie 1877, nicht einmal zwei Jahre nach Fertigstellung, von dem „Kabelring“ des britischen Unternehmers John Pender übernommen wurde, folgten lukrative Aufträge durch französische und amerikanische Magnaten. Die Wettbewerbsfähigkeit im zukunftsfähigen Seekabelgeschäft war erprobt und der Name der Firma Siemens & Halske in den USA fortan bekannt.
Zeige Inhalt von 03.12.1872 - Otto Wesendonck - der Mann der Muse
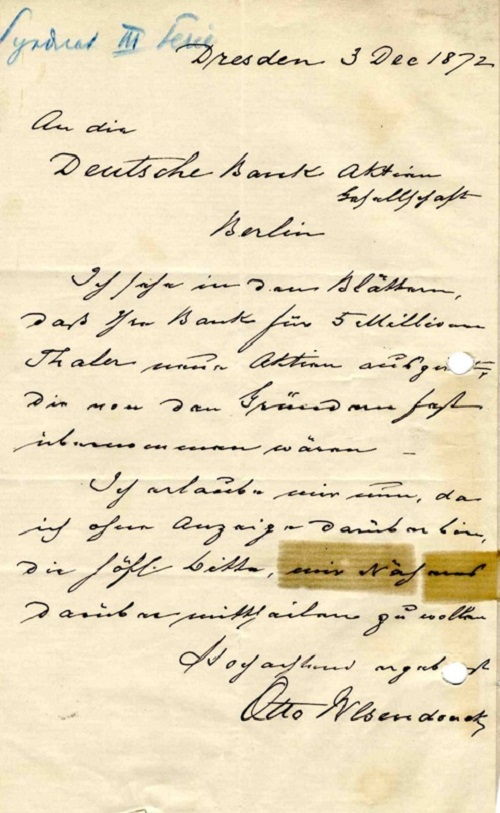 Otto Wesendonck - der Mann der Muse
Otto Wesendonck - der Mann der Muse
Dresden, 3 Dec 1872
An die
Deutsche Bank Aktien Gesellschaft Berlin
Ich sehe in den Blättern, daß Ihre Bank für 5 Millionen Thaler neue Aktien ausgiebt, die von den Gründern fest übernommen wären –
Ich erlaube mir nun, da ich ohne Anzeige darüber bin, die höfl. Bitte, mir Näheres darüber mittheilen zu wollen
Hochachtend ergebenst
Otto Wesendonck
Kommentar
Als die Deutsche Bank im März 1870 gegründet wurde, verteilte sich ihr Aktienkapital von 5 Millionen Talern auf 76 Zeichner, darunter zahlreiche Bankhäuser und Privatpersonen aus der Finanzwelt. Für ein in der Rechtsform der Aktiengesellschaft errichtetes Unternehmen gelten sie praktisch als dessen Gründer. Unter den Erstzeichnern waren – kaum verwunderlich – die beiden geistigen „Väter“ der Deutschen Bank Adelbert Delbrück (mit 112.000 Talern) und Ludwig Bamberger (mit 18.800 Talern) sowie mit überschaubaren 5.000 Talern der künftige "Macher" des Unternehmens Georg Siemens. Bei den folgenden Kapitalerhöhungen wurden die "Gründer" wiederum zur Zeichnung aufgerufen. So im Dezember 1872 als zur "Errichtung einer Filiale in London, sowie Dotirung von Commanditen in New York und Paris" das Grundkapital zum zweiten Mal um 5 Millionen Taler erhöht wurde. Schon im Vorfeld dieses Aufrufs hatten Zeitungen von der geplanten Kapitalerhöhung berichtet. Daraufhin wandten sich einige Erstzeichner umgehend an die Deutsche Bank, um Näheres über die Emission zu erfahren. Zu ihnen gehörte auch der Kaufmann Otto Wesendonck, der bei der Gründung der Deutschen Bank 1870 mit 68.200 Talern einen ansehnlichen Betrag gezeichnet hatte. Aus der Textilstadt Elberfeld (heute ein Stadtteil von Wuppertal) stammend, betätigte er sich zusammen mit seinem Partner William Loeschigk, der ebenfalls zu den Erstzeichnern des Aktienkapitals der Deutschen Bank zählte, sehr erfolgreich im Seidenhandel. 1851 ließ er sich in Zürich nieder und errichtete dort ein prächtiges Anwesen (in der heute teilweise das Museum Rietberg für außereuropäische Kunst untergebracht ist). 1871 siedelte Wesendonck nach Dresden über, von wo aus er auch obiges Schreiben an die Deutsche Bank richtete. Otto Wesendonck ist der Nachwelt eigentlich nur dank seiner zweiten Ehefrau Mathilde in Erinnerung geblieben – für das 19. Jahrhundert ein eher seltener Fall. Mathilde Wesendonck war in den 1850er Jahren zeitweilig die geistige Muse Richard Wagners. Ohne diese Beziehung, so ein weit verbreitetes Urteil der Musikwissenschaft, wäre das Liebesdrama "Tristan und Isolde", eines der bedeutendsten Bühnenwerke der Romantik, nicht denkbar. Die Wesendoncks standen mit dem Komponisten, der 1849 als politisch Verfolgter aus Deutschland geflohen war, seit 1852 in freundschaftlichem Kontakt. Otto Wesendonck unterstütze den notorisch in Geldnöten befindlichen Wagner großzügig und ermöglichte ihm in Zürich zu wohnen und zu arbeiten. Zwischen Wagner und Mathilde Wesendonck entwickelte sich eine tiefe "Seelenfreundschaft". Wagner vertonte fünf Gedichte Mathildes, die sogenannten Wesendonck-Lieder, zwei davon bezeichnete Wagner ausdrücklich als Vorstudien zu "Tristan und Isolde". Wagners damalige Ehefrau Minna vermutete – wohl zu Unrecht – hinter der Beziehung mehr als ein platonisches Verhältnis und wollte es auf einen Eklat ankommen lassen. Die Wesendoncks reagierten indem sie den Kontakt zu Wagner weitgehend abbrachen, was Otto Wesendonck aber nicht daran hinderte, den Musikdramatiker weiterhin zu unterstützen.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]
Zeige Inhalt von 24.04.1880 - Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank
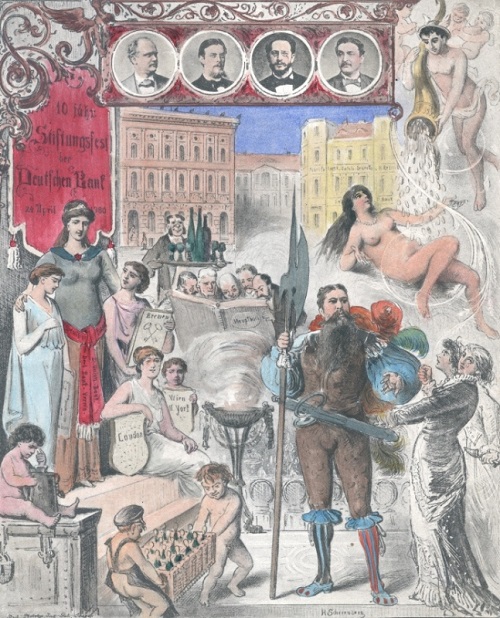 Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880
Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880
Kommentar
Wer ein Unternehmen gründet, wird dabei kaum an künftige Jubiläen denken. An der Jubiläumskultur der Kaiserzeit hatte die Deutsche Bank dennoch regen Anteil. Schon ihr zehnjähriges Bestehen nahm sie im Jahr 1880 zum Anlass, um Rückschau zu halten. Überliefert ist ein farbenfrohes Gedenkblatt, das die bisherige Entwicklung aufzeigt. Die kleine, 22 cm x 18 cm messende, handkolorierte Lithographie ist betitelt „10 jähr. Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880“. Ihr Schöpfer war der Maler, Illustrator und Karikaturist Hermann Scherenberg (1826-1897). Die von ihm geschaffene Bildkomposition enthält sowohl eine Vielzahl von Anspielungen auf das zurückliegende erste Jahrzehnt der Deutschen Bank als auch zahlreiche allegorische Figuren. Über dem gesamten Bild wachen in Porträtmedaillons die amtierenden Vorstandsmitglieder: Georg Siemens, Rudolph Koch, Max Steinthal, Hermann Wallich. Unter ihnen erscheinen im Hintergrund die drei ersten Gebäude der Deutschen Bank in Berlin. Rechts schüttet der an seinem Flügelhelm erkennbare Merkur aus seinem Füllhorn einen Goldregen auf Danaë herab. Ein beflissener Kellner serviert Wein für die Festgäste. Zwei Putti schleppen einen schweren Korb mit Champagnerflaschen heran. Über dem Hauptbuch brüten mehrere Buchhalter der Bank. Die Frauengestalten in der linken Bildhälfte symbolisieren die Deutsche Bank und ihre „Töchter“, die Filiale in Bremen, Hamburg und London sowie die Kommanditbeteiligungen in Wien und New York. Ein schwerbewaffneter Landsknecht weist mit eindeutiger Geste zwei Damen ab, die die Untugenden Missgunst und Neid repräsentieren könnten. Die damals 270 Berliner Angestellten der Bank lud der Vorstand der Deutschen Bank am 24. April 1880 zum Abendessen ins Hotel Imperial. Vorstandssprecher Georg Siemens hielt eine launige Rede, die seine Frau in einem Brief an ihre Eltern zusammenfasste: „Er begann mit einer heiteren Schilderung der Gründung, wie sie 24 Verwaltungsräthe, zwei Direktoren, ein Kommis und ein Kassenbote gewesen seien, ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Geschäfte; wie Koch damals als Kommis täglich 50 Brief geschrieben habe des Inhalts, daß alle Stellen vergeben seien, wie Wallichs stete Rede später gewesen sei: „Nur keine Ideen!“; und so wären sie denn im Ochsenschritt ruhig fortgegangen und groß geworden, trotz aller Stürme. (….). Er betonte das Vertrauen zwischen Direktion und Beamten und sprach endlich die Hoffnung aus, daß dies immerfort als beste Grundlage der Deutschen Bank bestehen bleiben möge.“
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]
Zeige Inhalt von 24.04.1880 - Jubiläumsmarsch zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank
Jubiläumsmarsch (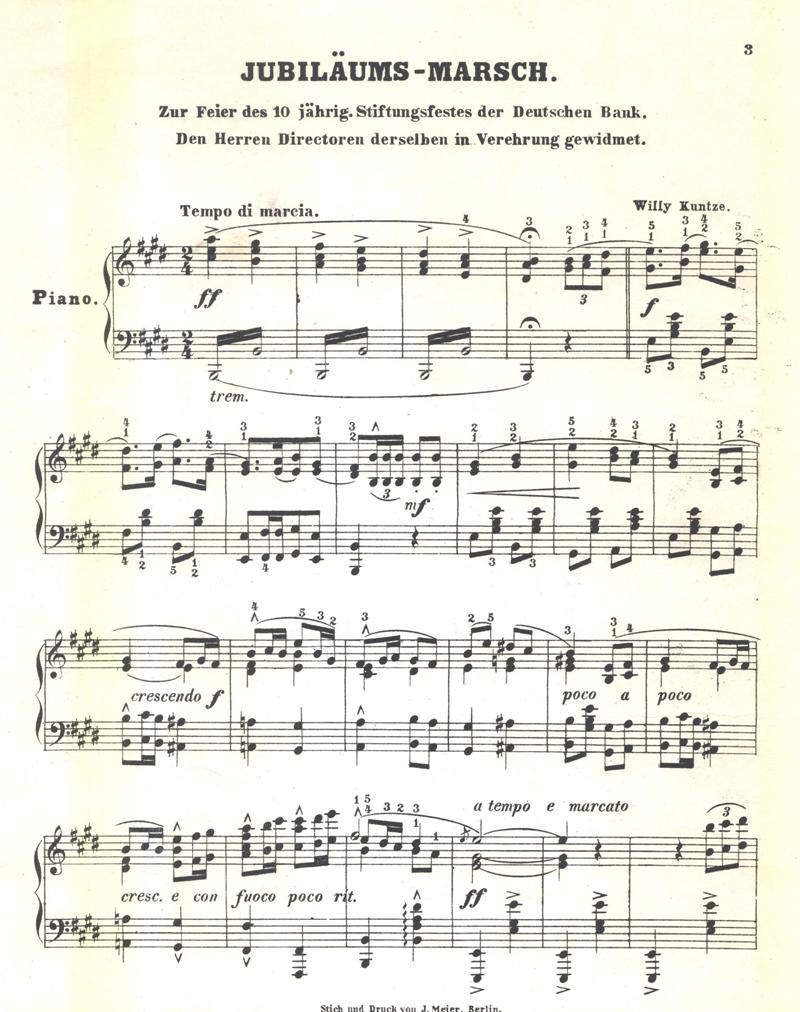 zum 10-jährigen Bestehen der Deutschen Bank, „Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze“ Partitur für Klavier mit Deckblatt
zum 10-jährigen Bestehen der Deutschen Bank, „Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze“ Partitur für Klavier mit Deckblatt
Kommentar
Musik hat in der Deutschen Bank Tradition: vom Gesangverein und der Orchestervereinigung, die beide bereits 1898 bestanden, und den heute bestehenden Deutsche Bank Singers bis zum Engagement außerhalb der Bank, etwa durch die Kooperation mit den Berliner Philharmonikern. Doch schon 1880 wurde die Deutsche Bank selbst Thema einer musikalischen Komposition - in Form eines Festmarsches: vier Seiten Noten für Klavier, in E-Dur, Tempo di marcia. Betitelt mit: ‚Jubiläums-Marsch. Zur Feier des 10-jährig. Stiftungsfestes (1880) der Deutschen Bank.Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze‘. Kuntze wurde am 14.12.1861 in Berlin geboren und lebte dort als Musiklehrer und Komponist. Zu seinen Werken zählen Stücke für Pianoforte und Violine, sowie Lieder. In Handschrift fügte er auf dem Deckblatt hinzu: ‚Herrn Max Netschmann zur freundlichen Erinnerung, Willy Kuntze.‘ Vielleicht versuchte Kuntze, sich mit diesem Marsch ‚den Herren Directoren‘ anzudienen. Oder er machte seinem Freund Max Netschmann, über den leider nichts bekannt ist, ein Geschenk. Um eine Auftragsarbeit handelte es sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Denn Kuntze verlegte das Stück selbst. Stich und Druck ließ er von der Firma J. Meier in Berlin ausführen. Über eine Aufführung des Stückes schweigen die Quellen. Von den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum am 24.04.1880 ist noch ein Festblatt, ein Tagebucheintrag Elise von Siemens‘, sowie die Einladung an die Bankbeamten mit Speisekarte erhalten – der Marsch ist nirgendwo erwähnt. Ob er zu diesem Anlass gespielt wurde, ist ungewiss. Vielleicht erstmalig wurde der Marsch im Auftrag des Historischen Instituts der Deutschen Bank von Jan Polivka an der Hochschule für Musik, Frankfurt am Main, eingespielt. Kuntze nahm in seiner Komposition Anleihen beim Lied ‚Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben‘. Es war eine Art inoffizielle Nationalhymne Preußens vor der Gründung des Kaiserreichs. Das zentrale Motiv des Liedes setzt nach der Fermate am Ende des Generalauftaktes ein und wird im Stück mehrfach wiederholt. Kuntze dürfte damit auf den preußischen ‚Charakter‘ der in der preußischen bzw. deutschen Hauptstadt sitzenden Deutschen Bank verwiesen haben.
weiterführende Informationen
Ans Licht geholt - Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]
Zeige Inhalt von 04.09.1886 - „Mit hiesigen Leuten wird man in Frankfurt doch etwas vernünftiges aufbauen können“ - Die Eröffnung der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank
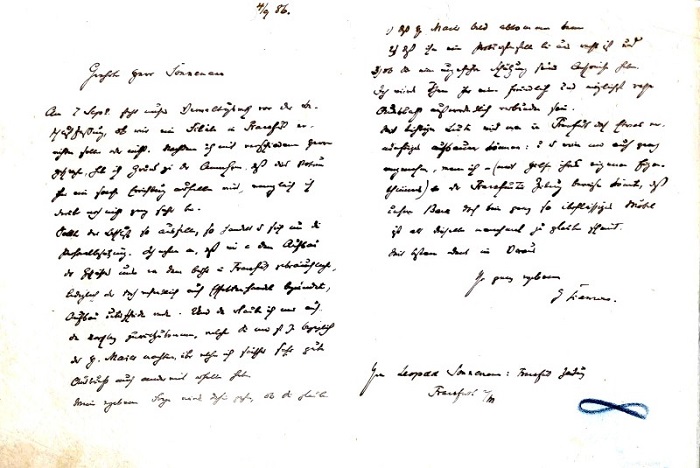 4/9 [18]86
4/9 [18]86
Geehrter Herr Sonnemann
Am 7. Sept. steht unser Verwaltungsrath vor der Entschlußfassung, ob wir eine Filiale in Frankfurt errichten sollen oder nicht. Nachdem ich mit verschiedenen Herren gesprochen, habe ich Grund zu der Annahme, daß dieses Votum für eine solche Errichtung ausfallen wird, wenngleich ich darüber noch nicht ganz sicher bin.
Sollte der Beschluß so ausfallen, so handelt es sich um die Personalbesetzung. Ich nehme an, daß wir in dem Aufbau des Geschäfts uns zu dem bisher in Frankfurt gebräuchlichen, lediglich oder doch wesentlich auf Effektenhandel begründeten, Aufbau unterscheiden werden. Und da erlaube ich mir auf den Vorschlag zurückzukommen, welchen Sie mir s.Z. bezüglich des Hr. Maier machten, über welchen ich seither sehr gute Auskunft auch anderweit erhalten habe.
Meine ergebene Frage würde dahingehen, ob Sie glauben
1) daß Hr. Maier bald abkommen kann
2) daß ihm eine Prokuristenstelle bei uns recht ist und
3) ob Sie eine ungefähre Schätzung seiner Ansprüche haben.
Ich würde Ihnen für eine freundliche und möglichst rasche Auskunft außerordentlich verbunden sein.
Mit hiesigen Leuten wird man in Frankfurt doch etwas vernünftiges aufbauen können: u. es wäre mir auch ganz angenehm, wenn ich - (mit Hilfe ihrer eigenen Eigenthümer) - der Frankfurter Zeitung beweisen könnte, daß unsere Bank doch kein ganz so überflüssiges Möbel ist als dieselbe manchmal zu glauben scheint.
Mit besten Dank im Voraus
Ihr ganz ergebener
G. Siemens
Herrn Leopold Sonnemann: Frankfurter Zeitung
Frankfurt a/M
Kommentar
In Frankfurt am Main ist die Deutsche Bank seit dem 1. Oktober 1886 vertreten. An diesem Tag nahm die neu eröffnete Frankfurter Filiale in der Kirchnerstrasse 3 am Kaiserplatz ihre Tätigkeit auf. Sie war nach Bremen (1871) und Hamburg (1872) erst die dritte Inlandsniederlassung des 1870 in Berlin gegründeten Instituts. Die Filiale übernahm Geschäft und Gebäude des in Liquidation gegangenen Frankfurter Bankvereins. An die Spitze der Filiale wurden zwei erfahren Bankiers berufen: Carl von Leiden, der bereits dem Vorstand des Frankfurter Bankvereins angehört hatte, und Wilhelm Seefrid, der von dem Vorstand der Danziger Privat-Actien-Bank in die Filialdirektion wechselte. Über beide Personalfragen war bereits im Sommer 1886 entschieden worden, lange bevor der Verwaltungsrat – wie sich das Aufsichtsgremium der Bank in dieser Zeit noch nannte – über die Errichtung der Frankfurter Filiale endgültig abgestimmt hatte. Nachdem Anfang September 1886 die Zustimmung des Verwaltungsrats als recht sicher galt, ging Vorstandssprecher Georg Siemens daran, die dritte noch vakante Stelle zu besetzen, die in der Leitung der neuen Niederlassung zu vergeben war. Um das künftige Geschäft in Frankfurt zu verankern, schien es ihm ratsam, einen Kandidaten mit Ortskenntnis auszuwählen. Bereits bei einer früheren Gelegenheit war Siemens durch den Frankfurter Zeitungsverleger Leopold Sonnemann ein Herr Maier empfohlen worden. Sonnemann, Gründer und Herausgeber der renommierten Frankfurter Zeitung, war weit über die Stadtgrenzen bekannt und verfügte über eigene Erfahrung als Privatbankier. Außerdem kannten sich Siemens und Sonnemann aus ihrer gemeinsamen Zeit (1874–1884) als Reichstagsabgeordnete. In dem hier wiedergegebenen Brief vom 4. September 1886 kam Siemens auf Sonnemanns Vorschlag zurück. Inzwischen hatte sich nämlich sein Vorstandskollege Rudolph Koch nach Herrn Maier erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass er beim Frankfurter Bankhaus E. Ladenburg angestellt war. Es hieß, er sei „ein prima Mann für Börse und Frankfurter Geschäft und viel besser als Hoffstadt“, ein Direktor des in Liquidation getretenen Frankfurter Bankvereins, der ebenfalls in Erwägung gezogen wurde. Koch empfahl daher, unbedingt Herrn Maier zu berücksichtigen. Siemens wollte nun von Sonnemann wissen, ob sein Kandidat kurzfristig zur Deutschen Bank wechseln könne, ob er sich mit einer Stellung als Prokurist zufrieden gebe und welche Gehaltsvorstellungen er habe. Der Brief erreichte Sonnemann im belgischen Ostende, wo er gerade seinen Urlaub verbrachte. Telegraphisch antwortete er Siemens: „Glaube beide Fragen bejahen zu können, weiteres am besten von Maier direct“. Nun ging alles Schlag auf Schlag: Am 7. September 1886 beschloss der Verwaltungsrat die Errichtung der Filiale Frankfurt, die bereits drei Wochen später ihre Schalter öffnete. Mit von der Partie war von Anfang an der von Sonnemann empfohlene Hermann Maier, der sich für die neue Filiale als Glücksfall erweisen sollte. Hauptsächlich für das Börsen-, Devisen- und Auslandsgeschäft zuständig, avancierte Maier bereits nach vier Jahren zum stellvertretenden Direktor und 1899 zum Direktor der Filiale Frankfurt. Eine Position, die er bis zu seiner Pensionierung 1912 bekleiden sollte. Dass die Frankfurter Niederlassung der Deutschen Bank trotz zahlreicher Konkurrenz rasch zu den führenden Adressen am Bankplatz zählte, war zu großen Teilen Maiers Verdienst. Vorstandssprecher Georg Siemens hätte daher Leopold Sonnemann und seiner Frankfurter Zeitung, die der Gründung der Deutschen Bank anfangs sehr kritisch gegenübergestanden hatte, leicht beweisen können, dass seine Bank „doch kein ganz so überflüssiges Möbel“ war, wie die Zeitung zuweilen vermutete.
weiterführende Informationen
Zeige Inhalt von 19.08.1889 - Edison bei Krupp oder das Kommunikationssystem der Deutschen Bank
The Deutsche Bank Berlin
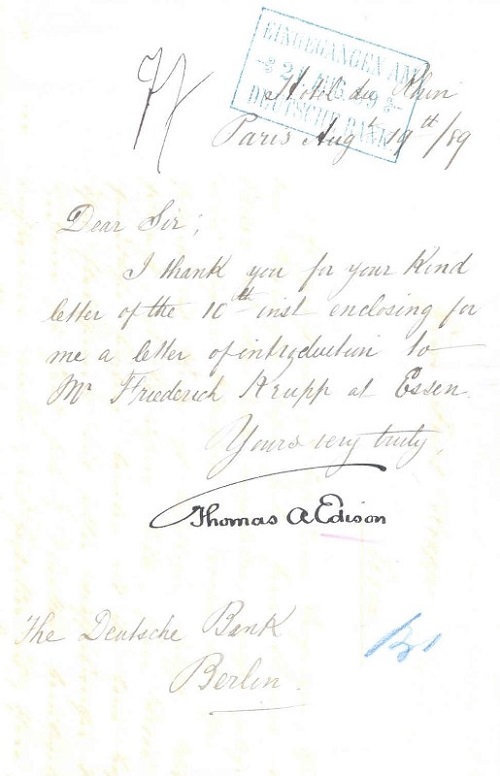 Hotel du Rhin, Paris Aug 19th [18]89
Hotel du Rhin, Paris Aug 19th [18]89
Dear Sir,
I thank you for your kind letter of the 10th inst enclosing for me a letter of introduction to Mr Frederick Krupp at Essen.
Yours very truly
Thomas A Edison
Kommentar
Seit jeher betätigen sich Banken nicht nur als Geldgeber der Wirtschaft, häufig üben sie auch wichtige Kommunikationsfunktionen aus. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der hier abgebildete kurze Brief, den der amerikanische Erfinder und Unternehmer Thomas Alva Edison im August des Jahres 1889 an die Deutsche Bank in Berlin schrieb. Schon zu dieser Zeit war der damals erst 42-jährige „Vater“ der ersten brauchbaren Glühlampe eine Berühmtheit auf beiden Seiten des Atlantiks. 1881 hatte er erstmals im großen Rahmen seine Kohlenfadenlampe auf der internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris vorgeführt, die von dort ihren Siegeszug antrat. Die Vermarktung seiner Patente in Deutschland durch die eigens gegründete Deutsche Edison Gesellschaft, die 1887 in die AEG umgewandelt wurde, hatte Edison in Verbindung zur Deutschen Bank gebracht, die sich zunehmend für die neue Elektroindustrie zu interessieren begann. Henry Villard, ein deutschstämmiger amerikanischer Finanzmagnat, der sich auch als Finanzberater Edisons betätigte, hatte die Verbindung hergestellt. Villard war es auch, der sich im Sommer 1889 an die Deutsche Bank wandte. Er ließ den Vorstand der Bank wissen, dass Edison nach Europa komme, um die Weltausstellung in Paris zu besuchen und anschließend nach Berlin weiterfahren wolle. Unterwegs plane Edison einen Zwischenstopp – die Besichtigung der Krupp’schen Fabriken in Essen. Ein Einführungsschreiben der Deutschen Bank, die in geschäftlicher Verbindung mit Krupp stand, sollte ihm die Türen öffnen. Edisons Interesse an Krupp kam nicht von ungefähr. Der Ruf der Waffenschmiede an der Ruhr war schon damals legendär. Die von Krupp entwickelten Hinterladergeschütze dominierten den Weltmarkt. Aber auch für die Industrie war die Firma tätig und produzierte schwere Kurbelwellen, Schienen und anderes Eisenbahnmaterial sowie Kessel- und Schiffsbleche. Bei der Deutschen Bank war man gerne bereit, Edison zu dem gewünschten Entree zu verhelfen. Sogleich wurde man bei Krupp vorstellig und bat „Herrn Edison einen freundlichen Empfang zu bereiten und ihn beim Besuche Ihrer Etablissements mit allen wünschenswerten Informationen zur Hand sein zu wollen.“ Aus Essen kam die postwendende Antwort des Krupp-Direktoriums, das erfreut war, Herrn Edison seine Gussstahlfabrik zu zeigen. So befand man sich in Berlin in der angenehmen Situation, „the celebrated father of electric lighting“ das gewünschte Einführungsschreiben nach Paris ins Hotel du Rhin entgegenzusenden, wofür sich Edison mit seinen Zeilen vom 19. August 1889 bedankte.
Zeige Inhalt von 22.05.1897 - Millets „Novemberabend“ für die Nationalgalerie
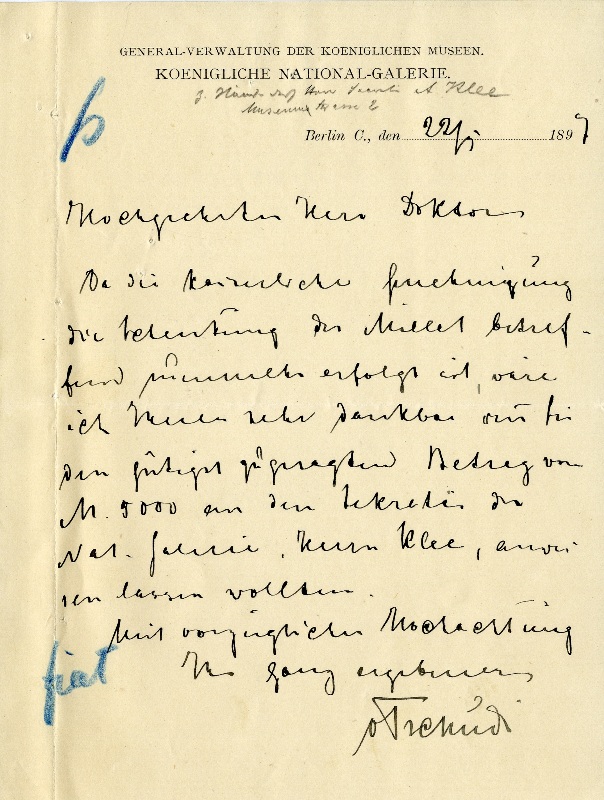 GENERAL-VERWALTUNG DER KOENIGLICHEN MUSEEN
GENERAL-VERWALTUNG DER KOENIGLICHEN MUSEEN
KOENIGLICHE NATIONAL-GALERIE
[z. Händen des Herrn Secretär A[lexis] Klee Museum Strasse 2]
Berlin C., den 22. Mai 1897
Hochverehrter Herr Doctor,
Da die königliche Genehmigung die Schenkung des Millet betreffend nunmehr erfolgt ist, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den gütigst zugesagten Betrag vom M. 5000 an den Sekretär der Nat.-Galerie, Herrn Klee, anweisen lassen wollten.
Mit vorzüglichster Hochachtung
Ihr ganz ergebener
v. Tschudi
Kommentar
Schon in der Kaiserzeit wurde die Deutsche Bank als Institution um Spenden gebeten, doch hauptsächlich war das kulturelle Engagement der Deutschen Bank gleichbedeutend mit dem ihrer Führungspersönlichkeiten. Dabei waren Kontakte von Bankiers zu Künstlern und Museumsleitern üblich. So pflegte zum Beispiel das Vorstandsmitglied Max Steinthal den Kontakt zu dem Generaldirektor der Berliner Museen Wilhelm von Bode. Eine ähnliche Beziehung bestand auch im Fall der Schenkung des Millet-Gemäldes, auf den der Museumsdirektor der Königlichen Nationalgalerie in Berlin, Hugo von Tschudi in seinem Schreiben, an den Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg Siemens, Bezug nimmt. Siemens spendete 1897 zusammen mit gleichgesinnten Kunstfreunden 5000 Mark, um die Anschaffung eines Bildes des französischen Malers Jean-Francois Millet (1814–1875) zu finanzieren. Tschudi war erst im Jahr davor Direktor der Nationalgalerie geworden. Er erweiterte die Sammlung des Museums insbesondere durch Werke französischer Impressionisten. Zu seinen ersten Ankäufen zählten in den Jahren 1896/97 Édouard Manets „Im Wintergarten“ und Paul Cezannes „Die Mühle an Couleuvre bei Pontoise“. Auch hierzu trugen private Spender bei. Bei dem Gemälde, das mit Hilfe von Georg Siemens erworben wurde, handelt es sich wohl um Millets „Novemberabend“. Es zeigt bestelltes Ackerland in den dunklen Farben des Herbsts, ein Vogelscharm kreist in dem wolkenverhangenen Himmel. Im Vordergrund ist eine Egge liegen geblieben. Unter Bäumen am Feldrand arbeitet ein einsamer Bauer. Für diese Art der Genremalerei, mit ihren realistisch, allegorisch unterfütterten Darstellungen des bäuerlichen Lebens, wurde Millet bekannt. So hatte er auch seinen ersten Erfolg 1848 erst, als er sich mythologischen Themen ab- und der bäuerlichen Arbeitswelt und der Landschaftsmalerei zuwandte. Sein Einfluss auf den jungen Vincent van Gogh ist belegt. Seit 1897 befand sich das Gemälde in der Nationalgalerie Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es zusammen mit anderen Kunstgegenständen in den Flakturm Zoo ausgelagert, um es vor den alliierten Bombenangriffen und möglichen Bränden zu schützen. Heute gilt das Bild „Novemberabend“ als verschollen. Im Mai 1945 bargen sowjetische Truppen der „Trophäen-Kommission“ die Kunstgegenstände und brachten sie nach Moskau. Zwar tauchen seit den 1990er-Jahren vermehrt verschollene Gemälde und andere Gegenstände – nicht nur der Berliner Museen – wieder auf. Doch der Verbleib von Jean-Francois Millets „Novemberabend“ bleibt unklar.
Zeige Inhalt von 09.06.1898 - Eine Spende für des Kaisers Bibliothek in Posen
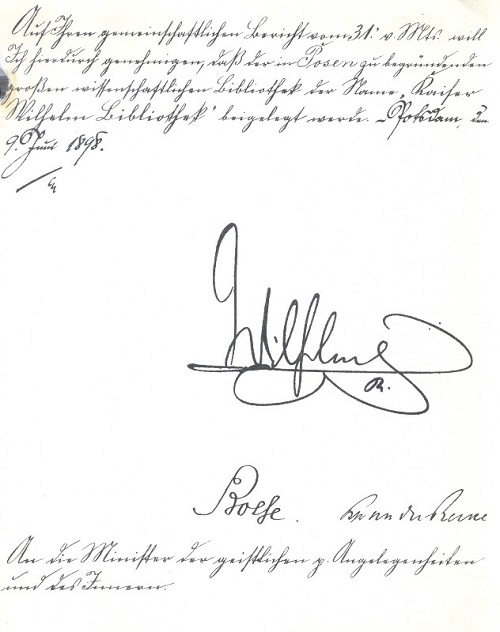 An die Minister der geistlichen p. Angelegenheiten und des Innern.
An die Minister der geistlichen p. Angelegenheiten und des Innern.
Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 31. v. Mts. will Ich hierdurch genehmigen, daß der in Posen zu begründenden großen wissenschaftlichen Bibliothek der Name „Kaiser Wilhelm Bibliothek“ beigelegt werde.
Potsdam, den 9. Juni 1898.
Gez. Wilhelm R.[ex] Bosse [Preuß. Kultusminister] Frhr von der Recke [Preuß. Innenminister]
Kommentar
Die Stadt Poznań, mitten im heutigen Polen gelegen, war vor hundert Jahren die Hauptstadt der preußischen Provinz Posen. Mehrheitlich wurde die Provinz von Polen bewohnt, die auch in der Stadt Posen immerhin 50 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Im deutschen Kaiserreich bildeten die 3,7 Millionen Polen die größte Minderheit. Ihre „Germanisierung“ war erklärtes Ziel der deutschen Politik. Dazu diente neben massiven Eingriffen in den Agrarbesitz vor allem die Verdrängung der polnischen Sprache und Kultur. Diesem Ziel sollte auch die Gründung einer deutschen wissenschaftlichen Bibliothek in Posen dienen, die 1898 von der Reichsregierung beschlossen worden war. Zugleich hatte die Regierung angeregt, die Bibliothek nach Kaiser Wilhelm I. zu benennen, wozu dessen Enkel Kaiser Wilhelm II. mit der hier abgebildeten preußischen Kabinettsordre seine ausdrückliche Genehmigung erteilt hatte. Die Gründung war beschlossen, der Name gefunden, doch es mangelte an Geld. Ein Komitee wurde daher einberufen, und Erich Liesegang, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek und Professor in Berlin, beauftragt, die fehlenden Mittel einzuwerben. Im April 1899 wurde Liesegang auch in der Berliner Zentrale der Deutschen Bank in der Mauerstraße vorstellig. Er suchte um ein Gespräch mit dem Vorstandssprecher Georg Siemens nach, um ihn für das „große nationale Unternehmen“ der Kaiser Wilhelm Bibliothek in Posen zu interessieren und um eine Spende zu bitten. Die Kabinettsordre Wilhelms II. legte er dabei im Vorstandssekretariat vor. Siemens lehnte jedoch ein Gespräch aus Zeitgründen ab; und auch sonst war ihm anzumerken, dass ihm die Sache eher widerstrebte. Über seinen Besucher und sein Anliegen notiert er: „Seine Absicht geht augenblicklich nicht auf die 100 M, welche er von mir loseisen könnte, sondern auf eine größere Spende der DB. Ich kann nicht finden, daß die DB ein Interesse an dieser Sache haben kann. Wir sind nicht national, sondern international: die Polenfurcht, d.h. die Furcht der Majorisierung des Reiches durch eine schwache Minorität scheint mir wenig begründet.“ In diesen wenigen Worten manifestierte sich das Weltbild des Mannes, der zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre an der Spitze genau des Instituts stand, das eigens für „die Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen europäischen Ländern und überseeischen Märkten“ gegründet worden war. In wirtschaftlicher wie in innenpolitischer Hinsicht blieb Siemens stets ein Liberaler. Der Nationalismus seiner wilhelminischen Zeitgenossen war nicht seine Sache. Sein Vorstandskollege Arthur Gwinner war hingegen eher zu Konzessionen an den Zeitgeist bereit, wie aus seinen Anmerkungen zu der Spendenanfrage hervorgeht: „Ich bin zwar der Ansicht, daß die Germanisierung der polnischen Provinzen eine sehr wichtige Aufgabe der deutschen Nation ist, aber mit Dr. Siemens einig, daß die D.B. hierzu keine Mittel hat. Persönlich gebe ich gerne M 100.“ Im offiziellen Antwortschreiben der Deutschen Bank ließ Siemens Professor Liesegang wissen, „daß gesetzliche Bestimmungen und statutarische Vorschriften es der Deutschen Bank untersagen, die Mittel ihrer Aktionäre für dergleichen, außerhalb des statutarischen Zwecks lagernde Unternehmungen zu verwenden.“ Dem Schreiben lagen aber noch zwei Schecks bei, womit Siemens 50 Mark und Gwinner 100 Mark auf eigene Rechnung für die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek beisteuerten. Dies waren keine Bagatellbeträge, wie es heute erscheinen mag, denn 100 Mark machten etwa die Hälfte des monatlichen Durchschnittsgehalts eines damaligen Bankangestellten aus. Doch mit diesen privaten Spenden war die Sache elegant aus der Welt geschafft, ohne die Bank zu kompromittieren. Im September 1902 wurde die Bibliothek in Posen eröffnet. Kaiser Wilhelm II. war dazu eigens in die Stadt an der Warthe gereist. Heute ist in dem Gebäude, das von dem Architekten Karl Hinkeldeyn im Stile der Spätrenaissance erbaut wurde, die Universitätsbibliothek Poznań untergebracht.
Zeige Inhalt von 24.12.1898 - Weihnachtsgrüße an unseren Mann in den USA
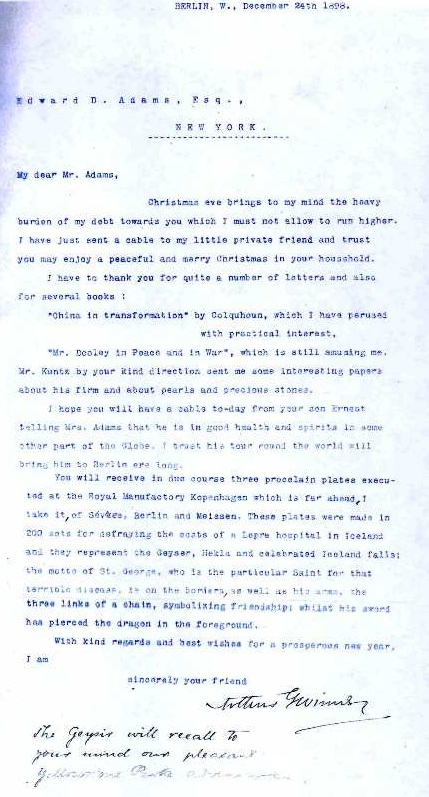 Berlin, W., December 24th 1898.
Berlin, W., December 24th 1898.
Edward D. Adams, Esq., New York
My dear Mr. Adams,
Christmas eve brings to my mind the heavy burden of my debt towards you which I must not allow to run higher. I have just sent a cable to my little private friend and trust you may enjoy a peaceful and merry Christmas in your household.
I have to thank you for quite a number of letters and also for several books:
‘China in transformation’ by Colquhoun, which I have perused with practical interest,
‘Mr. Dooley in Peace and War’, which is still amusing me.
Mr. Kuntz by your kind direction sent me some interesting papers about his firm and about pearls and precious stones.
I hope you will have a cable to-day from your son Ernest telling Mrs. Adams that he is in good health and spirits in some other part of the Globe. I trust his tour round the world will bring him to Berlin ere long.
[…].
You will receive in due course three porcelain plates executed at the Royal Manufactory Kopenhagen which is far ahead, I take it, of Sévres, Berlin and Meissen. These plates were made in 200 sets for defraying the costs of a Lepra hospital in Iceland and they represent the Geyser, Hekla and celebrated Iceland falls; the motto of St. George, who is the particular Saint for that terrible disease, is on the borders, as well as his arms, the three links of a chain, symbolizing friendship; whilst his sword has pierced the dragon in the foreground.
With kind regards and best wishes for a prosperous new year,
I am sincerely your friend
Arthur Gwinner
P.S. The Geysir will recall to your mind our pleasant Yellowstone Park adventures
Kommentar
Edward D. Adams, den das Vorstandmitglied Arthur Gwinner am Heiligen Abend 1898 mit so freundlichen Weihnachtswünschen und einem recht originellen Porzellangeschenk bedachte, war der langjährige Repräsentant der Deutschen Bank in den USA. Seit 1893 vertrat der anerkannte Finanz- und Eisenbahnexperte die Interessen der Berliner Großbank und leistete ihr bis 1914 hervorragende Dienste. Begonnen hatte diese enge Geschäftsbeziehung mit einem Sanierungsfall: Als die Northern Pacific Railway Company, deren Anleihen die Deutsche Bank auf dem deutschen Kapitalmarkt eingeführt hatte, überraschend zusammenbrach, bildete die Bank ein Reorganisationskomitee. Edward D. Adams übernahm dessen Vorsitz und entwickelte den Plan zur Rettung des Unternehmens. Nach der geglückten Sanierung vertrat Adams mit immenser Tatkraft, akribischer Sorgfalt und enormem organisatorischen Geschick die Geschäfte der Deutschen Bank in den USA. Er kümmerte sich nicht nur um die Investitionen der Bank auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern versorgte die Leitung in Berlin auch mit detaillierten Informationen über das amerikanische Wirtschaftsgeschehen und weit darüber hinaus, wie die übersandten Bücher über den Wandel in China und die Kolumnensammlung „Mr. Dooley in Peace and War“ zeigen, für die sich Gwinner in seinem Weihnachtsbrief ausdrücklich bedankte. Der Vorstand der Deutschen Bank schätzte Adams als „klaren Kopf und exacten Arbeiter“ auf den er sich unbedingt verlassen konnte, wenn er auch, wie Gwinner meinte „etwas empfindlich, oder, wie die Engländer sagen, touchy, [sei] und sehr empfänglich dafür, dass man ihm auch Vertrauen schenk[e] und ihn dies merken [lasse]." Wie der warme und herzliche Ton des eingangs wiedergegebenen Schreibens zeigt, beschränkte sich der Kontakt zwischen Adams und Gwinner nicht nur auf das rein Geschäftliche. Beide verband eine echte Freundschaft, die durch Adams’ regelmäßige Besuche in Deutschland vertieft wurde. Ansonsten gingen fast täglich Briefe, Telegramme oder Paketsendungen zwischen New York und Berlin hin und her. Die Zahl der erhaltenen Schreiben geht in die Tausende. Korrespondiert wurde in Englisch, das Gwinner, der als junger Angestellter mehr als vier Jahre in der Londoner City verbracht hatte, hervorragend beherrschte. Im Sommer 1896 war Gwinner in die USA gereist, um unterstützt von Adams Verhandlungen über Eisenbahn-Investitionen mit der New Yorker Bankierlegende John Pierpont Morgan zu führen. Bei dieser Reise informierte sich Gwinner auch grundlegend über die amerikanischen Verhältnisse. In Begleitung von Adams fuhr er von New York nach Chicago bis tief in den amerikanischen Westen. Im Bundesstaat Wyoming besuchten sie den schon damals weltberühmten Yellowstone Park, auf dessen Hauptattraktion Gwinner nicht nur im Nachtrag seines Weihnachtsbriefes hinwies, auch in seinen Lebenserinnerungen beschrieb er das eindrucksvolle Schauspiel der Geysire: „Mit den bis 100 Fuß hoch ausgeschleuderten Massen heißen Wassers dringen gewaltige Wolken schneeweißen Dampfes empor. Vor dem tiefblauen Himmel (– der Park liegt im Durchschnitt so hoch wie das Engadin –) wirken diese Dampfwolken nicht nur großartig, sondern überaus malerisch, wie es kein Bild erreichen kann.“
weiterführende Informationen
Christopher Kobrak – Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute
Zur deutschen und amerikanischen Identität – Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999
Zeige Inhalt von 17.01.1900 - Max Slevogts eheherrlicher Consens
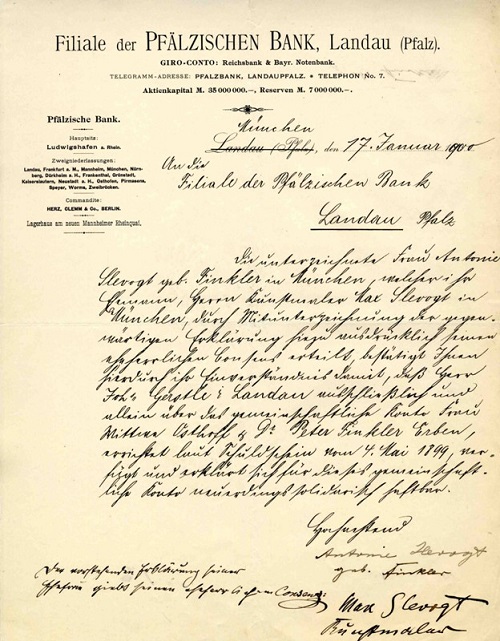 München, den 17.Januar 1900
München, den 17.Januar 1900
An die Filiale der Pfälzischen Bank
Landau Pfalz
Die unterzeichnete Frau Antonie Slevogt geb. Finkler in München, welcher ihr Ehemann, Herrn Kunstmaler Max Slevogt in München, durch Mitunterzeichnung der gegenwärtigen Erklärung hiezu ausdrücklich seinen eheherrlichen Consens erteilt, bestätigt Ihnen hierdurch ihr Einverständnis damit, daß Herr Joh. Gerstle in Landau ausschließlich und allein über das gemeinschaftliche Konto Frau Wittwe [sic] Osthoff & Dr. Peter Finkler Erben, errichtet laut Schuldschein vom 04.Mai 1899, verfügt und erklärt sich für dieses gemeinschaftliche Konto neuerdings solidarisch haftbar.
Hochachtend
Antonie Slevogt
geb. Finkler
Der vorstehenden Erklärung seiner Ehefrau giebt seinen
eheherrlichen Consens: Max Slevogt
Kunstmaler
Kommentar
Bei Landau in der Pfalz liegt am äußersten Rand des Pfälzer Walds auf einem sanft auslaufenden Hügel, der einen weiten Blick in die Rheinebene bietet, der Slevogthof Neukastel. Er ist benannt nach seinem prominentesten Bewohner, dem Maler Max Slevogt, der zusammen mit Max Liebermann und Lovis Corinth zu den bedeutendsten deutschen Impressionisten zählt. Die Gegend bei Landau kannte Slevogt durch Ferienaufenthalte bereits seit Kindertagen. Noch als Student an der Münchner Akademie der Bildenden Künste machte er die Bekanntschaft mit Antonie Finkler, der Tochter des Gutsherren, der wenige Jahre zuvor das Herrenhaus, welches aus einem ehemaligen Maierhof der Burg Neukastel hervorgegangen war, erworben hatte. Seit dieser Zeit weilte Slevogt häufig als Gast in Neukastel und war dort auch künstlerisch tätig. 1898 heiratete er Antonie Finkler, deren Vater zwei Jahre zuvor verstorben war. Um die finanziellen Verhältnisse seiner Schwiegereltern scheint es nicht gut bestellt gewesen zu sein. Jedenfalls war die Erbengemeinschaft, darunter auch das Ehepaar Slevogt, gezwungen, ein Darlehen von 21.000 Mark bei der Pfälzischen Bank in Landau aufzunehmen. Die zu diesem Darlehen gehörende Bürgschaftserklärung, die Antonie und Max Slevogt im Januar 1900 unterzeichneten, hat sich in den Akten der Landauer Filiale der Pfälzischen Bank erhalten. (Aufgrund der Übernahme der Pfälzischen Bank durch die Rheinische Creditbank in Mannheim und deren Verschmelzung mit der Deutschen Bank fanden diese Akten den Weg ins Archiv der Deutschen Bank.) Die finanzielle Lage verbesserte sich indessen nicht. Nachdem 1913 die in der Tabakfabrikation tätigen Finklerschen Unternehmen zusammengebrochen waren, konnte Max Slevogt nur wenige Wochen vor Beginn des Ersten Weltkriegs das Gut Neukastel aus der Konkursmasse ersteigern. Bezahlt hat er den Landsitz mit dem Erlös aus 20 Gemälden, die er an die Gemäldegalerie in Dresden verkaufte. In den zwanziger Jahren ließ er das Anwesen erweitern. Eine Bibliothek und ein Musiksaal kamen hinzu, die er mit eigenen Wandgemälden ausschmückte. Neukastel wurde zu seinem Lebensmittelpunkt, unzählige Werke entstanden an diesem Lieblingsort. Sie zeigen die Familie, das Haus, die weite Landschaft und ihre Menschen. Viele seiner Gemälde sind heute in der Max Slevogt-Galerie im nahegelegenen Schloss „Villa Ludwigshöhe“ zu sehen. Mit dem 1911 entstandenen Gemälde „Regenbach“ befindet sich auch ein Werk Slevogts in der Sammlung der Deutschen Bank. Slevogt starb 1932 auf seinem Gut in Neukastel und wurde auf einem kleinen Privatfriedhof, etwa 200 Meter neben seinen Landsitz, beigesetzt. Der Slevogthof gehört noch heute direkten Nachkommen des Malers und kann besichtigt werden.
Zeige Inhalt von 25.10.1904 - Eröffnung der ersten Teilstrecke der Bagdadbahn
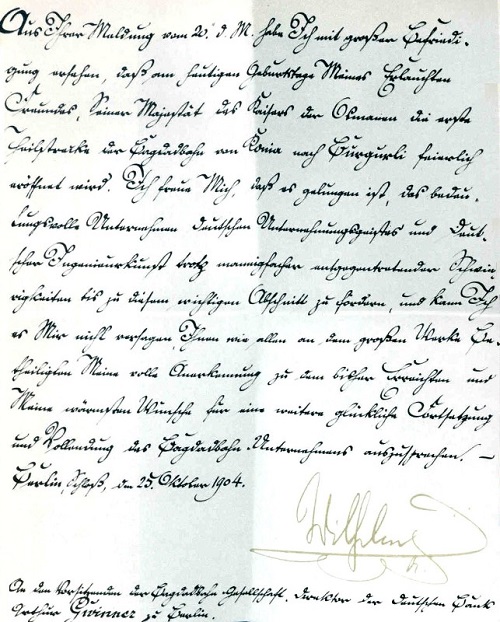 An den Vorsitzenden der Bagdadbahn-Gesellschaft, Direktor der Deutschen Bank Arthur Gwinner zu Berlin
An den Vorsitzenden der Bagdadbahn-Gesellschaft, Direktor der Deutschen Bank Arthur Gwinner zu Berlin
Aus Ihrer Meldung vom 20. d. M. habe Ich mit großer Befriedigung ersehen, daß am heutigen Geburtstage Meines Erlauchten Freundes, Seiner Majestät des Kaisers der Osmanen die erste Theilstrecke der Bagdadbahn von Konia nach Burgurli feierlich eröffnet wird. Ich freue Mich, daß es gelungen ist, das bedeutungsvolle Unternehmen deutschen Unternehmungsgeistes und deutscher Ingenieurkunst trotz mannigfacher entgegentretender Schwierigkeiten bis zu diesem wichtigen Abschnitt zu fördern, und kann Ich es mir nicht versagen, Ihnen wie allen an dem großen Werke Betheiligten Meine volle Anerkennung zu dem bisher Erreichten und Meine wärmsten Wünsche für eine weitere glückliche Fortsetzung und Vollendung des Bagdadbahn-Unternehmens auszusprechen.
Berlin, Schloß, den 25. Oktober 1904.
Wilhelm
Kommentar
Am 25. Oktober 1904 erhielt Arthur Gwinner, Vorstandssprecher der Deutschen Bank und Aufsichtsratvorsitzender der Bagdadbahn-Gesellschaft ein Gratulationsschreiben Kaiser Wilhelms II. Anlass war die feierliche Eröffnung des ersten Teilstücks der Bagdadbahn, das von Konia in Zentralanatolien über rund 200 Kilometer nach Burgurlu, am Fuß des Taurus-Gebirges führte. Es war in weniger als einem Jahr fertiggestellt worden. Der Bau der Bagdadbahn war zweifellos das spektakulärste Großprojekt, an dem sich die Deutsche Bank als Finanzier und Betreiber vor dem Ersten Weltkrieg beteiligte. Kein anderes Engagement hat die Gemüter so erregt wie diese Bahnlinie, die vom Bahnhof Haidarpascha im asiatischen Teil Istanbuls bis an den Persischen Golf führen sollte. Begonnen hatte alles 1888, als sich Sultan Abdul Hamid II. an deutsche Finanzkreise wandte. Eine Eisenbahn sollte das riesige Türkenreich vom Bosporus bis zum Schat el Arab wirtschaftlich und strategisch erschließen. Nach anfänglicher Skepsis engagierte sich die Deutsche Bank für dieses Projekt. Im Oktober 1888 erhielt sie die Konzessionen für die ersten Teilstrecken von Haidarpascha nach Ismid und von dort weiter nach Ankara. Die Bau- und Betriebskonzession für die Eisenbahn wurde einer eigens gegründeten Aktiengesellschaft türkischen Rechts, der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft, übertragen. Ihre Aktien waren mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bank.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Manfred Pohl – Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn
Zeige Inhalt von 10.04.1905 - „Eine Vereinigung, bei der sich unser Personal näher trifft“ - Chor und Orchestervereinigung in der Deutschen Bank
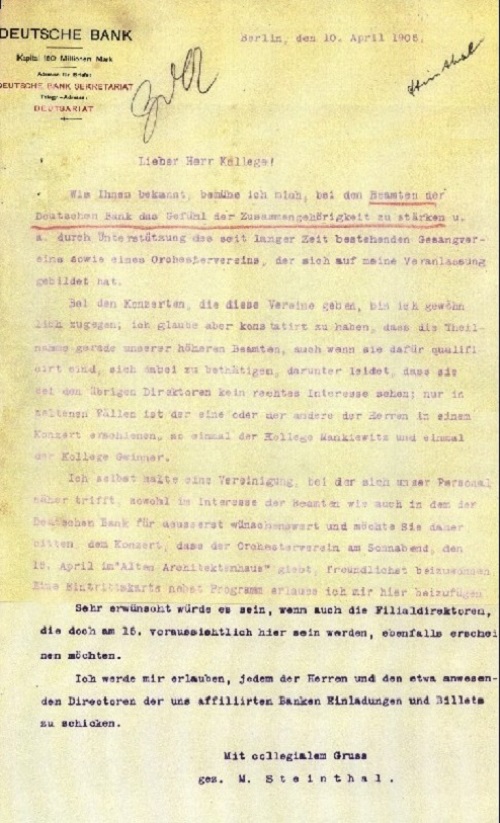 Herrn Director MICHALOWSKY
Herrn Director MICHALOWSKY
- hier -
Berlin, den 10. April 1905
Lieber Herr Kollege!
Wie Ihnen bekannt, bemühe ich mich, bei den Beamten der Deutschen Bank das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken u.a. durch Unterstützung des seit langer Zeit bestehenden Gesangvereins sowie eines Orchestervereins, der sich auf meine Veranlassung gebildet hat.
Bei den Konzerten, die diese Vereine geben, bin ich gewöhnlich zugegen; ich glaube aber konstatirt zu haben, dass die Theilnahme gerade unserer höheren Beamten, auch wenn sie dafür qualificirt sind, sich dabei zu bethätigen, darunter leidet, dass sie bei den übrigen Direktoren kein rechtes Interesse sehen; nur in seltenen Fällen ist der eine oder der andere der Herren in einem Konzert erschienen, so einmal der Kollege Mankiewitz und einmal der Kollege Gwinner.
Ich selbst halte eine Vereinigung, bei der sich unser Personal näher trifft, sowohl im Interesse der Beamten wie auch der Deutschen Bank für aeusserst wünschenswert und möchte Sie daher bitten, dem Konzert, dass [sic!] der Orchesterverein am Sonnabend, den 15. April im ‚Alten Architektenhaus’ giebt, freundlichst beizuwohnen. Eine Eintrittskarte nebst Programm erlaube ich mir hier beizufügen. Sehr erwünscht würde es sein, wenn auch die Filialdirektoren, die doch am 15. voraussichtlich hier sein werden, ebenfalls erscheinen möchten.
Ich werde mir erlauben, jedem der Herren und den etwa anwesenden Directoren der uns affiliirten Banken Einladungen und Billets zu schicken.
Mit collegialem Gruss
gez. M. Steinthal
Kommentar
Im April 1905 machte Max Steinthal (1850-1940), seit 1873 im Vorstand der Deutschen Bank, seinem Unmut Luft. Seinen Vorstandskollegen, damals noch als Direktoren bezeichnet, mangelte es offensichtlich an Corporate Identity – zumindest was ihr Interesse für das künstlerische Engagement ihrer Mitarbeiter anbetraf. Sowohl der Gesangverein, wie auch die Orchestervereinigung der Deutschen Bank gingen auf eine Anregung Steinthals zurück. Aus den Mitteln einer 1898 von ihm errichteten Stiftung, deren Kapital er zweimal aufstockte, konnten diese beiden Kulturvereine für sanges- bzw. musizierfreudige Mitarbeiter der Zentrale ab 1900 aufgebaut werden. Den beiden Vereinigungen blieb Steinthal über lange Jahre als "Protektor" verbunden und unterstützte sie mehrfach durch großzügige Stiftungen. Die Erträge des Stiftungskapitals dienten zur Beschaffung von Noten, zur Deckung der Unkosten bei Konzerten und zur Honorierung der (externen) Dirigenten. In den ersten Jahren ihres Bestehens scheinen beide Vereine, zumindest nach Einschätzung ihres Mentors Steinthal, von den übrigen Führungskräften der Bank nur unzureichend wahrgenommen worden zu sein. Deshalb wandte er sich am 10. April 1905 persönlich an seinen unter anderem für Personalfragen zuständigen Direktorenkollegen Carl Michalowsky, um ihn nachdrücklich auf das kurz bevorstehende Konzertereignis hinzuweisen. Stücke von Beethoven, Brahms, Johann Strauß (natürlich mit „An der schönen blauen Donau“) und Boccherini standen auf dem Programm, aber auch Werke von heute kaum noch bekannten Komponisten wie Moszkowsky und Wieniawsky. Leider ist eine Antwort Michalowskys nicht überliefert, noch ist bekannt, ob auch die übrigen Vorstände mit gleich- oder ähnlichlautenden Mahnschreiben bedacht wurden. Chor und Orchester setzten ihre „CI“ stiftende Tätigkeit jedenfalls unbeirrt fort, wenngleich im Ersten Weltkrieg die Aktivitäten zeitweilig zum Erliegen kamen. Zum 25jährigen Bestehen der beiden Vereine stiftete der Vorstand einen Bechstein-Flügel und als ab Oktober 1927 eine Mitarbeiterzeitschrift der Deutschen Bank erschien, gehörte die Berichterstattung über die Aktivitäten von Chor und Orchester zu deren festen Rubriken. Dem Vorbild der Berliner Zentrale folgten im Oktober 1927 Angestellte der Filiale Köln und im Januar 1928 Beamte der Filiale Breslau, die ebenfalls Gesangvereine gründeten. Sowohl die Übungsstunden des Gesangvereins der Berliner Zentrale wie auch die der Orchestervereinigung fanden in den Räumen des Klubs der Beamten der Deutschen Bank in der Behrenstrasse statt. Nach der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft, wurde deren bereits seit 1897 bestehender Gesangverein mit demjenigen der Deutschen Bank zusammengelegt. In der NS-Zeit werden die Nachrichten über die beiden Musenvereinigungen spärlicher. Die Ankündigung eines Festkonzerts aus Anlass des 40jährigen Bestehens des nunmehr als Männerchor bezeichneten Gesangverein im Oktober 1940 ist der letzte Hinweis auf die Aktivitäten von Chor und Orchester in der Deutschen Bank, die später aufgrund des Krieges eingestellt und auch nach 1945 nicht neu belebt wurden.
weiterführende Informationen
Zeige Inhalt von 30.10.1908 - Rudolf Diesel und die Deutsche Bank
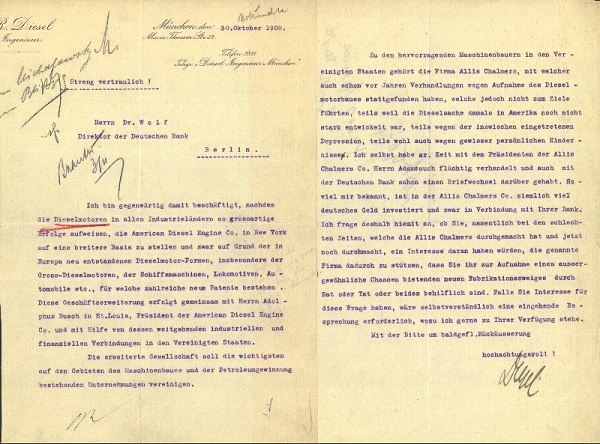 R. Diesel München, den 30. Oktober 1908
R. Diesel München, den 30. Oktober 1908
Ingenieur Maria Theresia-Straße 32
Telefon 2811
Telegr. „Diesel Ingenieur München“
Streng vertraulich!
Herrn Dr. Wolf
Direktor Deutsche Bank
Berlin.
Ich bin gegenwärtig damit beschäftigt, nachdem die Dieselmotoren in allen Industrieländern so grossartige Erfolge aufweisen, die American Diesel Engine & Co. in New York auf eine breitere Basis zu stellen und zwar auf Grund der in Europa neu entstandenen Dieselmotor-Formen, insbesondere der Gross-Dieselmotoren, der Schiffsmaschinen, Lokomotiven, Automobile etc., für welche zahlreiche neue Patente bestehen. Diese Geschäftserweiterung erfolgt gemeinsam mit Herrn Adolphus Busch in St. Louis, Präsident der American Diesel Engine Co. und mit Hilfe von dessen weitgehenden industriellen und finanziellen Verbindungen in den Vereinigten Staaten.
Die erweiterte Gesellschaft soll die wichtigsten auf den Gebieten des Maschinenbaues und der Petroleumgewinnung bestehenden Unternehmen vereinigen.
Zu den hervorragenden Maschinenbauern in den Vereinigten Staaten gehört die Firma Allis Chalmers, mit welcher auch schon vor Jahren Verhandlungen wegen Aufnahme des Dieselmotorbaues stattgefunden haben, welche jedoch nicht zum Ziele führten, teils weil die Dieselsache damals in Amerika noch nicht stark entwickelt war, teils wegen der inzwischen eingetretenen Depression, teils wohl auch wegen gewisser persönlichen Hindernissen. Ich selbst habe sr. Zeit mit dem Präsidenten der Allis Chalmers Co. Herrn Adams auch flüchtig verhandelt und auch mit der Deutschen Bank schon einen Briefwechsel darüber gehabt. Soviel mir bekannt, ist in der Allis Chalmers Co. ziemlich viel deutsche Geld investiert und zwar in Verbindung mit ihrer Bank. Ich frage deshalb hiemit an, ob Sie, namentlich bei den schlechten Zeiten, welche die Allis Chalmers durchgemacht hat und jetzt noch durchmacht, ein Interesse daran haben würde, die genannte Firma dadurch zu stützen, dass Sie ihr zur Aufnahme eines aussergewöhnliche Chancen bietenden neuen Fabrikationszweiges durch Rat oder Tat oder beides behilflich sind. Falls Sie Interesse für diese Frage haben, wäre selbstverständlich eine eingehende Besprechung erforderlich, wozu ich gerne zu Ihrer Verfügung stehe.
Mit der Bitte um baldgefl. Rückäusserung
hochachtungsvoll!
gez. Diesel
Kommentar
Seit ihrer Gründung 1870 hat das Auslandsgeschäft große Bedeutung für die Deutsche Bank. Vor allem die USA bildeten seit der Mitte der 1890er Jahren einen Kernbereich deutscher Investitionen. Die durch die Förderung deutscher Kapitalanlagen in den USA geknüpften Geschäftsverbindungen zu amerikanischen Firmen sind und waren für die deutsche Wirtschaft immer äußerst interessant. Im vorliegenden Brief vom 30. Oktober 1908 war es der deutsche Erfinder Rudolf Diesel, der sich erhoffte, durch Vermittlung der Deutschen Bank die Vermarktung und den Vertrieb seiner Dieselmotoren „insbesondere der Gross-Dieselmotoren, der Schiffsmaschinen, Lokomotiven, Automobile etc.“ in den USA zu forcieren. Zwischen 1893 und 1897 hatte Rudolf Diesel einen Wärmekraftmotor mit deutlich höherem Wirkungsgrad im Vergleich zu dem 1860 entwickelten Verbrennungsmotor von Nikolaus Otto erfunden und realisiert. Die Reaktionen auf den neuen Dieselmotor waren ambivalent. Während die Weltöffentlichkeit Diesel als genialen Erfinder feierte und er über Nacht berühmt wurde, sah er sich mit boshaften Anfeindungen und Plagiatsvorwürfen der Konkurrenz und einiger deutscher Wissenschaftler konfrontiert. Rudolf Diesel wurde durch die Lizenzeinnahmen aus seinen Teilpatenten schnell zum mehrfachen Millionär. Sein Geisteszustand war jedoch auf Grund seines unermüdlichen Arbeitseifers und der nervlichen Anspannung vor dem Hintergrund der Plagiatsvorwürfe und drohenden Anfechtungen seiner Erfindung kritisch. Als Unternehmer hatte Rudolf Diesel kein Glück. Die 1898 mit 100.000 Mark aus seinem Privatvermögen und finanzieller Unterstützung der Augsburger Bankhäuser Mayer & Gerstle und Bonnet gegründete Diesel Motoren-Fabrik AG Augsburg, musste bereits zwei Jahre später ihre Produktion wieder einstellen musste und 1911 liquidiert werden. Zum einen fehlte die Erfahrung im Maschinenbau und zum anderen belasteten die jährlich anfallenden 100.000 Mark Lizenzgebühren für die Hauptpatentrechte die neue Firma, was Diesel frustriert kommentierte: „Es ist wie wenn man Apfelwein von seinem eigenen Apfelbaum kauft". Auch die Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren AG, die im Oktober 1898 zur Verwaltung und Nutzung der Patentrechte Rudolf Diesels gegründet worden war, scheiterte. Zunächst verkaufte Diesel seine Rechte an die Gesellschaft für 3.5 Mio. Mark und reinvestierte sie in Prioritätsaktien der Gesellschaft, wovon ihm nach dem Ausbleiben von erhofften Lizenzeinnahmen nur noch 250.000 Mark blieben. Schließlich sah sich Diesel 1907/08 nach misslungenen Immobilienspekulationen gezwungen, neue Geschäftsfelder zu erschließen um die Finanzierung seiner Entwicklungsarbeit an einem Dieselmotor für Lokomotiven und Kleinlaster weiter zu gewährleisten. So versuchte er die Vermarktung und Einführung seines Dieselmotors vor allem in den USA voranzutreiben. Bereits 1897 hatte Adolphus Busch, ein deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Gründer der Brauerei Anheuser-Busch, die Lizenzrechte für den Dieselmotor in den USA erworben. Er gründete die Diesel Motor Company of America mit Sitz in New York, die zunächst in Deutschland gefertigte Dieselmotoren in den USA vertrieb. In den nächsten Jahren scheiterten die Versuche eigene Dieselmotoren zu konstruieren, und die Firma formierte sich 1904 mit der International Power Company zur American Diesel Engine & Co. Rudolf Diesel und Adolphus Busch hatten sich während der Aufenthalte Buschs in seiner Heimat Deutschland kennengelernt und beschlossen zusammenzuarbeiten, wobei Busch seinen Geschäftssinn und Diesel die technologische Kompetenz in die Geschäftsbeziehung einbrachten. Nach dem Ablauf der Hauptpatente für Diesels Motor 1908 versuchten er und Busch in den USA mit dem Dieselmotor im Schiffs-, Eisenbahn- und Automobilsektor zu expandieren. Daher suchten sie Investoren und wandten sich im September 1908 auch an die Deutsche Bank, die allerdings nicht an direkten Investitionen in die American Diesel Engine & Co. interessiert war. Darüber hinaus benötigten Busch und Diesel einen kompetenten und erfahrenen Partner im Maschinenbausektor um die eigene Produktion eines Diesel-Motors sicherzustellen und nicht mehr auf Importe aus Deutschland angewiesen zu sein. Diesel und Busch waren vor allem an einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Maschinenbauer Allis-Chalmers & Co. interessiert. Mit dem Präsidenten der Firma Edward D. Adams, der seit 1893 als Vertrauensmann und Repräsentant der Deutschen Bank in den USA agierte, hatten sie schon ergebnislose Verhandlungen geführt. Daraufhin bat Diesel in dem vorliegenden Brief die Deutsche Bank um Hilfe, die auf Grund ihres finanziellen Einflusses auf Allis-Chalmers eine Zusammenarbeit in die Wege leiten sollte. Die Deutsche Bank war zwar durchaus geneigt, bei der Vermittlung und Kontaktaufnahme zu helfen, wollte aber nicht direkt zugunsten Diesels auf Allis-Chalmers einwirken. Es kam schließlich nicht zu einer Zusammenarbeit. Adolphus Busch und die American Diesel schlossen sich 1911 mit dem Schweizer Maschinenbauer Gebrüder Sulzer AG zu Busch-Sulzer Brothers-Diesel Engine Corp. zusammen, die danach erfolgreich Lokomotiv- und U-Bootmotoren produzierte. Diesel hingegen blieb der unternehmerische Erfolg weiterhin versagt. Auf einer Reise durch die USA 1912 wurde er als bedeutender Erfinder frenetisch gefeiert, doch finanziell war er ruiniert. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland sah Diesel keinen Ausweg aus seiner finanziellen Notlage mehr und beging 1913 auf der Überfahrt von Antwerpen nach England Selbstmord.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Christopher Kobrak – Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute
Zur deutschen und amerikanischen Identität – Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999
Zeige Inhalt von 08.10.1910 - "Ein furchtbarer Geruch nach Veilchen": Die ersten Frauen im Bankgewerbe
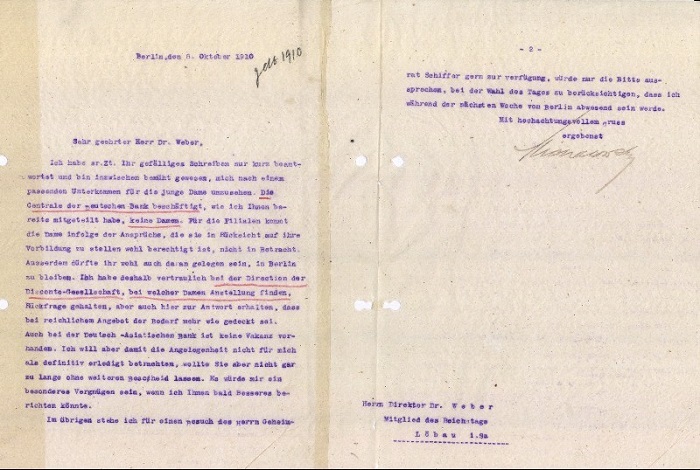 Sehr geehrter Herr Dr. Weber,
Sehr geehrter Herr Dr. Weber,
Ich habe sr. Zt. Ihr gefälliges Schreiben nur kurz beantwortet und bin inzwischen bemüht gewesen, mich nach einem passenden Unterkommen für die junge Dame umzusehen. Die Centrale der Deutschen Bank beschäftigt, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, keine Damen. Für die Filialen kommt die Dame infolge der Ansprüche, die sie in Rücksicht auf ihre Vorbildung zu stellen wohl berechtigt ist, nicht in Betracht. Außerdem dürfte ihr wohl auch daran gelegen sein, in Berlin zu bleiben. Ich habe deshalb bei der Direction der Disconto-Gesellschaft, bei welcher Damen Anstellung finden, Rückfrage gehalten, aber auch hier zur Antwort erhalten, dass bei reichlichem Angebot der Bedarf mehr wie gedeckt sei. Auch bei der Deutsch-Asiatischen Bank ist keine Vakanz vorhanden. Ich will aber die Angelegenheit nicht für mich als definitiv erledigt betrachten, wollte Sie aber nicht gar zu lange warten lassen. Es würde mir ein besonderes Vergnügen sein, wenn ich Ihnen bald Besseres berichten könnte.
Im übrigen stehe ich für einen Besuch des Herrn Geheimrat Schiffer gern zur Verfügung, würde nur die Bitte aussprechen, bei der Wahl des Tages zu berücksichtigen, dass ich während der nächsten Woche von Berlin abwesend sein werde.
Mit hochachtungsvollem Gruss
ergebenst
Michalowsky
Kommentar
„Die Centrale der Deutsche Bank beschäftigt keine Damen", stellte Carl Michalowsky, der im Vorstand für Personalfragen zuständig war, lapidar fest, als er 1910 von dem Bankierkollegen und Reichstagsabgeordneten August Weber auf die Beschäftigungsmöglichkeit einer „jungen Dame“ angesprochen wurde. Die Bewerberin war offenbar sogar akademisch qualifiziert, was zu einer Zeit, in der Frauen erst seit wenigen Jahren ein Studium gestattet wurde, eine seltene Ausnahme darstellte. Bei dem Versuch, in einer Bank Fuß zu fassen, war dies jedoch eher hinderlich. Wenn überhaupt wurden Frauen nur als Ungelernte mit niedrigen Gehältern angestellt, etwa zur Bedienung der neu entwickelten Schreibmaschine, die in immer mehr Büros Einzug hielt und den alt eingesessenen Beruf des (männlichen) Kanzleischreibers überflüssig machte. Bei den Bankangestellten stieß die Beschäftigung der ersten Frauen denn auch größtenteils auf Ablehnung. Kommentare, wie "die Weiberwirtschaft einiger hiesiger Großbanken ist sehr zu verwerfen", waren typisch für die Stimmungslage im Bankgewerbe vor dem Ersten Weltkrieg. So ist es nicht verwunderlich, dass der Beruf des Bankkaufmanns bis in die Mitte der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine Domäne des männlichen Geschlechts blieb. Erst während des Ersten Weltkrieges und der anschließenden Inflationszeit mit ihrem erhöhten Bedarf an Büropersonal kamen Frauen in größerer Zahl in die Banken. Sie arbeiteten überwiegend als Hilfskräfte an den Büromaschinen, die im Zuge der zunehmenden Automatisierung eingesetzt wurden. Insgesamt erhöhte sich in den Jahren 1875 bis 1907 der Frauenanteil an den Bankangestellten in Deutschland von 0,7 Prozent auf 5,5 Prozent und stieg bis 1925 immerhin auf 21 Prozent. Die Deutsche Bank beispielsweise beschäftigte im Jahre 1927 in der Zentrale in den Filialen 8.363 männliche und 2.082 weibliche Tarifangestellte sowie 711 männliche und 150 weibliche Lehrlinge. Unter den 1.245 Direktoren, Prokuristen und sonstigen Oberbeamten befand sich allerdings noch keine einzige Frau. Auf Widerstand stieß die Einstellung von Frauen vor allem bei den männlichen Bankangestellten und ihren Interessenverbänden. Als Gründe gegen die Frauenarbeit wurden angeführt: die Büroluft sei für Frauen gesundheitsschädlich, sie seien nicht leistungsfähig und intelligent genug, sie hätten keinen Ehrgeiz und betätigten sich als "Lohndrückerinnen". Neben diesen Scheinargumenten kam es zu grotesken Beschwerden der männlichen Angestellten, die sich über "den furchtbaren Geruch nach Veilchen" in den Büroräumen beklagten. Der "Deutsche Bankbeamtenverein" nahm überhaupt keine weiblichen Mitglieder auf und hielt noch 1915 die Einstellung von Frauen für überflüssig. So hieß es in einem offiziellen Schreiben: "Wir werden im Interesse unseres Standes stets den Standpunkt vertreten, daß eine Anstellung weiblicher Bankbeamten in jedem Falle zu bekämpfen ist, und es dürfte auch im wohlverstandenen Interesse der Banken selbst liegen, wenn sie die Erledigung aller banktechnischen Arbeiten nach wie vor den Männern überlassen wollten, statt den Bankbetrieb in warenhausmäßiger Weise umzugestalten."
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Zeige Inhalt von 01.07.1915 - Ein Pass zur Reise nach Konstantinopel
 Deutsches Reich
Deutsches Reich
Paßjournal Nr. 768
Gebührenfrei!
Das Auswärtige Amt ersucht hiermit sämtliche Zivil- und Militärbehörden, Vorzeiger dieses
den Prokuristen bei der Deutschen Bank Hugo Nafz, der sich über die Österreichisch-Ungarische Monarchie, Rumänien und Bulgarien nach der Türkei begibt und von dort nach Deutschland zurückkehrt,
frei und ungehindert reisen, auch nötigenfalls ihm Schutz und Beistand angedeihen zu lassen.
Berlin, den 1. Juli 1915
Auswärtiges Amt
Im Auftrage
[gez.] Schmidt-Dargitz
Reisepaß gültig auf 3 Monate
[Stempel:] Nach Ablauf sofort zurück an Auswärtiges Amt Berlin
Dieser Paß wird mit einmonatiger Gültigkeit erneuert. Der Paßinhaber führt in Begleitung des Kassenboten Franz Kulbach im amtlichen Auftrag einen Goldtransport von 21 Kisten über die Österreichisch-Ungarische Monarchie nach Bukarest und kehrt sodann nach Deutschland zurück.
Berlin, den 3. März 1916
Auswärtiges Amt
Im Auftrag von
[gez.] Schmidt-Dargitz
[Rückseite]
Kennzeichnung des Paßinhabers:
Alter: 52 Jahre
Gestalt: untersetzt
Haar: blond
Augen: blau
Gesichtsform: rund
Besondere Kennzeichen: keine
Es wird hiermit bescheinigt, daß der Paßinhaber die durch nebenstehende Photographie dargestellte Person ist und die darunter befindliche Unterschrift eigenhändig vollzogen hat. Berlin, den 1. Juli 1915
Auswärtiges Amt
Im Auftrage
[gez]. Schmidt-Dargitz
Unterschrift des Paßinhabers:
[Gez.] Hugo Nafz
[Stempel:] Gesehen Berlin, den 2. Juli 1915. Der Kgl. Bulgarische Gesandte
[Stempel:] Gesehen bei d. k u. k. oesterr. ung. Botschaft Berlin, den 2. Juli 1915
[Stempel:] Vu à l’Ambassade Impériale Ottomane. Bon pour rendre en Turquie. Berlin le 2 Juillet 1915. Pour L’Ambassadeur Le Premier Secretaire
[Stempel:] Vǎzut la Legatiunea Regalǎ a Româmiei. Bon pentru mergere in România. Berlin 19 Junie/2 Julie 1915. Ministru
[Stempel:] No. 220 Gesehen auf der Kaiserlich Deutschen Botschaft. Gut zur Reise nach Deutschland. Constantinopel, den 16. Juli 1915
Kommentar
Seit 1888 war die Deutsche Bank stark im Osmanischen Reich engagiert. Mit dem damaligen Erwerb der Konzession für die Anatolische Eisenbahn, der anderthalb Jahrzehnte später die Konzession für die Bagdadbahn folgte, nahm die bedeutendste und berühmteste Auslandsinvestition der Bank vor dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang. Bis heute ist der Mythos dieser Bahnlinie, die Istanbul mit Bagdad und dem Persischen Golf verbinden sollte, lebendig. Zwei Jahrzehnte vertraten die beiden Eisenbahngesellschaften die Interessen der Deutschen Bank in der Region, bis sich die Leitung der Bank entschloss, 1909 eine eigene Filiale in Konstantinopel, wie Istanbul bis 1929 meist genannt wurde, zu eröffnen. Die Filiale hatte sich gerade etabliert, als ihr mit Beginn des Ersten Weltkriegs die Aufgabe zufiel, als Mittler zwischen Deutschland und der verbündeten Türkei zu dienen. Große Teile der deutschen Finanzhilfe wurden über die Niederlassung der Deutschen Bank geleitet. Die Filiale trat damit de facto an die Stelle der Ottoman Bank, die seit Jahrzehnten die Funktionen einer nicht existierenden türkischen Zentralbank ausgeübt hatte. Bei Kriegsbeginn war die Ottoman Bank zwischen die Fronten geraten, da ihre Direktion in Istanbul und ihre Aktionäre Anglo-Französisch, und damit Kriegsgegner des Osmanischen Reichs waren, während die Bank in Paris und London als osmanisches und damit als feindliches Unternehmen angesehen wurde. So kam es, dass die deutschen Hilfszahlungen für den Bündnispartner und die Finanzierung des Krieges von der bulgarischen Grenze bis zum Suez-Kanal zu weiten Teilen der Deutschen Bank übertragen wurden. Dazu war es erforderlich, dass die Konstantinopeler Filiale täglichen, ja oft stündlichen Kontakt mit der deutschen Botschaft und der deutschen Militärmission hielt. Für die letztere besorgte sie auch die gesamte Geldversorgung. Da die deutschen Hilfszahlungen in „klingender Münze“ oder in Form von Banknoten oder Wertpapieren erfolgten, waren mehrere Transporte auf dem Landweg von Berlin über Österreich-Ungarn, Bulgarien und Rumänien bis nach Istanbul notwendig. Drei dieser Transporte wurden 1915 und 1916 vom 52 jährigen Prokuristen der Berliner Zentrale der Deutschen Bank Hugo Nafz und wechselnden Kassenboten der Bank begleitet. Wie der vom Auswärtigen Amt ausgestellte Pass zeigt, führte ihn sein Weg über die preußische Grenzkontrollstelle Bodenbach südlich von Dresden nach Österreich-Ungarn. Von dort ging es über Prag, Wien und Budapest zur ungarisch-rumänischen Grenzstadt Predeal in Siebenbürgen. Die Weiterreise erfolgte über Bukarest und Sofia bis nach Istanbul. Den gleichen Weg nahm er während seiner zweiten Reise im März 1916, als er einen Transport von 138 Kisten Gold nach Istanbul begleitete. Lediglich bei seiner dritten Reise vom 21. November 1916 bis 1. Januar 1917, die dem Transport von Wertpapieren und Silber bestimmt war, reiste er mit dem Orient-Express über Wien und durch das von den Mittelmächten besetzte Serbien, da Rumänien zum Kriegsschauplatz geworden war. Die deutschen Hilfszahlungen konnten die militärische Niederlage des Osmanischen Reichs nicht verhindern. Am 30. Oktober 1918 wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Istanbul kam unter Verwaltung der Alliierten. Die dortige Filiale der Deutschen Bank musste schließen und konnte erst 1923 wiedereröffnet werden.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Manfred Pohl – Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn
Zeige Inhalt von 30.10.1915 - "Sie pferchten 880 Menschen in 10 Wagen"
 Foto schwarz-weiß auf Papier, 11,9 cm (breit) x 8,9 cm (hoch), links oben gelocht,
Foto schwarz-weiß auf Papier, 11,9 cm (breit) x 8,9 cm (hoch), links oben gelocht,
abgeheftet in einem Schnellhefter des Orientbüros der Deutschen Bank Zentrale Berlin mit dem Titel „Armenierfrage während des Krieges".
Heutige Signatur: HADB, Or1704, Anlage zu Bl. 50.
Kommentar
Am 30. Oktober 1915 schrieb der in Konstantinopel ansässige Direktor der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft Franz Günther an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Eisenbahn-Gesellschaft, Arthur von Gwinner, der zugleich Vorstandssprecher der Deutschen Bank in Berlin war:
"Sehr geehrter Herr von Gwinner! Einliegend sende ich Ihnen ein Bildchen, die Anatolische Bahn als Kulturträgerin in der Türkei darstellend.- Es sind das unsere sogenannten Hammelwagen, in denen beispielsweise 880 Menschen in 10 Wagen befördert werden.-" (HADB, Or1704, Bl. 50)
Das Bild zeigt drei Kleinviehwagen, die durch die Kennzeichnung mit dem Akronym „C.F.O.A.“ (Chemin de Fer Ottoman d’Anatolie) eindeutig der Anatolischen Eisenbahn zugeordnet werden können. Deutlich ist zu erkennen, dass auf den jeweils zwei Etagen und dem Dach der Wagen weit mehr als die 40 Personen eingepfercht waren, die die Wagenbeschriftung „40 HOMMES“ vorsah. Wann und wo die Aufnahme gemacht wurde, ist ebenso unbekannt wie ihr Fotograf.
Auch wenn anzunehmen ist, dass Günther den Urheber des Bildes kannte, verwundert es kaum, dass er es anonym weitergab, denn das Fotografieren von Armeniertransporten war unter Strafandrohung verboten. Nachdem türkische Militärs Kenntnis erhalten hatten, dass Ingenieure und Angestellte der Bagdadbahn Fotos von Armeniertransporten gemacht hatten, erließ der Militärbefehlshaber in Syrien, Djemal Pascha, den Befehl, dass diese Personen die Negative und alle Abzüge ihrer Aufnahmen innerhalb von 48 Stunden beim Militärkommissariat abzugeben hätten. Wer sich weigerte die Fotos herauszugeben, sollte genauso bestraft werden, als ob er Fotos von Kriegsschauplätzen gemacht hätte. (Militärkommissar an Bauabteilung III der Bagdadbahn 28.8./10.9.1915, PA-AA/BoKon/70) Die von Günther weitergeleitete Aufnahme hat daher großen Seltenheitswert.
Eine Vermutung, wo das Foto entstanden sein könnte, erlaubt ein weiterer Brief Günthers an Gwinner, der bereits am 14. Oktober 1915 nach Berlin gesandt worden war. Darin heißt es – nur um die Ortsangabe ergänzt – fast wortgleich mit seinem späteren Schreiben: "Von Alajund nach Konia - 369 km - verlud die Polizei Armenier in unseren sogenannten Hammelwagen; das sind gewöhnlich Güterwagen, die horizontal in der Mitte durch Latten geteilt sind.- Sie pferchten 880 Menschen in 10 Wagen, also pro Wagen 88 Köpfe.-"(HADB, Or1704, Bl.32f.) Alajund war eine kleine Bahnstation, 67 Kilometer südlich von Eskischehir, wo eine Stichbahn in die nahe gelegene Stadt Kutahia von der Hauptlinie nach Konia abzweigte. Laut eines Berichts eines ungenannten Reisenden, vermutlich ein Vertreter des für den Bahnbau zuständigen Unternehmens, vom Oktober 1915 befand sich in Alajund „ein Armenierlager von gewaltiger Ausdehnung, das sicher mehrere Tausend Menschen beherbergte“. Der gleiche Reisende beobachte in Eskischehir eine Szene, die stark an das hier beschriebene Foto erinnert: "Die Deportirten waren zum Teil in Kleinviehwagen (H[ammel] Wagen) in beiden Etagen untergebracht, die Dächer der Wagen waren ebenfalls mit Menschen bedeckt.“ (HADB, Or1704, Bl. 54-62) Günther sandte Gwinner diesen Bericht gemeinsam mit dem Foto. Eine weitere Kopie, allerdings ohne Foto, ging an den Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Konstantinopel, Konstantin von Neurath. (PA-AA/BoKon/97) Bei dem „zuverlässigen Herrn“, wie Günther in seinem Begleitschreiben den Autor der Niederschrift bezeichnete, handelte es sich möglicherweise zugleich um den Fotografen des beschriebenen Transports in den Hammelwagen. Die Ortsangaben die er und Günther im Zusammenhang der Armeniertransporte machten, legen die Vermutung nahe, dass das Foto in Eskischehir oder im nicht weit entfernten Bahnhof von Alajund aufgenommen wurde. War der unbekannte Berichtschreiber der Fotograf, dann muss die Aufnahme während seiner im Oktober 1915 in Konstantinopel endenden Reise aufgenommen worden sein, die ihn bis an den äußersten Punkt der Bahn nach Ras-el-Ain – auf halber Strecke zwischen Aleppo und Mosul – führte.
Der Brief von Günther an Gwinner vom 30. Oktober 1915 wurde erstmals zitiert in Gerald D. Feldman, Die Deutsche Bank vom Ersten Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise 1914-1933, in: Lothar Gall u.a., Die Deutsche Bank 1870-1995, München 1995, S.154. Das Foto wurde erstmals publiziert in Manfred Pohl, Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn, München 1999, S. 94.
Zeige Inhalt von 31.12.1915 - Die Mitropa - eine "friedliche Gründung" im Ersten Weltkrieg
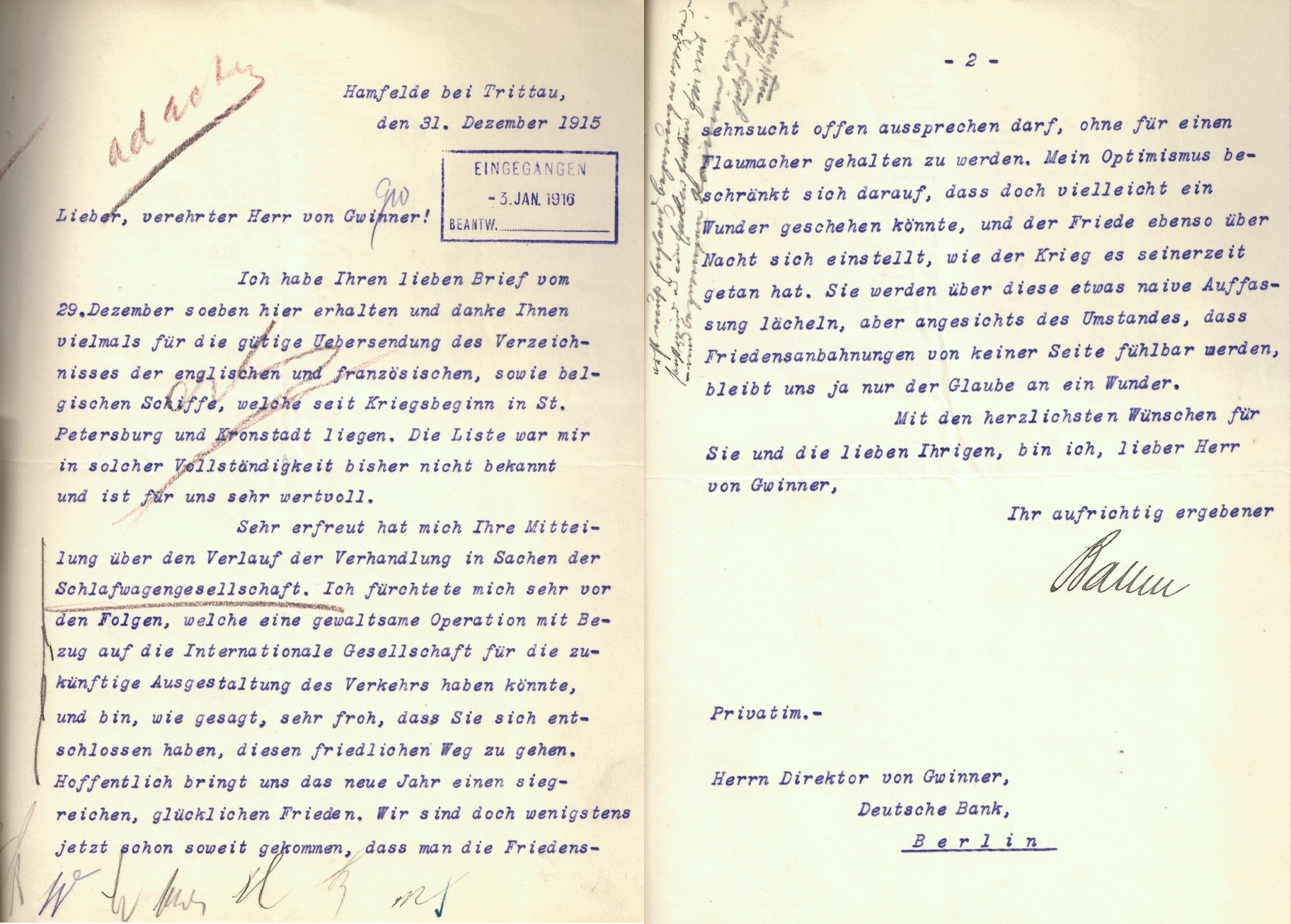 Hamfelde bei Trittau, den 31. Dezember 1915
Hamfelde bei Trittau, den 31. Dezember 1915
Lieber, verehrter Herr von Gwinner!
Ich habe Ihren lieben Brief vom 29. Dezember soeben hier erhalten und danke Ihnen vielmals für die gütige Uebersendung des Verzeichnisses der englischen und französischen, sowie belgischen Schiffe, welche seit Kriegsbeginn in St. Petersburg und Kronstadt liegen. Die Liste war mir in solcher Vollständigkeit bisher nicht bekannt und ist für uns sehr wertvoll.
Sehr erfreut hat mich Ihre Mitteilung über den Verlauf der Verhandlung in Sachen der Schlafwagengesellschaft. Ich fürchtete mich sehr vor den Folgen, welche eine gewaltsame Operation mit Bezug auf die Internationale Gesellschaft für die zukünftige Ausgestaltung des Verkehrs haben könnte, und bin, wie gesagt, sehr froh, dass Sie sich entschlossen haben, diesen friedlichen Weg zu gehen. Hoffentlich bringt und das neue Jahr einen siegreichen, glücklichen Frieden. Wir sind doch wenigstens jetzt schon soweit gekommen, dass man die Friedenssehnsucht offen aussprechen darf, ohne für einen Flaumacher gehalten zu werden. Mein Optimismus beschränkt sich darauf, dass doch vielleicht ein Wunder geschehen könnte, und der Friede ebenso über Nacht sich einstellt, wie der Krieg es seinerzeit getan hat. Sie werden über diese etwas naive Auffassung lächeln, aber angesichts des Umstandes, dass Friedensanbahnungen von keiner Seite fühlbar werden, bleibt uns ja nur der Glaube an ein Wunder.
Mit den herzlichsten Wünschen für Sie und die lieben Ihrigen, bin ich, lieber Herr von Gwinner,
Ihr aufrichtig ergebener
Ballin
Handschriftlicher Vermerk Arthur von Gwinner:
erst muß England bezwungen werden – sonst wird es ein fauler Frieden für uns – und bezwingen können wir es jetzt – später nicht mehr.
Kommentar
Am Silvestertag des zweiten Jahres des Ersten Weltkrieges schickte der Hamburger Reeder und Chef der Hapag Albert Ballin (1857–1918) dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank Arthur von Gwinner (1856–1931) einige nachdenkliche Zeilen. Darin dankte er Gwinner nicht nur für die wertvollen Informationen über die Schiffsbewegungen in russischen Ostseehäfen, er begrüßte auch die Fortschritte, die bei der geplanten Gründung einer neuen Schlafwagengesellschaft erzielt worden waren.
Tatsächlich dauerte es aber noch fast ein Jahr, bis am 24. November 1916 die erste Generalversammlung der Mitropa (Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft) in der Berliner Zentrale der Deutschen Bank stattfinden konnte. Das Gründungskonsortium wurde von der Bank angeführt und Gwinner übernahm den Vorsitz des Aufsichtsrates der Mitropa – ein Posten, den er zehn Jahre innehaben sollte. Neben weiteren Vertretern der Deutschen Bank war auch Ballin Mitglied dieses Gremiums.
Die Gründung der Mitropa mitten im Ersten Weltkrieg verfolgte das Ziel, die bisherige Dominanz der französisch-belgischen Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft (ISG) in Deutschland, Österreich und Ungarn zu beenden und durch ein deutsches Monopol zu ersetzen. Auch der Balkanzug von Berlin nach Konstantinopel, der die verbündeten Mittelmächte miteinander verband, wurde durch die neue Gesellschaft bewirtschaftet. Bereits wenige Monate nach ihrer Gründung kam es zu einer Kapitalaufstockung von 5 auf 20 Millionen Mark.
Albert Ballin hatte an eine gütliche Einigung zwischen den nun im Feindeslager stehenden einstigen Eigentümern der Internationalen Schlafwagengesellschaft die Hoffnung auf einen baldigen Friedensschluss geknüpft. Wie alle Unternehmer, die vor 1914 an den Weltmärkten tätig waren, konnte er den Weltkrieg trotz aller patriotischen Gefühle nur als Katastrophe empfinden. Ballin hatte zwar als einer der wenigen Vertreter der Wirtschaft direkten Zugang zu Kaiser Wilhelm II., auf die außenpolitischen Entscheidungen des Reiches vermochte er aber keinen Einfluss zu nehmen.
Als der ersehnte Frieden fast drei Jahre nach dem Verfassen des Briefes endlich kam, war es eine Niederlage, die Ballin als nationalen Untergang empfand. Am 9. November 1918 nahm er sich das Leben. Gwinner zog sich wenig später aus dem Vorstand der Deutschen Bank zurück.
Ihre Schöpfung, die Mitropa, blieb indessen über das Kriegsende hinaus bestehen und entwickelte sich zu einem etablierten Unternehmen, dessen Einzugsbereich sich allerdings auf Deutschland und Österreich beschränkte. Nach der Teilung Deutschlands 1945 wurde auch die Mitropa aufgespalten: Während der Betrieb in der DDR in den Zügen der Reichsbahn fortgeführt wurde, übernahm die Deutsche Schlaf- und Speisewagen-Gesellschaft (DSG) ab 1950 das Geschäft auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands fanden beide Unternehmen unter dem Namen „Mitropa“ noch einmal zusammen, doch der Verkauf an die Compass Group im Jahr 2004 markierte nach über 100 Jahren das endgültige Ende der Marke.
weiterführende Informationen
Zeige Inhalt von 30.10.1917 - Fusion von Philipp Holzmann mit der Internationalen Baugesellschaft
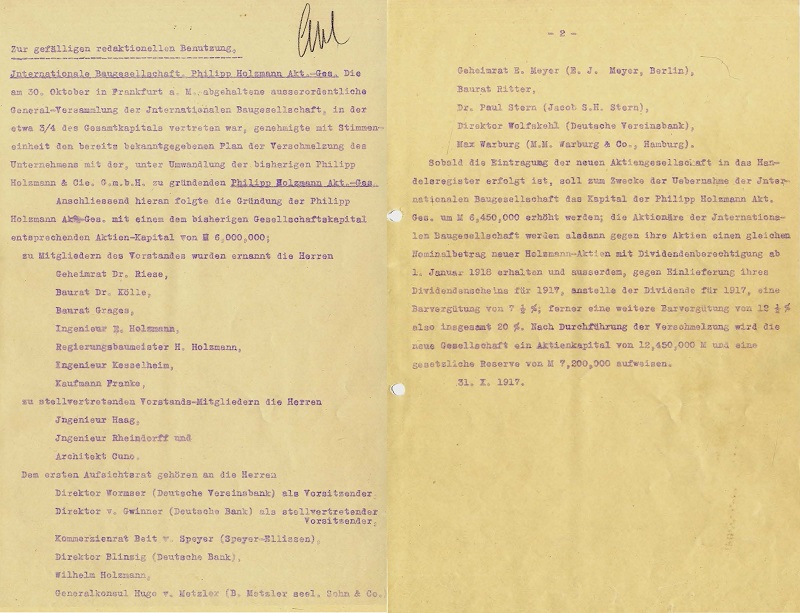 Zur gefälligen redaktionellen Benutzung
Zur gefälligen redaktionellen Benutzung
Internationale Baugesellschaft. Philipp Holzmann Akt.-Ges.
Die am 30. Oktober in Frankfurt a.M. abgehaltene ausserordentliche General-Versammlung der Internationalen Baugesellschaft, in der etwa ¾ des Gesamtkapitals vertreten war, genehmigte mit Stimmeneinheit den bereits bekanntgegebenen Plan der Verschmelzung des Unternehmens mit der, unter Umwandlung der bisherigen Philipp Holzmann & Cie. G.m.b.H. zur gründenden Philipp Holzmann Akt.-Ges.
Anschliessend hieran folgte die Gründung der Philipp Holzmann Akt.-Ges. mit einem dem bisherigen Gesellschaftskapital entsprechenden Aktien-Kapital von M 6,000,000;
zu Mitgliedern des Vorstandes wurden ernannt die Herren
Geheimrat Dr. Riese,
Baurat Dr. Kölle,
Baurat Grages,
Ingenieur E. Holzmann,
Regierungsbaumeister H. Holzmann,
Ingenieur Kesselheim,
Kaufmann Franke,
zu stellvertretenden Vorstands-Mitgliedern die Herren
Ingenieur Haag,
Ingenieur Rheindorff und
Architekt Cuno.
Dem ersten Aufsichtsrat gehören die Herren
Direktor Wormser (Deutsche Vereinsbank) als Vorsitzender
Direktor v. Gwinner (Deutsche Bank) als stellvertretender Vorsitzender,
Kommerzienrat Beit v. Speyer (Speyer-Ellissen),
Direktor Blinzig (Deutsche Bank),
Wilhelm Holzmann,
Generalkonsul Hugo v. Metzler (B. Metzler seel. Sohn & Co.),
Geheimrat E. Meyer (E.J. Meyer, Berlin),
Baurat Ritter,
Dr. Paul Stern (Jacob S.H. Stern),
Direktor Wolfskehl (Deutsche Vereinsbank),
Max Warburg (M.M. Warburg & Co., Hamburg.
Sobald die Eintragung der neuen Aktiengesellschaft in das Handelsregister erfolgt ist, soll zum Zwecke der Übernahme der Internationalen Baugesellschaft das Kapital der Philipp Holzmann Akt. Ges. um M 6,450,000 erhöht werden; die Aktionäre der Internationalen Baugesellschaft werden alsdann gegen ihre Aktien einen gleichen Nominalbetrag neuer Holzmann-Aktien mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 1918 erhalten und ausserdem, gegen Einlieferung ihres Dividendenscheins für 1917, anstelle der Dividende für 1917, eine Barvergütung von 7 ½ %, ferner eine weitere Barvergütung von 12 ½ % also insgesamt 20 %. Nach Durchführung der Verschmelzung wird die neue Gesellschaft ein Aktienkapital von 12,450,000 M und eine gesetzliche Reserve von M 7,2000,000 aufweisen.
31. X. 1917.
Kommentar
Der Beginn des Ersten Weltkrieges hatte bei der Deutschen Bank wichtige Geschäftsbereiche, wie die Finanzierung des Außenhandels, große Projektfinanzierungen und die Organisation des deutschen Kapitalexports, zum Erliegen gebracht. Neue Betätigungsfelder konnte sie nur im Inland erschließen. So hat die enge Begleitung von Firmenzusammenschlüssen seitens der Deutschen Bank in dieser Zeit ihren Ursprung. Ein erstes Beispiel war die Fusion des Bauunternehmens Philipp Holzmann mit der Internationalen Baugesellschaft im Jahr 1917, deren erfolgreiche Durchführung in einer Presseinformation vom 31. Oktober 1917 (Dokument) mitgeteilt wurde.
Seit 1873 war die Internationale Baugesellschaft AG (IB) die einzige Kommanditistin der Philipp Holzmann Cie. KG. Bei der Umwandlung in die Holzmann GmbH 1895 blieb die IB neben dem Firmenchef Philipp Holzmann (1836-1904) persönlich haftende Gesellschafterin. Holzmann suchte dringend Kapital und Bauland, die IB Unternehmer, denen sie beides zur Verfügung stellen konnte. Holzmann war seit Gründung (1849) stetig gewachsen und ins internationale Geschäft besonders durch die Unterstützung der an der IB beteiligten Banken eingetreten. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Arthur von Gwinner, war an der Anbahnung von Großprojekten im In- und Ausland maßgeblich beteiligt. Ausführendes Unternehmen bei fast allen Projekten war Holzmann.
Im Ersten Weltkrieg änderte sich das bisherige Verhältnis zwischen Holzmann und der IB nachhaltig – zuerst geschäftlich, dann rechtlich. Die IB, die vor allem Land und Immobilien besaß, war kaum noch profitabel, Holzmann, trotz des Verlusts seines Auslandsgeschäfts, erwirtschaftete Gewinne. Rufe wurden laut nach einer Veränderung des Verhältnisses der beiden Unternehmen zueinander. Die Deutsche Bank und eine weitere Konsortialbank der IB, M.M. Warburg Co. in Hamburg, plädierten für eine Fusion. Ein Hauptproblem war der bisherige Status der Unternehmen. Um die Fusion zu einer neuen Philipp Holzmann AG durchzuführen, mussten die Gründerrechte der IB-Aktionäre für die IB zurückerworben werden.
Die Rechtsabteilung der Deutschen Bank Berlin erarbeitete einen Fusionsplan. Holzmann wurde demnach in eine AG umgewandelt. Die Generalversammlungen beider Unternehmen stimmten der Fusion zu. Ein Syndikat, geführt von Deutscher Bank und Deutscher Vereinsbank übernahm zu pari die Anteile der IB an Holzmann, immerhin 4,75 Mio. Stück, die zum 162,5%-Preis weitervertrieben wurden. Das Syndikat zahlte 10% Dividende an die Aktionäre der IB für das Jahr 1917.
Am 30. Oktober 1917 wurde der Gesellschaftsvertrag geschlossen. Das Aktienkapital der neuen AG betrug 12,45 Mio. Mark, das etwa hälftig von den beiden Firmen beigesteuert wurde. Die neue Philipp Holzmann AG vergrößerte durch die Fusion ihren Grundbesitz von 171 auf 257 Hektar und erhielt wichtige Beteiligungen. Dennoch blieb das Geschäftsumfeld über den Ersten Weltkrieg hinaus schwierig – erst 1928 konnte das Geschäftsvolumen den Vorkriegsstand wieder erreichen.
Die Fusion war wesentlich auf die Initiative von Deutsche Bank-Vorstandssprecher Arthur von Gwinner zurückzuführen. In der Folge wurde er zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Philipp Holzmann AG. Bis zur Liquidation des Unternehmens 2002 war die Deutsche Bank eng mit Holzmann verbunden – allein Hermann J. Abs hatte 30 Jahre den Aufsichtsratsvorsitz inne.
Zeige Inhalt von März 1918 - "Zeichnet die 8. Kriegsanleihe!"
 Werbepostkarte der Deutschen Bank Filiale Frankfurt am Main, ca. März 1918
Werbepostkarte der Deutschen Bank Filiale Frankfurt am Main, ca. März 1918
Hier zeichnet man Kriegsanleihe - Zeichnet die 8. Kriegsanleihe! [Vorderseite]
Auch brieflich können Sie Ihre Zeichnungsanmeldung bei der
Deutschen Bank Frankfurt a. M. einreichen oder erhöhen [Rückseite]
Kommentar
Für den Ausgang des Ersten Weltkriegs war seine Finanzierung mitentscheidend. Die Kriegsgegner wählten dafür verschiedene Formen. Während Großbritannien die Steuern anhob und so die staatlichen Einnahmen beträchtlich steigerte, wählte das Deutsche Reich den Weg der Finanzierung über Kredite und öffentliche Anleihen. Eine zügige Beschaffung der Mittel schien so garantiert, zumal allgemein an einen raschen und erfolgreichen Kriegsverlauf geglaubt wurde. Die Rückzahlung der Schulden sollte dann den besiegten Staaten auferlegt werden.
Aus dem Krieg von mehreren Monaten wurde ein Krieg von mehreren Jahren, dessen Finanzierung die Emission immer neuer Kriegsanleihen erforderte. Nach fast vier erschöpfenden Kriegsjahren und sieben Anleihen, schien im Frühjahr 1918 die Niederlage Russlands auch im Westen einen deutschen Sieg möglich zu machen. Eine gewaltige Schlussoffensive, so hoffte man, könnte nun den Durchbruch erzwingen und den Krieg letztlich doch noch zu deutschen Gunsten entscheiden. Eine achte Kriegsanleihe sollte eine ähnliche Durchschlagskraft wie die militärische Offensive entfalten. Entsprechend wurde die Anleihe von einer groß angelegten Werbekampagne begleitet.
Auch die Deutsche Bank warb im letzten Kriegsjahr um Käufer der achten Kriegsanleihe. „Zeichnet die 8. Kriegsanleihe!“ fordert obenstehende Werbung von 1918. Das Plakat lässt keinen Zweifel daran, wo Kriegsanleihen erworben werden sollen. „Hier!“ – am Kaiserplatz, in der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank – „zeichnet man Kriegsanleihe.“ Dabei richtet sich die Anzeige an ein breites Publikum; alle Volksschichten strömen dem Eingang des Bankhauses entgegen. Schon 1914 hatte Karl Helfferich, kurz bevor er von der Deutschen Bank ins Reichsschatzamt wechseln und die Organisation der Kriegsfinanzierung übernehmen sollte, betont, dass das erfolgreiche Ergebnis der ersten Kriegsanleihe nicht auf eine kleine Schicht von wohlhabenden Investoren, sondern auf die Gesamtheit des Volkes zurückzuführen sei. Diese Aussage wird bestätigt, wirft man einen Blick auf die Zeichnungslisten der achten Kriegsanleihe der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank. Neben lokalen Unternehmungen wie der Cassella und Voigt & Haeffner, die jeweils Kriegsanleihen im Wert von 1 Mio. RM erwarben, gab es auch zahlreiche Zeichnungen in einem deutlich überschaubareren Rahmen, bis hin zu einem Nennwert von lediglich 100 Mark. Mit Anleihen im Wert von 300.000 Mark zeichnete Mathilde von Marx, Witwe des jüdischen Bankiers Ludwig Ritter von Marx, den höchsten Betrag einer Privatperson. Geradezu bescheiden wirken da die 40.000 Mark Schatzanleihen, welche der Baronin Lily Schey von Koromla zuzuordnen sind. Auch sie entstammte als Enkelin des letzten „Frankfurter Rothschilds“ einer angesehenen Bankiersfamilie und machte sich in Frankfurt vor allem als Mäzenin einen Namen. Größere Beträge entfallen desweiteren auf Industrielle wie den Frankfurter Karrosseriebauer Georg Kruck oder den Schraubenfabrikanten Max Weise aus dem schwäbischen Kirchheim unter Teck. Auch gut situierte Frankfurter wie der Chirurg Rudolf Oehler, im Frühjahr 1918 „gar noch im Felde stehend“, oder der Schriftsteller Friedrich Carl Butz finden sich auf den Frankfurter Listen. Die ehemaligen Direktoren der Frankfurter Filiale, Hermann Maier und Julius Scharff, konnten hier selbstverständlich nicht zurückstehen. Pflichtbewusst erwarben auch sie Anleihen im mittleren fünfstelligen Bereich und trugen dazu bei, dass die achte Kriegsanleihe mit 15 Milliarden Mark dem Reich den höchsten Erlös aller Anleihe-Emissionen während des Weltkriegs einbringen sollte.
Der Brutto-Anstieg der Anleihe-Erlöse während des Ersten Weltkriegs ist jedoch vor dem Hintergrund eines stetigen Kaufkraftverlusts der Mark zu betrachten, so dass die achte Kriegsanleihe, entgegen der öffentlichen Verlautbarungen, eher einer seit März 1917 rückläufigeren Tendenz der Anleihe-Erlöse entsprach. Diese Entwicklung fand ihren Schlusspunkt in der neunten Kriegsanleihe, die, zwei Monate vor Kriegsende aufgelegt, nur wenig Zuspruch in der Bevölkerung finden und mit 2,7 Mio. Subskriptionen noch nicht einmal die Hälfte des Wertes vom März 1917 erreichen konnte. Die fast 100 Milliarden Mark, die die Kriegsanleihen für das Reich an Einnahmen erbracht hatten, wurden in den ersten Nachkriegsjahren ein Opfer der Hyperinflation, durch die sich der Staat auf Kosten der Anleger entschuldete.
weitere Informationen
Zeige Inhalt von 01.12.1919 - "Den übertragenen Posten nach besten Kräften wahrnehmen" - Büro-Ordnung der Deutschen Bank Filiale Aachen
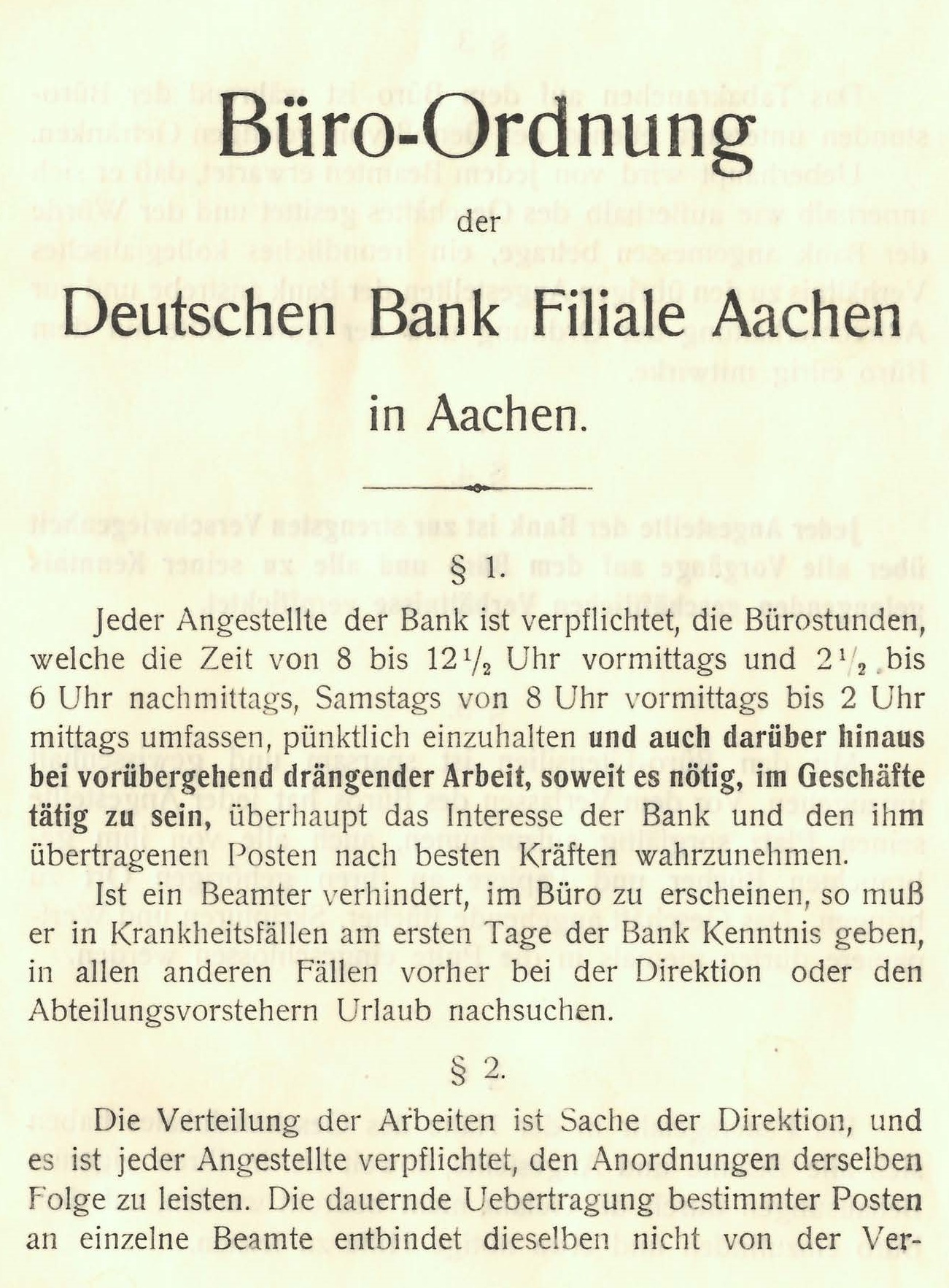 Büro-Ordnung
Büro-Ordnung
der Deutschen Bank Filiale Aachen
in Aachen.
§ 1.
Jeder Angestellte der Bank ist verpflichtet, die Bürostunden, welche die Zeit von 8 bis 12 1/2 Uhr vormittags und 2 1/2 bis 6 Uhr nachmittags, Samstags von 8 Uhr vormittags bis 2 Uhr mittags umfassen, pünktlich einzuhalten und auch darüber hinaus bei vorübergehend drängender Arbeit, soweit es nötig, im Geschäfte tätig zu sein, überhaupt das Interesse der Bank und den ihm übertragenen Posten nach besten Kräften wahrzunehmen. Ist ein Beamter verhindert, im Büro zu erscheinen, so muß er in Krankheitsfällen am ersten Tage der Bank Kenntnis geben, in allen anderen Fällen vorher bei der Direktion oder den Abteilungsvorstehern Urlaub nachsuchen.
§ 2.
Die Verteilung der Arbeiten ist Sache der Direktion, und
es ist jeder Angestellte verpflichtet, den Anordnungen derselben
Folge zu leisten. Die dauernde Uebertragung bestimmter Posten
an einzelne Beamte entbindet dieselben nicht von der Verpflichtung,
auch jedem außerhalb ihres Spezialpostens liegenden
geschäftlichen Auftrage eines Vorgesetzten pünktlich nachzukommen.
Sollte die Direktion für gut finden, einzelnen Beamten ein
größeres Arbeitsgebiet zu überweisen (als Bürochefs, Kontrolleure
etc.), so haben die übrigen Beamten den Anordnungen derselben
innerhalb der Schranken der denselben gegebenen Vollmacht
folge zu leisten.
§ 3.
Das Tabakrauchen auf dem Büro ist während der Bürostunden
untersagt, ebenso der Genuß von geistigen Getränken.
Ueberhaupt wird von jedem Beamten erwartet, daß er sich
innerhalb wie außerhalb des Geschäftes gesittet und der Würde
der Bank angemessen betrage, ein freundliches kollegialisches
Verhältnis zu den übrigen Angestellten der Bank anstrebe und zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und der guten Sitte auf dem
Büro eifrig mitwirke.
§ 4.
Jeder Angestellte der Bank ist zur strengsten Verschwiegenheit
über alle Vorgänge auf dem Büro und alle zu seiner Kenntnis
gelangenden geschäftlichen Verhältnisse verpflichtet.
§ 5.
Mit den Büro-Utensilien ist sparsam und gewissenhaft
umzugehen. Vor dem Verlassen des Büros hat jeder Angestellte
seinen Platz sorgfältig aufzuräumen, auch alle von ihm gebrauchten
Bücher und . Papiere an ihren gehörigen Ort zu
bringen. Das Geschäft angehende Bücher, Skripturen und Wertpapiere
dürfen niemals in die Pulte eingeschlossen werden.
§ 6.
Bei Feuersgefahr in der Nähe des Geschäftslokales haben
sich alle Beamte und Angestellte, soweit sie in ihren eigenen
Behausungen durch die Gefahr nicht bedroht werden, auf dem
Büro einzufinden und etwa nötige Hilfe zu leisten.
§ 7.
Die Ehre der Verwaltung verbietet dem Angestellten, bei
Geschäften der Bank von dritten Personen Vorteile für sich zu
bedingen oder anzunehmen.
§ 8.
Ohne Vorwissen und schriftliche für jeden einzelnen fall
zu erteilende Genehmigung der Direktion darf kein Angestellter
irgend ein Nebengeschäft betreiben oder sich bei der Verwaltung
irgend einer anderen Korporation oder Gesellschaft
beteiligen.
§ 9.
Bei Geld- und Fonds-Umsätzen, welche ein Angestellter
zu machen beabsichtigt, soll er sich nur der Deutschen Bank
Filiale Aachen bedienen dürfen. Zu Effekten-Geschäften unter
Vorschuß der Bank ist die Genehmigung der Direktion erforderlich.
Der Vorschuß der Bank darf niemals den Betrag
von 50 % des Kurswertes der deponierten Effekten übersteigen.
§ 10.
Abhebungen von Konten der Beamten bedürfen der vorherigen
Genehmigung der Direktion, soweit die Konten kein
Guthaben aufweisen.
Die Auszahlung der Gehälter erfolgt am Schluß jeden
Monats postnumerando. Gehaltsvorschüsse werden in der Regel
nicht gegeben.
§ 11.
Jeder Angestellte hat dem Sekretariat seine Wohnung nach
Straße und Nummer anzugeben und dort auch jeden Wohnungswechsel
anzuzeigen.
§ 12.
Grobe Verletzungen der vorstehenden Vorschriften und
ganz besonders Zuwiderhandlungen gegen die §§ 4, 7 und 9
berechtigen die Direktion zur sofortigen Entlassung des
Schuldigen.
§ 13.
Jeder Angestellte hat sein Einverständnis mit dieser Büroordnung
durch seine Unterschrift zu bezeugen.
Aachen, den 1. Dezember 1919.
Die Direktion der Deutschen Bank Filiale Aachen.
Unterschrift des Beamten laut § 13:
[Unterschrift]
Kommentar
Die Mitarbeiterzahl der Deutschen Bank hatte sich seit ihrer Gründung 1870 bis zum Ersten Weltkrieg stetig nach oben entwickelt. Insbesondere nach der Übernahme großer Regionalbanken an Rhein und Ruhr (1914), in Schlesien und Ostpreußen (1917) war sie dann aber innerhalb weniger Jahre auf mehr als das Doppelte angestiegen. Im Jahr 1919 arbeiteten 13.529 Angestellte für die Deutsche Bank. Aus diesem Jahr hat sich aus der Filiale Aachen eine der ersten Büro-Ordnungen für die Deutsche Bank erhalten. Die Filiale Aachen gehörte zu den Niederlassungen, die erst 1914 durch die Fusion mit der Bergisch Märkischen Bank zum Filialnetz der Deutschen Bank hinzugekommen waren. Offenbar verlangten die mittlerweile rund 100 Filialen (1913: 13 Filialen) eine einheitlichere Organisation, die nun auch schriftlich fixiert wurde. Jedenfalls sind vergleichbare Büro-Ordnungen aus früherer Zeit bei der Deutschen Bank nicht bekannt. Die Büro-Ordnung der Filiale Aachen regelte das Verhalten ‚auf dem Büro‘ präzise: Die Anweisungen zielten auf die Minimierung von Geschäfts- bzw. Rechtsrisiken und die Effizienzsteigerung bei der Büroarbeit. Zur Risikominimierung gehörte die Verschwiegenheit und Unbestechlichkeit, sowie die obligatorische Einholung einer Genehmigung der Direktion für alle Wertpapiergeschäfte. Besonders solche, bei denen die Bank einen Vorschuss von mehr als 50% des Kurswertes des Papiers leisten sollte, waren untersagt. Außerdem bestand ein Verbot von Nebenbeschäftigungen oder der ‚Verwaltung irgend einer anderen […] Gesellschaft‘ zur Vermeidung von Interessenskonflikten. § 12 berechtigte die Direktion besonders bei Zuwiderhandlungen gegen diese wichtigsten Gebote zur ‚sofortigen Entlassung des Schuldigen‘. Der Paragraph zur Verschwiegenheit wurde fett gesetzt, als Zeichen seiner herausragenden Bedeutung. Das richtige Verhalten zur Effizienzsteigerung war das zweite große Thema. Besonders wichtig war die in fette Lettern gesetzte Pflicht zu Überstunden bei ‚vorübergehender drängender Arbeit‘ und ‚das Interesse der Bank […] nach besten Kräften‘ zu befördern. Die ‚sparsame und gewissenhafte‘ Verwendung der Büro-Utensilien sowie das Aufräumen aller Unterlagen nach der Arbeit waren ebenso von hoher Bedeutung. Rauchen und alkoholische Getränke waren verboten. Der ‚Beamte‘ sollte sich stets ‚gesittet und der Würde der Bank angemessen‘ benehmen. Die Büro-Ordnungen waren für den einzelnen Angestellten bzw. Beamten bestimmt. Alle neuen Mitarbeiter erhielten eine Büro-Ordnung, deren Kenntnis sie per Unterschrift bestätigen mussten. Die moderne Compliance bzw. Corporate Governance und die alte Büro-Ordnung haben die gleichen Ziele: Viele der Prinzipien sind zeitlos, so etwa das ‚clean desk‘-Prinzip oder die Verschwiegenheitsverpflichtung, Unbestechlichkeit und das Verbot der Nebenbeschäftigung. Trotz dieser Konstanten deutet die Ordnung noch auf ein anderes Selbstverständnis und Verhältnis der Angestellten hin. So verbot ‚die Ehre der Verwaltung‘ den ‚Beamten […] Vorteile für sich zu bedingen oder anzunehmen‘. Ebenfalls aus dem Rahmen fiel die Pflicht zur Hilfe bei Bränden nahe des Bankgebäudes, soweit die Angestellten ‚in ihren eigenen Behausungen durch die Gefahr nicht bedroht werden‘. Sie zeigt die umfassende Verbindung der Angestellten zur Bank, denn Aachen besaß zu diesem Zeitpunkt schon eine freiwillige sowie eine Berufsfeuerwehr.
weiterführende Informationen
Zeige Inhalt von August 1921 - Werbetafel in der U-Bahn: Wie die Deutsche Bank Berlin mobil machte
 Werbetafel U-Bahnstation Wittenbergplatz, August 1921
Werbetafel U-Bahnstation Wittenbergplatz, August 1921
Deutsche Bank
Eigenes Vermögen Ende 1917
Mark 505 Millionen
Die Deutsche Bank hat i.J. 1897 im Verein mit Siemens & Halske AG
die Hoch- u. Untergrundbahn begründet
Kommentar
Das Foto aus dem Sommer 1921 dokumentiert eine der ältesten Werbetafeln der Deutschen Bank im öffentlichen Raum. Sie wurde bereits 1918 in der U-Bahnstation Wittenbergplatz angebracht, um an den Bau der ersten U-Bahnlinie vom Potsdamer Platz zum Zoologischen Garten zu erinnern, den die Deutsche Bank gemeinsam mit Siemens & Halske durchgeführt hatte. Noch heute ist der Ort nahezu unverändert.
Mit dem Bau der U-Bahn realisierten die Deutsche Bank und der Technikkonzern Siemens & Halske das größte Berliner Verkehrs-und Infrastrukturprojekt vor dem Ersten Weltkrieg. Der offiziellen Eröffnung der Berliner Hoch-und Untergrundbahn am 18. Februar 1902 ging eine lange Vorgeschichte voraus, die mit dem visionären Ziel des Erfinderunternehmers Werner von Siemens‘ begann, eine Hochbahn im Zentrum von Berlin nach New Yorker Vorbild zu errichten. Berlin war innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einer pulsierenden Metropole herangewachsen, die sich aufgrund des Zustroms nun mit großen Verkehrsproblemen konfrontiert sah. 1877 lebten in der Stadt eine Million Menschen und die Anzahl derer, die alljährlich mit der Pferdestraßenbahn befördert wurden, stieg von 1,5 Millionen am Anfang der 1870er Jahre auf 65 Millionen bis im Jahr 1882 an. Werner von Siemens erkannte, dass elektrische Hoch-und Untergrundbahnen hinsichtlich Kapazität und Geschwindigkeit gegenüber der Pferdestraßenbahn wesentliche Vorteile mit sich brachten. Weil Anwohner der Friedrichsstraße monierten, dass die Hochbahn direkt an ihren Wohnungen vorbeifahren würde, wurde das Projekt zunächst nicht weiter verfolgt. 1897 wurde ein erneuter Vorstoß gewagt. Unter ihrem Vorstandssprecher Georg von Siemens, ein Neffe Werner von Siemens‘, gründete die Deutsche Bank gemeinsam mit Siemens & Halske die „Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin“, die sogleich mit dem Bau begann. Anfang 1902 war es schließlich soweit und die erste Hochbahnstrecke vom Stralauer Tor über Gleisdreieck bis zum Potsdamer Platz wurde offiziell eröffnet. Noch im selben Jahr erweiterte sich das Schienennetz mit der Verlängerungsstrecke vom Zoologischen Garten bis zum Knie (heute Ernst-Reuter-Platz) auf 11,2 Kilometer. Somit war Berlin die fünfte U-Bahn-Stadt nach London, Budapest, Glasgow und Paris.
Die Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bank und Siemens & Halske bei der Realisierung dieses Bauprojekts katapultierte Berlin verkehrstechnisch in das 20. Jahrhundert. Ab 1928 wurde die Berliner Hoch- und Untergrundbahn unter städtischer Regie fortgeführt. Im Jahr 2017 beförderten die Berliner Verkehrsbetriebe 1,064 Milliarden Fahrgäste. Sie unterhalten hinsichtlich Streckenlänge und Anzahl der Stationen das größte U-Bahn-Netz im deutschsprachigen Raum.
weiterführende Informationen
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Zeige Inhalt von 05.09.1926 - Fritz Langs „Metropolis“ und die Deutsche Bank
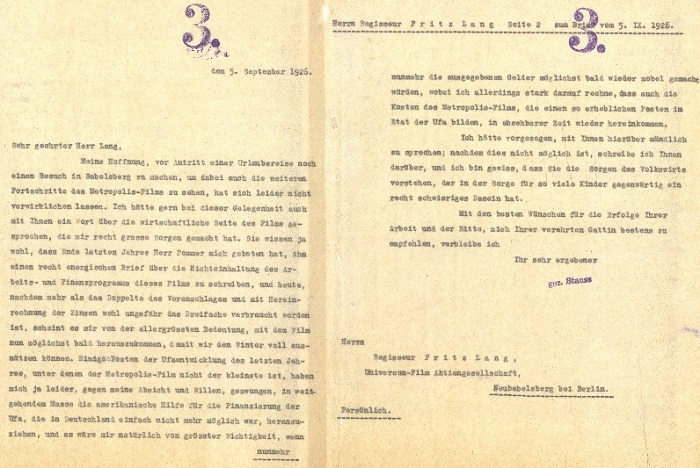 Herrn
Herrn
Regisseur Fritz Lang
Universum-Film Aktiengesellschaft
Neubabelsberg bei Berlin
-Persönlich-
den 5. September 1926.
Sehr geehrter Herr Lang,
Meine Hoffnung, vor Antritt einer Urlaubsreise noch einen Besuch in Babelsberg zu machen, um dabei auch die weiteren Fortschritte des Metropolis-Films zu sehen, hat sich leider nicht verwirklichen lassen. Ich hätte gern bei dieser Gelegenheit auch mit Ihnen ein Wort über die wirtschaftliche Seite des Films gesprochen, die mir recht grosse Sorgen gemacht hat. Sie wissen ja wohl, dass Ende letzten Jahres Herr Pommer mich gebeten hat, ihm einen recht energischen Brief über die Nichteinhaltung des Arbeits- und Finanzprogramms dieses Films zu schreiben, und heute, nachdem mehr als das Doppelte des Voranschlages und mit Hereinrechnung der Zinsen wohl ungefähr das Dreifache verbraucht worden ist, scheint es mir von der allergrössten Bedeutung, mit dem Film nun möglichst bald herauszukommen, damit wir den Winter voll ausnützen können. Einige Posten der Ufaentwicklung des letzten Jahres, unter denen der Metropolis-Film nicht der kleinste ist, haben mich ja leider, gegen meine Absicht und Willen, gezwungen, in weitgehendem Masse die amerikanische Hilfe für die Finanzierung der Ufa, die in Deutschland einfach nicht möglich war, heranzuziehen, und es wäre mir natürlich von grösster Wichtigkeit, wenn nunmehr die ausgegebenen Gelder möglichst bald wieder mob[i]l gemacht würden, wobei ich allerdings stark darauf rechne, dass auch die Kosten des Metropolis-Films, die einen so erheblichen Posten im Etat der Ufa bilden, in absehbarer Zeit wieder hereinkommen.
Mit den besten Wünschen für die Erfolge Ihrer Arbeit und der Bitte, mich Ihrer verehrten Gattin bestens zu empfehlen, verbleibe ich
Ihr sehr ergebener
Stauss
Kommentar
Der Film "Metropolis" aus dem Jahre 1926 stellt einen Meilenstein der Filmgeschichte dar. Zu seinem wohl berühmtesten Werk war der Regisseur Fritz Lang bei einer USA-Reise angeregt worden. Bei der Einfahrt in den New Yorker Hafen hinterließen die aus dem Meer empor steigenden Wolkenkratzer einen solch starken Eindruck, dass er eine utopische Hochhauskulisse in den Mittelpunkt seiner Vision des Klassenkampfs im 21. Jahrhundert stellte. Nicht nur wegen seiner gewaltigen Kulissen, der neuartigen Trickfilmaufnahmen, der großen Zahl an Statisten und des futuristischen Szenarios war „Metropolis“ bemerkenswert. Der Film sprengte auch in finanzieller Hinsicht alle bisherigen Dimensionen seiner Produktionsgesellschaft, der Universum-Film Aktiengesellschaft (Ufa), an der die Deutsche Bank nicht nur in beträchtlichem Maße beteiligt war, sondern mit Emil Georg von Stauß auch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats stellte. Um das finanzielle Debakel der Ufa in Grenzen zu halten, sollten die Produktionskosten gesenkt und die Budgetüberschreitungen gestoppt werden. Der unangefochtene Spitzenreiter bei der Überziehung aller Etatansätze war der Perfektionist Fritz Lang, der bei den Dreharbeiten immer neue kostspielige Superlative realisieren wollte. Auch dem Produzenten Erich Pommer gelang es nicht, die Ausgaben für „Metropolis“ einzudämmen, weshalb er Stauß um Unterstützung bat. Dieser drängte den Regisseur im Dezember 1925, den Aufwand für die Studiobauten zu reduzieren oder gar Filmszenen zu streichen. Lang zeigt sich von dieser Ermahnung jedoch unbeeindruckt. Erst als im September 1926 – nach 16 Produktionsmonaten – der Film noch immer nicht abgeschlossen war, forderte Stauß in dem oben wiedergegebenen Schreiben unmissverständlich die baldmöglichste Fertigstellung. Inzwischen waren die Produktionskosten auf das Dreifache der Kalkulation angestiegen, und die Ufa hatte einen Kredit in den USA aufnehmen müssen, um liquide zu bleiben. Langs Selbstbewusstsein war aber ebenso gewachsen wie die Kosten seines Films. In seinem Antwortbrief ließ er Stauß wissen, dass „Metropolis“ in allerkürzester Zeit ganz fertig sei, und er sicher sei, „dass die Ufa mit diesem Film nicht nur höchste Ehre in der ganzen Welt einlegen, sondern auch das darin investierte Kapital mit Zinsen und Zinseszinsen zurückgewinnen wird.“ Zwar sollte Lang mit seiner künstlerischen Einschätzung Recht behalten, in finanzieller Hinsicht war allerdings die Skepsis des Bankiers realistischer als der Optimismus des Filmemachers. Die 5,3 Millionen Reichsmark, die der Film schließlich gekostet hatte, konnte er nicht wieder einspielen, und der dadurch erzielte Verlust war mitentscheidend, dass sich die Deutsche Bank 1927 von ihrer Beteiligung an der Ufa zurückzog.
weiterführende Informationen
Vortragsveranstaltung 2017 "Geld und Film – Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren"
Zeige Inhalt von 1927 - "Der moderne Bankbetrieb" (ältester Werbefilm einer deutschen Großbank)
Werbefilm der Disconto-Gesellschaft
Produktionsjahr 1927
Länge 518 Meter (ca. 20 Minuten)
Kommentar
Bei dem Stummfilm handelt es sich um den ältesten Werbefilm einer deutschen Großbank. Produziert hat ihn die Disconto-Gesellschaft in Berlin im Jahr 1927. Damals stand die Disconto-Gesellschaft in scharfer Konkurrenz zur Deutschen Bank. Im Oktober 1929 fusionierten die beiden Banken jedoch zu einem gemeinsamen Institut.
Gedreht wurde der Film, bis auf die Schlusssequenz, in der Hauptverwaltung der Disconto-Gesellschaft Unter den Linden, die sich über die Charlottenstraße bis zur Behrenstraße ausdehnte. Das Gebäude wurde nach dem Zusammenschluss an das Deutsche Reich verkauft. Nach der Wiedervereinigung erwarb es die Deutsche Bank. Aufwendig restauriert nutzt sie es seit 1997 als Hauptstadtrepräsentanz.
Der Film beginnt mit Straßenszenen, die das ganze Ausmaß des Gebäudekomplexes erkennen lassen. Nach einem Blick in die Kassenhalle und die Stahlkammer wird der Zuschauer bald in die Backoffice-Bereiche geführt. Im Mittelpunkt des Films steht die Darstellung moderner Technik, deren Einsatz ein Zwischentitel in die damals wie heute mehrdeutigen Worte fasst: "Die Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit ab". Die soziale Seite eines Großbankbetriebs wird in der abschließenden Sequenz 'Nach Geschäftsschluss' ins Bild gerückt, die die Aktivitäten der Gesang- und Sportvereinigung zeigt.
Produktionsnotizen, die Auskunft über Regisseur oder Kameramann geben würden, haben sich nicht erhalten. Auch in zwei zeitgenössischen Rezensionen des Films – eine wohlwollende in der Mitarbeiterzeitschrift der Disconto-Gesellschaft "Die Großbank im Film" und eine kritische in der Zeitschrift Bankwissenschaft "Filmpropaganda im Bankgewerbe" – finden sich dazu keine Angaben. Während die Besprechung in der Hauszeitung den innovativen Ansatz des Films und die bemerkenswerte Verwendung von Tricktechnik lobte, bezweifelte die Rezension in der Bankwissenschaft, dass anhand der gezeigten Szenen die schon damals existierende Furcht der Angestellten vor den Folgen der Automatisierung ausgeräumt werden könne. Bemerkenswert ist, dass man schon damals den dokumentarischen Wert des Films erkannte: "Schon in wenigen Jahren dürfte er als ein historisches Dokument über das Aussehen eines Großbankbetriebs im Jahre 1927 gelten und auch dann von größtem Interesse sein, genauso, wie es interessant sein würde, einen Filmbericht aus dem Jahre 1900 über die damalige Erledigungsweise der Geschäftsvorgänge zu besitzen."
Anlässlich der Veranstaltung "Die wilden Zwanziger" der Historischen Gesellschaft wurde im Oktober 2023 eine auf rund zehn Minuten gekürzte Fassung des Films gezeigt und mit einer eigens dafür geschaffenen Klavierbegleitung der Pianistin Christina Becht untermalt.
Zeige Inhalt von 18.07.1931 - Auf dem Weg zum Mond: Die Deutsche Bank und die Anfänge des Raketenpioniers Wernher von Braun
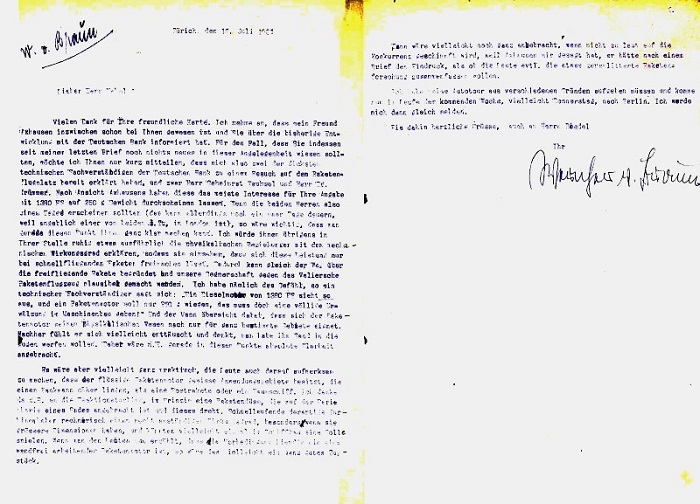 Zürich, den 18. Juli 1931
Zürich, den 18. Juli 1931
Lieber Herr Nebel,
Vielen Dank für Ihre freundliche Karte. Ich nehme an, dass mein Freund Axhausen inzwischen schon bei Ihnen gewesen ist und Sie über die bisherige Entwicklung mit der Deutschen Bank informiert hat. Für den Fall, dass Sie indessen seit meinem letzten Brief noch nichts neues in dieser Angelegenheit wissen sollten, möchte ich Ihnen nur kurz mitteilen, dass sich also zwei der dicksten technischen Sachverständigen der Deutschen Bank zu einem Besuch auf dem Raketenflugplatz bereit erklärt haben, und zwar Herr Geheimrat Fauhsel und Herr Dr. Krümmer. Nach Ansicht Axhausens haben diese das meiste Interesse für Ihre Angabe mit 1380 PS auf 250 g Gewicht durchscheinen lassen. Wenn die beiden Herren also eines Tages erscheinen sollten (das kann allerdings noch ein paar Tage dauern, weil angeblich einer von beiden z. Zt. in London ist), so wäre wichtig, dass man gerade diesen Punkt ihnen ganz klar machen kann. Ich würde ihnen übrigens in Ihrer Stelle ruhig etwas ausführlich die physikalischen Beziehungen mit dem mechanischen Wirkungsgrad erklären, sodass sie einsehen, dass sich diese Leistung nur bei schnellfliegenden Raketen freimachen lässt. Dadurch kann gleich der Weg über die freifliegende Rakete begründet und unsere Gegnerschaft gegen das Valiersche Raketenflugzeug plausibel gemacht werden. Ich habe nämlich das Gefühl, so ein technischer Sachverständiger sagt sich: ”Ein Dieselmotor von 1380 PS sieht so aus, und ein Raketenmotor soll nur 250 g wiegen, das muss doch eine völlige Umwälzung im Maschinenbau geben!” Und der Mann übersieht dabei, dass sich der Raketenmotor seinem physikalischen Wesen nach nur für ganz bestimmte Gebiete eignet. Nachher fühlt er sich vielleicht enttäuscht und denkt, man habe ihm Sand in die Augen werfen wollen. Daher wäre m.E. gerade in diesem Punkte absolute Klarheit angebracht. Es wäre aber vielleicht ganz praktisch, die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass der flüssige Raketenmotor gewisse Anwendungsgebiete besitzt, die einem Bankmann näher liegen, als eine Postrakete oder ein Raumschiff. Ich denke da z.B. an die Reaktionsturbine, im Prinzip eine Raketendüse, die auf der Peripherie eines Rades angebracht ist und dieses dreht. Schnellaufende derartige Turbinen haben rechnerisch einen recht anständigen Wirkungsgrad, besonders wenn sie grössere Dimensionen haben, und könnten vielleicht einmal im Schiffbau eine Rolle spielen. Wenn man den Leuten nun erzählt, dass die Vorbedingung hierfür ein einwandfrei arbeitender Raketenmotor ist, so wäre das vielleicht ein ganz gutes Zugstück. Dann wäre vielleicht noch ganz angebracht, wenn nicht zu laut auf die Konkurrenz geschimpft wird, weil Axhausen mir gesagt hat, er hätte nach einem Brief den Eindruck, als ob die Leute evtl. die etwas zersplitterte Raketenforschung zusammenfassen wollen. Ich habe meine Autotour aus verschiedenen Gründen aufgeben müssen und komme nun im Laufe der kommenden Woche, vielleicht Donnerstag, nach Berlin. Ich werde mich dann gleich melden.
Bis dahin herzliche Grüsse, auch an Herrn Riedel
Ihr
Wernher v. Braun.
Kommentar
Das Interesse der Deutschen Bank an moderner Forschung und neuen Technologien war von jeher groß. Vor allem auch in der Zwischenkriegszeit war die Bank auf diesem Gebiet sehr aktiv. So war sie beispielsweise maßgeblich an der Gründung der Universum Film AG (UFA) beteiligt, die rasch zu einer der weltgrößten Filmgesellschaften avancierte und Meisterwerke wie die Nibelungen und Metropolis produzierte. 1926 beteiligte sich die Bank außerdem an der Gründung der Deutschen Lufthansa sowie an der Fusion der Daimler Motoren-Gesellschaft und der Benz & Cie. zur Daimler-Benz AG. Motoren in der Luft und auf dem Boden beflügelten die Phantasie der Bankiers. Auch mit der modernsten Motorentechnik der damaligen Zeit, dem Raketenantrieb, kam die Deutsche Bank schon früh in Berührung. Dabei galt ihr Interesse vor allem der Nutzbarkeit und Vermarktung von Innovationen und modernen Technologien. Wie aus dem oben wiedergegebenen Dokument hervorgeht, suchte kein Geringerer als Wernher von Braun, der bekannte Raumfahrtpionier, Raketentechniker und Vater der Saturn V, als 19-Jähriger 1931 den Kontakt zur Deutschen Bank, um sie als Finanzier für seine Forschungen und Experimente zu gewinnen. Kontaktmann war Bruno Axhausen, ein Mann aus der mittleren Führungsebene der Bank, der dem Auslandssekretariat der Berliner Zentrale vorstand, und dessen Sohn ein Kommilitone von Brauns war. Aus weiteren Briefen zwischen von Braun und seinen Mitstreitern ist erkennbar, dass zwar ein Besuch von Sachverständigen der Bank auf dem Raketenflugplatz stattgefunden hat, ob letztlich die gewünschten Geldmittel geflossen sind, lässt sich jedoch nicht mehr feststellen, es ist aber eher unwahrscheinlich. Aus Sicht der Geldgeber besaß diese neue Technologie noch keine Marktreife. Bei der Vorführung auf dem Raketenflugplatz bekamen die Vertreter der Bank nur Fehlversuche zu sehen. Trotzdem machte von Braun eine steile Karriere. Sein Name ist unauslöschlich mit der Raumfahrt verbunden. Er zählt neben Hermann Oberth, Robert H. Goddard, Konstantin Tsiolkovski und Johannes Winkler zu den fünf wichtigsten Pionieren auf dem Forschungsgebiet der Raketentechnik. Schon als Jugendlicher hatte er ein intensives Interesse an explosiven Stoffen und Feuerwerkskörpern entwickelt und mit Raketen und diversen anderen Flugkörpern experimentiert. Im Sommer 1930 ging er als Student an die Technische Hochschule Berlin. In dieser Zeit lernte er auch Rudolf Nebel, an den der hier wiedergegebene Brief gerichtet ist, und Hermann Oberth kennen; letzterem assistierte er während seines Studiums bei Versuchen mit Flüssigkeitsraketen. Beide trafen sich außerdem regelmäßig mit Rudolf Nebel und Klaus Riedel auf dem ”Raketenflugplatz Berlin”, wo ihnen der Start kleinerer Flüssigkeitsraketen gelang. Bereits 1932 trennten sich jedoch von Brauns und Nebels Wege. Während Nebel seine Experimente auf dem Berliner Raketenflugplatz fortsetzte, ging von Braun zur vom Militär betriebenen Raketenversuchsstelle im brandenburgischen Kummersdorf. Von 1937 bis 1945 war von Braun dann technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom. Hier leitete er die Entwicklung des Aggregats A4, einer Rakete mit Flüssigtreibstoff. Am 3. Oktober 1942 glückte der Start der neuen A4-Rakete; erstmals gelang es, eine Rakete ins All zu schießen. Seit Ende 1943 wurde die A4-Rakete massenhaft in unterirdischen Fabrikhallen für den Kriegseinsatz produziert, wofür auch Tausende von Zwangsarbeitern eingesetzt wurden. Im September 1944 wurde begonnen, die A4-Rakete, die nun die Bezeichnung ”Vergeltungswaffe” V2 erhielt, auf Paris, London, Antwerpen und andere Ziele abzuschießen. Nach der deutschen Kapitulation stellte sich von Braun den Amerikanern. Bereits im September 1945 konnte der Raketentechniker, der als unbelastet eingestuft wurde, seine Forschungen in den USA fortsetzen. 1955 nahm Wernher von Braun die amerikanische Staatsbürgerschaft an und stieg 1960 zum Direktor des Marshall Space Flight Center der NASA auf. Dort entwickelte er die leistungsstärkste Rakete, die bisher gebaut wurde, die Saturn V, die Trägerrakete für die erste bemannte Mondlandung (Apollo 11-Mission) im Jahr 1969.
Zeige Inhalt von August 1936 - Der dreifache Olympiasieger Jesse Owens in der Deutschen Bank
Jesse Owens 100 + 200 meters broad jump U.S.A.
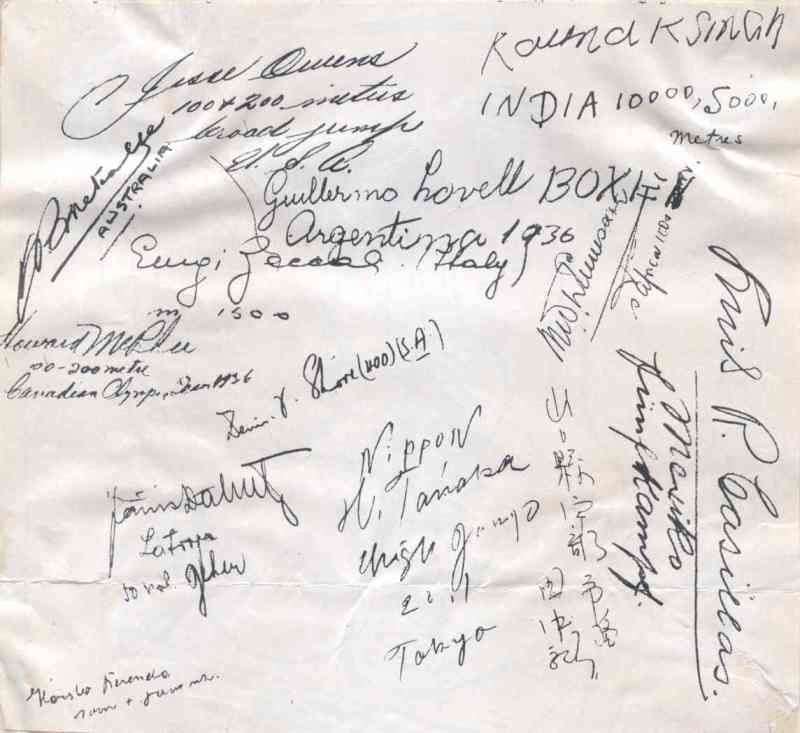
Kommentar
Vom 1. bis 16. August 1936 fanden in Berlin die XI. Olympischen Sommerspiele statt. Ein Großereignis, das wie kein zweites der Selbstdarstellung des nationalsozialistischen Deutschlands diente. Den Sportlern und Zuschauern aus aller Welt sollte das Bild eines vortrefflich organisierten, wohlhabenden, gastfreundlichen und friedlichen Landes vermittelt werden. In die Logistik der Spiele wurde auch die Deutsche Bank einbezogen. Schon Wochen vor den Spielen verwandelte sich an jedem Nachmittag um 16 Uhr der große Kassensaal der Stadtzentrale in der Berliner Mauerstraße in eine Vorverkaufsstelle für Eintrittskarten. An 23 Schaltern konnten die in langen Schlangen Wartenden Karten für alle Disziplinen erwerben. An einigen Tagen wurden über 8000 Sportinteressierte durch die Angestellten der Deutschen Bank bedient. Ausdrücklich unterstützt für ihren Einsatz in Sachen Olympia wurde die Belegschaft vom Personaldezernenten der Bank, Karl Ritter von Halt. Der frühere Zehnkampf-Meister und Mitorganisator der Winterspiele im gleichen Jahr rief den Angestellten zu: "Ist es nicht herrlich, dass auch unser Institut mitarbeiten darf am Erfolg der Spiele? Unsere Arbeitskameraden stehen Tag für Tag am Schalter im Dienste der Olympischen Spiele und erfüllen freudigen Herzens die ihnen gestellte Aufgabe." Nicht nur in der Mitte Berlins stellte sich die Bank in den Dienst der Spiele auch unmittelbar beim Olympiastadion und im Olympischen Dorf bei Döberitz, westlich von Berlin, war sie mit Zahlstellen vertreten, um "dem ausländischen Besucher jede nur denkbare Bequemlichkeit zu bieten". In der Zahlstelle des Olympischen Dorfes besorgten die Sportler ihre Post und lösten ihre Reiseschecks und Kreditbriefe ein. Die Verständigung mit den Aktiven aus aller Welt bereitete keine Schwierigkeiten, da die sechs in der Zahlstelle tätigen Angestellten die englische, französische, dänische, holländische, bulgarische, spanische, portugiesische und italienische Sprache beherrschten. Der höchste Andrang herrschte, als die südamerikanischen und letzten europäischen Mannschaften kurz vor der Eröffnung der Spiele eintrafen. Je nach Bedarf wurden dann die Kassenstunden bis 21 und gar 23 Uhr ausgedehnt. Bis zum Ende der Wettkämpfe hatten fast alle Sportgrößen den Schalterraum der Deutschen Bank besucht. Viele der Athleten, deren Namen in aller Munde war, wurden von den Bankmitarbeitern um Autogramme gebeten, die sie in ein reich illustriertes Gästebuch einfügten. Der Name eines Sportlers, der sich dort eintrug, ist bis heute weltweit bekannt. Mit drei Olympiasiegen über die beiden Sprintstrecken und im Weitsprung war er der überragende Wettkämpfer der Berliner Spiele. "Jesse Owens 100 + 200 meters broad jump U.S.A." ist in schwungvollen Buchstaben am oberen Rand eines Zettels zu lesen, auf dem auch noch viele weitere Sportler signiert haben, wie z. B. der Argentinier Guillermo Lovell (Gewinner der Silbermedaille im Schwergewichtsboxen), der Australier John Patrick Metcalfe (Gewinner der Bronzemedaille im Dreisprung), der Kanadier Howard McPhee (Teilnehmer am Sprint über 100 und 200 Meter), der Japaner Noboru Tanaka (Teilnehmer im Hochsprung), der Lette Janis Dalinsch (Teilnehmer bei 50 Kilometer Gehen) und der Mexikaner Luis R. Casillas (Teilnehmer am Modernen Fünfkampf). Lediglich die Namen weiblicher Olympiateilnehmer vermisst man unter den gesammelten Autographen. Der Grund dafür ist einfach: Die Sportlerinnen waren nicht im Olympischen Dorf untergebracht und hatten dort auch keinen Zutritt. Die Unterkunft der Frauen befand sich im sogenannten Friesenhaus unweit des Olympiastadions.
Zeige Inhalt von 09.02.1943 - Der Filmstar Lilian Harvey und die Deutsche Bank
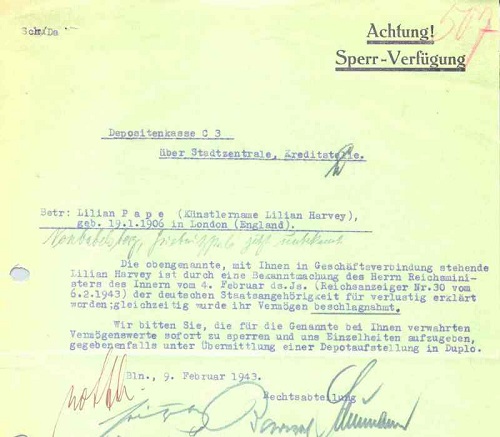 Achtung!
Achtung!
Sperr-Verfügung
Depositenkasse C 3 über Stadtzentrale, Kreditstelle
Betr: Lilian Pape (Künstername Lilian Harvey), geb. 19.1.1906 in London (England).
Neubabelsberg, Griebnitzstr. 6, jetzt unbekannt
Die oben genannte, mit Ihnen in Geschäftsverbindung stehende Lilian Harvey ist durch eine Bekanntmachung des Herrn Reichsministers des Innern vom 4. Februar ds. Js. (Reichsanzeiger Nr. 30 vom 6.2.1943) der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden; gleichzeitig wurde ihr Vermögen beschlagnahmt.
Wir bitten Sie, die für die Genannte bei Ihnen verwahrten Vermögenswerte sofort zu sperren und uns Einzelheiten aufzugeben, gegebenenfalls unter Übermittlung einer Depotaufstellung in Duplo.
Berlin, 9. Februar 1943
Rechtsabteilung
Kommentar
Am 6. Februar 1943 wurde im Deutschen Reichsanzeiger eine Namensliste veröffentlicht. Allen auf dieser Liste genannten Personen wurde die deutsche Staatsangehörigkeit abgesprochen und ihr Vermögen beschlagnahmt. Fast alle, die auf diese Weise ausgebürgert wurden und ihres Vermögens verlustig gingen, waren unbekannte jüdische Frauen und Männer. Ein Name auf der Liste passte jedoch nicht in diese Gruppe: „Lilian Pape (Künstlername Lilian Harvey)“. Keine zehn Jahre zuvor war Lilian Harvey der Star des deutschen Kinos. Ihre Rollen an der Seite von Willy Fritsch in die „Drei von der Tankstelle“ (1930) und „Der Kongress tanzt“ (1931) sind bis heute unvergessen. Jetzt wurde sie der „Volks- und Staatsfeindlichkeit“ beschuldigt. Sie habe sich „in gehässiger Weise über die Führung des deutschen Reiches und das Deutsche Volk geäußert“ und sich stets als Engländerin ausgegeben. Die Vermögensbeschlagnahme wirkte sich unmittelbar auf Lilian Harveys Kontoverbindungen zur Deutschen Bank aus. Ihre Konten, die sie bei der Depositenkasse C3 (Zweigstelle) am Kurfürstendamm 92 in Berlin unterhielt, wurden sogleich gesperrt und unter die Aufsicht der zuständigen staatlichen Behörden gestellt. Mit dem im Anhang abgebildeten Dokument wies die Rechtsabteilung der Deutschen Bank die zuständige Zweigstelle an, die Konten zu sperren und Mitteilung über die verwahrten Vermögenswerte zu machen. Zu einem späteren Zeitpunkt mussten die vorhandenen Guthaben an das Deutsche Reich abgeführt werden. Die Beziehung der Deutschen Bank zu Lilian Harvey, die 1943 als willkürlicher Verwaltungsakt des NS-Regimes endete, hatte dabei unter wesentlich glücklicheren Vorzeichen begonnen. 1906 als Lilian Pape in London geboren, wuchs sie in einer deutsch-englischen Familie auf. Ihr Vater, der aus Magdeburg stammende Bankkaufmann Walter Pape, ließ sich nach seiner Heirat mit einer Engländerin in London nieder und stand dort lange Jahre in Diensten der Deutsche Bank London Agency. Ein Kollege dieser Zeit erinnerte sich später: „Das Konto-Korrentbuch führte der Kollege Walter Pape, genannt Pepi, ein lieber netter Kerl, klein aber hübsch und sehr musikalisch. Er ist der Vater unserer so beliebten Filmgröße Lilian Harvey, die von ihm in erster Linie ihr Talent geerbt haben dürfte.“ Zu Beginn des Ersten Weltkriegs hielt sich die Familie Pape zu Besuch in Magdeburg auf und konnte wegen des Kriegsbeginns nicht nach London zurückkehren. Sie nahm ihren Wohnsitz in Berlin, wo Lilian 1923 das Abitur ablegte. Bereits im folgenden Jahr spielte sie ihre ersten Filmrollen und bald danach war sie in Hauptrollen zu sehen. In dieser Zeit nahm sie den Mädchennamen ihrer Großmutter an und nannte sich Lilian Harvey. Nach ihrem Wechsel zu Deutschlands größter Filmgesellschaft, der Ufa, avancierte sie in kürzester Zeit zum beliebtesten Filmstar des Landes. Die in den Filmen gesungenen Lieder „Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen“ und „Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder“ wurden zu bekannten Schlagern. 1932 unterzeichnete sie einen Vertrag bei der 20th Century Fox und ging nach Hollywood. Bereits 1935 war sie zurück in Deutschland, wo inzwischen die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren. In mehreren Filmen konnte sie an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Doch trotz ihres Starruhms blieb ihr Verhältnis zum „Dritten Reich“ distanziert. 1939 emigrierte Lilian Harvey nach Frankreich. Wegen der drohenden Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen floh sie in die USA, wo sie sich in Hollywood niederließ. Sie drehte keine Filme mehr, wurde jedoch eine gefragte Bühnenschauspielerin. Nach Kriegsende kehrte sie nach Südfrankreich zurück, wo sie 1968 starb. Als Wiedergutmachung für ihr beschlagnahmtes Vermögen erhielt sie 1957 von der Bundesrepublik Deutschland eine lebenslange Rente.
weiterführende Informationen
Harold James – Die Deutsche Bank im Dritten Reich
Harold James – Die Deutsche Bank und die Arisierung
Vortragsveranstaltung 2017 "Geld und Film – Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren"
Zeige Inhalt von 05.11.1957 - Der Kanzler und sein Bankier - Konrad Adenauer und Hermann J. Abs
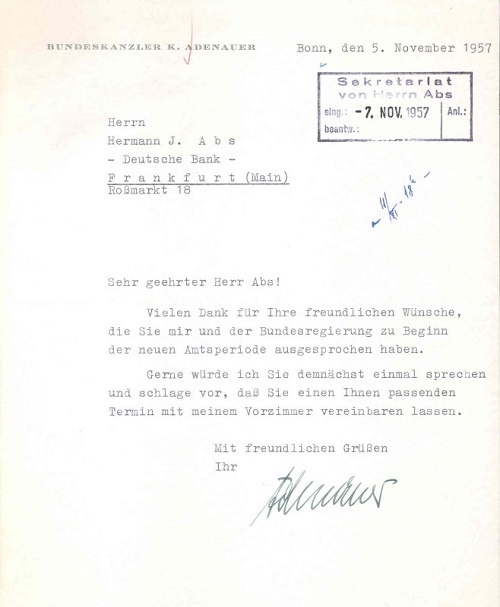 Bundeskanzler K. Adenauer
Bundeskanzler K. Adenauer
Bonn, den 5. November 1957
Herrn
Hermann J. Abs
Frankfurt (Main)
Roßmarkt 18
Sehr geehrter Herr Abs!
Vielen Dank für Ihre freundlichen Wünsche, die Sie mir und der Bundesregierung zu Beginn der neuen Amtsperiode ausgesprochen haben.
Gerne würde ich Sie demnächst einmal sprechen und schlage vor, daß Sie einen Ihnen passenden Termin mit meinem Vorzimmer vereinbaren lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
gez. Adenauer
Kommentar
Die Führungsrolle im deutschen Kreditwesen, die die Deutsche Bank schon bald nach ihrer Gründung einnahm, brachte die Männer an ihrer Spitze gewissermaßen automatisch in Kontakt mit den ersten Politikern des Landes. So versicherte sich der erste Vorstandssprecher Georg von Siemens der diplomatischen Unterstützung Bismarcks, bevor er sich in das Abenteuer des Eisenbahnbaus im Osmanischen Reich stürzte. Zwischen Alfred Herrhausen und Helmut Kohl bestand sogar eine Freundschaft, die im vertrauten „Du“ gepflegt wurde. Betrachtet man jedoch den politischen Einfluss, den ein Vorstandssprecher der Deutschen Bank bei einem deutschen Regierungschef auszuüben in der Lage war, so hatte zweifellos der Rat von Hermann J. Abs bei Konrad Adenauer das größte Gewicht. Die Lebenswege des Politikers, dessen Karriere 1933 bereits beendet schien, und des 25 Jahre jüngeren Bankiers kreuzten sich erstmals unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als beide in den Aufsichtsrat der RWE berufen waren. Während Adenauer aber rasch zur politischen Integrationsfigur der neu gegründeten CDU wurde und deren Fraktionsvorsitz im nordrhein-westfälischen Landtag übernahm, war Abs in den ersten Nachkriegsjahren weitgehend zur Untätigkeit verurteilt. Erst 1948 – die Entnazifizierung war inzwischen mit seiner Entlastung abgeschlossen und die Einbeziehung Westdeutschlands in das europäische Wiederaufbauprogramm beschlossen – übernahm Abs mit der Leitung der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine der Schlüsselfunktionen des wirtschaftlichen Neubeginns in den drei westlichen Besatzungszonen. Seit dieser Zeit gehörte er zu den engsten Finanz- und Wirtschaftsberatern des Mannes, der im September 1949 zum ersten Bundeskanzler gewählt wurde. Als bald darauf die Regelung der deutschen Auslandsschulden auf der Tagesordnung stand, berief Adenauer Hermann J. Abs zum Chefunterhändler der deutschen Delegation. Die langwierigen und komplizierten Verhandlungen mit den internationalen Gläubigern wurden zu seinem politischen Glanzstück, gelang es doch mit dem Londoner Schuldenabkommen von 1953, die Kreditwürdigkeit Westdeutschlands im Ausland wieder herzustellen. Spätestens seit den Verhandlungen über die Auslandsschulden gehörte Abs zum engeren Kreis des Bonner Machtzentrums. Er war nicht nur im Kanzleramt regelmäßiger Gast, auch bei Kabinettssitzungen war sein fachkundiger Rat mehrfach gefragt. 1952 wollte ihn Adenauer sogar zum Außenminister machen. Als Adenauer aber sowohl im Kanzleramt als auch in der CDU-Fraktion auf Widerstand stieß, blieb er weiter Kanzler und Außenminister in Personalunion. Dem Vertrauensverhältnis Adenauers zu Abs tat dieser Rückzieher keinen Abbruch. Durch ihre rheinische Herkunft verbunden, blieben sie auch in den folgenden Jahren ein kongeniales Gespann: Adenauer, der das Staatsschiff noch bis 1963 lenkte, und sein Berater Abs, der 1952 zu „seiner“ Deutschen Bank zurückkehrte und trotz aller Nähe zur politischen Macht stets seine Unabhängigkeit bewahrte. Dass Adenauer auch nach seinem größten Wahlerfolg, der mit absoluter Mehrheit gewonnenen Bundestagswahl von 1957, den Rat von Abs suchte, lässt der hier wiedergegebene Brief erkennen.
weiterführende Informationen
Lothar Gall – Der Bankier Hermann Josef Abs. Eine Biographie
Zeige Inhalt von 25.01.1973 - Literaturgeschichte im Koffer
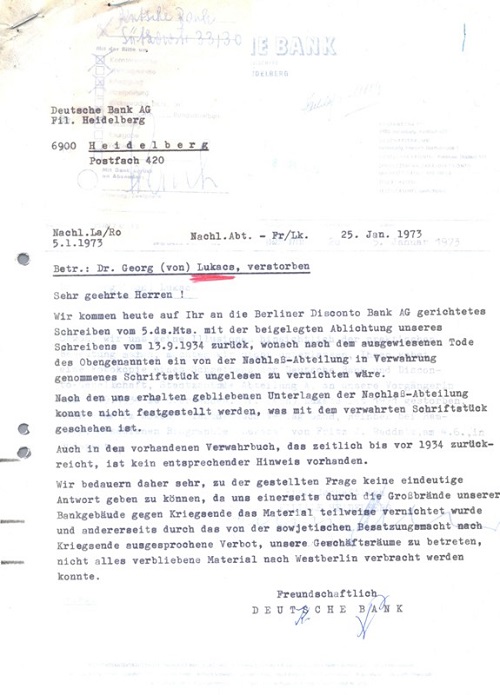 Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Fil. Heidelberg
6900 H e i d e l b e r g
Postfach 420
Nachl. La/Ro
Nachl. Abt. – Fr/Lk. 25.Jan. 5.1.1973
5.1.1973
Betr. Dr. Georg (von) Lukacs, verstorben
Sehr geehrte Herren !
Wir kommen heute auf Ihr an die Berliner Disconto Bank AG gerichtetes Schreiben vom 5.ds.Mts. mit der beigelegten Ablichtung unseres Schreibens vom 13.09.1934 zurück, wonach nach dem ausgewiesenen Tode des Obengenannten ein von der Nachlaß-Abteilung in Verwahrung genommenes Schriftstück ungelesen zu vernichten wäre.
Nach den uns erhalten gebliebenen Unterlagen der Nachlaß-Abteilung konnte nicht festgestellt werden, was mit dem verwahrten Schriftstück geschehen ist.
Auch in dem vorhandenen Verwahrbuch, das zeitlich bis vor 1934 zurückreicht, ist kein entsprechender Hinweis vorhanden.
Wir bedauern daher sehr, zu der gestellten Frage keine eindeutige Antwort geben zu können, da uns einerseits durch die Großbrände unserer Bankgebäude gegen Kriegsende das Material teilweise vernichtet wurde und andererseits durch das von der sowjetischen Besatzungsmacht nach Kriegsende ausgesprochene Verbot, unsere Geschäftsräume zu betreten, nicht alles verbliebene Material nach Westberlin verbracht werden konnte.
Freundschaftlich
Deutsche Bank
Kommentar
Mit der Korrespondenz zwischen der Deutschen Bank in Berlin und Heidelberg aus dem Jahr 1973 endete die Nachlassverwaltung eines Verwahrstück, das der Heidelberger Niederlassung bereits 1917 von einem Dr. von Lukács anvertraut worden war. Der Inhalt des Koffers, der 56 Jahre in den Tresoren der Bank geschlummert hatte, sollte bald Literaturgeschichte schreiben. Aus einer ungarischen Adelsfamilie stammend wandte sich Georg Lukács (1885–1971) durch die Ereignisse des 1. Weltkrieges beeinflusst dem Marxismus zu. Als Teil dieses von Lukács als Selbstfindung aufgefassten Prozesses deponierte er bei Kriegsende einen Koffer in der Deutschen Bank Filiale Heidelberg, der sein in den Jahren von 1910–1911 geschriebenes Tagebuch, neben anderen unveröffentlichten Aufzeichnungen und Manuskripten enthielt. Außerdem strich er das „von“ als Namensbestandteil, um so seinen Bruch mit der eigenen Vergangenheit deutlich zu machen. Die folgenden Jahre waren durch seinen Einsatz für die kommunistische Partei Ungarns geprägt. So stieg Lukács rasch zum stellvertretenden Volkskommissar für Bildung auf, als sich 1919 in Ungarn kurzzeitig eine kommunistische Räterepublik etablierte. In dieser Zeit entstand auch sein wohl einflussreichstes Werk, die 1923 erschienene Monographie ‚Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische Dialektik’, welches in den 1960er Jahren von der Studentenbewegung aufgegriffen wurde. In den dreißiger Jahren in die Sowjetunion emigriert entging Lukács nur knapp den stalinistischen Säuberungswellen. Erst 1944 kehrte er nach Ungarn zurück, wo in der Zwischenzeit durch die Rote Armee eine kommunistische Regierung installiert worden war. Er geriet jedoch schon bald in Konflikt mit der Regierung. Als 1956 die Bevölkerung in Budapest Reformen und einen Abzug der Roten Armee forderte, schloss er sich den Protesten an und war bis zur Niederschlagung des Ungarn-Aufstands Bildungsminister der neuen Regierung. Nach dem Scheitern des Aufstandes verlor er sein Amt und lebte – bis zu seinem Tod 1971 – in Budapest in Isolation, da er sich weder politisch betätigen konnte, noch seine Werke veröffentlicht werden durften. Zwei Jahre nach dem Tod des Philosophen stieß ein Angestellter der Heidelberger Filiale der Deutschen Bank zufällig auf dessen Hinterlassenschaft. Der Angestellte, der sich für Philosophie interessierte und gerade eine Biographie über Lukács gelesen hatte, informierte seinen Vorgesetzten, dass der Besitzer des seit über einem halben Jahrhundert in der Bankfiliale aufbewahrten Koffers nun endlich gefunden sei. Die Deutsche Bank erkundigte sich beim Rowohlt-Verlag, in welchem die Biographie Lukács erschienen war, über den Fund und bat, den rechtmäßigen Erben zu benennen, damit diesem der Koffer zugestellt werden könne. Über den Umweg der in London lebenden Schwester Lukács, Maria Popper, gelangte der Inhalt des Koffers schließlich zu ihrem Neffen Jánnosy, der in Ungarn das Lukács-Archiv leitete. Zu dessen Überraschung erschien in einer Berliner Tageszeitung ein Raubdruck eines Aufsatzes von Lukács. Wer den Aufsatz der Zeitung zugespielt hatte, blieb unbekannt, obwohl viele Mutmaßungen angestellt wurden. So vermutete „Der Spiegel“ in seiner Ausgabe von Ende August 1973, dass der Lukács-Herausgeber Benseler, der sich mit Erlaubnis von Jánnosy mehrere Aufsätze und Disputationen fotokopiert hatte, einen Aufsatz unter der Hand weitergegeben habe, um zu „verhindern, dass die Koffer-Manuskripte unveröffentlicht nun statt in der Heidelberger Bankfiliale im Budapester Archiv für ein weiteres halbes Jahrhundert verschwinden.“ Dies geschah – zum Glück für die Literaturwissenschaft – nicht, denn der Inhalt des im Jahr 1973 in einer Filiale der Deutschen Bank aufgefundenen Koffers wurde in den folgenden Jahren als ein wesentlicher Teil des Frühwerks von Lukács veröffentlicht.
weiterführende Informationen
Veranstaltung 2011 "Geist und Geld - Ein literarisch-musikalischer Streifzug"
Zeige Inhalt von 27.09.1978 - Jimmy Carters Kugelschreiber und der International Banking Act
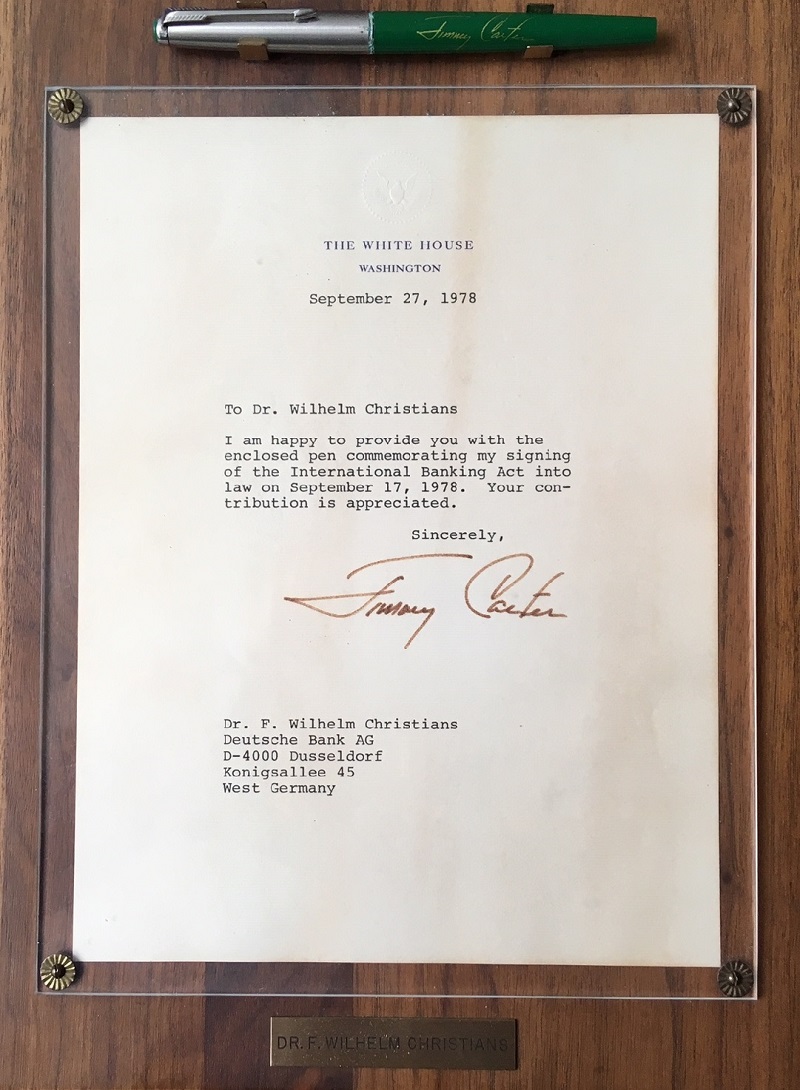 THE WHITE HOUSE
THE WHITE HOUSE
WASHINGTON
September 27, 1978
Dr. F. Wilhelm Christians
Deutsche Bank AG
D-4000 Dusseldorf
Konigsallee 45
West Germany
To Dr. Wilhelm Christians
I am happy to provide you with the enclosed pen commemorating my signing of the International Banking Act into law on September 17, 1978. Your contribution is appreciated.
Sincerely,
Jimmy Carter
Kommentar
Mit einem persönlich gezeichneten Schreiben dankte Jimmy Carter (*1924), der 39. Präsident der Vereinigten Staaten (1977 bis 1981), dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank, F. Wilhelm Christians (1922-2004), für sein Mitwirken an der Gesetzwerdung des International Banking Act von 1978. In seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken hatte sich Christians im Jahr zuvor in Washington mit wesentlichen Beteiligten der Bankenreform ausgetauscht. Dem auf einem massiven Holzblock angebrachten Dokument wurde ein Kugelschreiber mit dem handschriftlichen Namenszug Jimmy Carters beigefügt, der an die Unterzeichnung des Gesetzes erinnerte.
Der International Banking Act sollte erstmals einen umfassenden Rahmen für die Regulierung und Überwachung des Auslandsbankwesens in den USA schaffen. Bis zum Anfang der 1970er Jahre waren ausländische Banken in den USA meist als spezialisierte Institute tätig, die sich hauptsächlich mit der Finanzierung des Außenhandels befassten. Von 1972 bis 1977 verdoppelte sich die Zahl ausländischer Bankniederlassungen auf 210. Obwohl dieses Wachstum dramatisch war, war diese Zahl im Vergleich zum Engagement von US-Banken im Ausland noch relativ gering. Ziel des Gesetzes war es, ausländischen Bankinstituten die gleichen Rechte, Pflichten und Privilegien wie inländischen Banken einzuräumen und dabei gleichzeitig Inlandsbanken zu stärken. Diese fühlten sich durch das Anwachsen der Auslandsbankentätigkeit zunehmend bedroht und sorgten sich um die Auswirkungen im inländischen Bankensektor und um die Geldpolitik der Vereinigten Staaten. Zugleich fürchtete man jedoch ausländische Vergeltungsmaßnahmen bei zu restriktiven Maßnahmen. Eine solche Vergeltung wäre für die großen US-Banken verheerend gewesen, da Auslandsbankgeschäfte eine wichtige Einnahmequelle darstellten.
Der International Banking Act von 1978 stellte alle amerikanischen Zweigstellen ausländischer Banken unter die Zuständigkeit der US-Bankenvorschriften mit erforderlichen Reservequoten und US-Rechnungslegungs- und Regulierungsstandards. Gleichzeitig gewährte das Gesetz den Banken jedoch auch eine Einlagensicherung und eine Vereinfachung um innerhalb der USA Niederlassungen gründen zu können. Ausländische Institute konnten somit gleichberechtigt Filialen eröffnen, wurden jedoch verpflichtet, einen bestimmten Staat als „Heimatstaat“ zu bestimmen und es durften keine Tochterbanken außerhalb dieses Heimatstaates erworben werden. Diese Beschränkungen konnten jedoch durch eine „Großvater-Klausel“ umgangen werden, falls eine ausländische Bank seine US-Konzession bereits vor dem 27. Juli 1978 erhalten hatte.
Am 15. Juli 1978, nur zwölf Tage vor dem Endtermin der Klausel, erhielt die Deutsche Bank von der Bankenaufsichtsbehörde des Staates New York die Konzession, eine Filiale in Manhattan zu errichten. Ein Zufall oder ein geschickter Schachzug?
Schon in der zweiten Jahreshälfte 1977 hatten bankinterne Berichte empfohlen, noch vor Inkrafttreten des International Banking Act die Konzession zu beantragen. Die Entscheidung fiel in eine Phase, in der die Strategie der Deutschen Bank generell darauf ausgerichtet war, an den wichtigen Finanzplätzen der Welt mit eigenen Filialen vertreten zu sein. Auch in den USA, wo sie bereits seit rund hundert Jahren Geschäfte betrieb, war sie bislang nicht unter ihrem eigenen Namen präsent. Vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Verabschiedung des International Banking Acts und dem Mitwirken führender Vertreter der Deutschen Bank daran, zeugt die „rechtzeitige“ Beantragung der Konzession für die New Yorker Filiale, die schließlich am 30. April 1979 eröffnet wurde, auf jeden Fall von einem cleveren Timing.
weiterführende Informationen
Christopher Kobrak – Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute
Zur deutschen und amerikanischen Identität – Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999
Zeige Inhalt von 12.11.1982 - Stahlgespräche
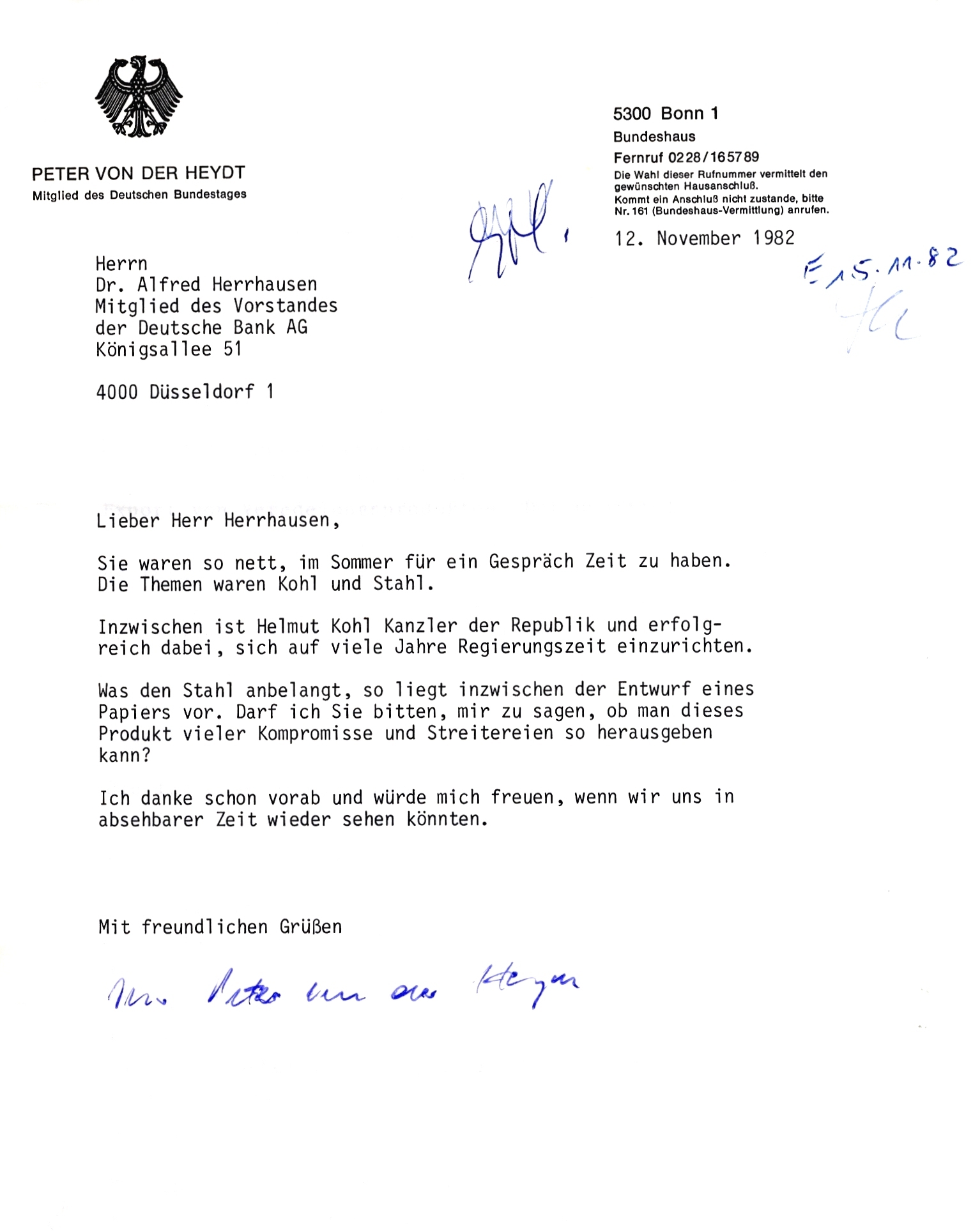 Peter von der Heydt
Peter von der Heydt
Mitglied des Deutschen Bundestages
5300 Bonn 1
Bundeshaus
Fernruf 0228/165789
12. November 1982
Herrn
Dr. Alfred Herrhausen
Mitglied des Vorstandes
der Deutsche Bank AG
Königsallee 51
4000 Düsseldorf 1
Lieber Herr Herrhausen,
Sie waren so nett, im Sommer für ein Gespräch Zeit zu haben. Die Themen waren Kohl und Stahl.
Inzwischen ist Helmut Kohl Kanzler der Republik und erfolgreich dabei, sich auf viele Jahre Regierungszeit einzurichten.
Was den Stahl anbelangt, so liegt inzwischen der Entwurf eines Papiers vor. Darf ich Sie bitten, mir zu sagen, ob man dieses Produkt vieler Kompromisse und Streitereien so herausgeben kann?
Ich danke schon vorab und würde mich freuen, wenn wir uns in absehbarer Zeit wieder sehen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Peter von der Heydt
Kommentar
Vor dem Hintergrund der Krisen in zentralen Branchen des rheinisch-westfälischen Industriereviers änderte sich während der 1970er und 1980er Jahre auch die Rolle der Deutschen Bank, die nicht mehr wie in der Nachkriegszeit den Aufschwung, sondern nun den Strukturwandel der Region begleitete. Seit Anfang der 1980er Jahre war vor allem der aus Essen stammende Alfred Herrhausen (1930-1989) im Vorstand der Deutschen Bank Ansprechpartner für die damit verbundenen Fragen. Mitte November 1982, kurz nach dem politischen Wechsel in Bonn, war Herrhausen von der neuen Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl, mit dem er seit Jahren freundschaftlich verbunden war, in einen dreiköpfigen Expertenkreis berufen worden. Die beiden weiteren Stahlmoderatoren waren Marcus Bierich, der lange Jahre dem Vorstand von Mannesmann angehörte und Günter Vogelsang, der frühere Krupp-Vorstandsvorsitzende. Ziel war es, ein Konzept zu erarbeiten, dass die Organisation der deutschen Hüttenindustrie effizienter gestaltete. In den „Stahlgesprächen“ zur Neuordnung der Branche, an denen die wesentlichen Branchenvertreter wie Thyssen, Krupp, Hoesch und Klöckner beteiligt waren, sollten Vorschläge für unternehmensübergreifende Kooperationen und marktstabilisierende Maßnahmen erarbeitet werden. Das bedeutete konkret: Konzentration der Stahlproduktion auf die technisch leistungsfähigsten Anlagen durch Abbau von Überkapazitäten mittels Stilllegung von Produktionseinrichtungen, die diesen Ansprüchen nicht mehr genügten. Die erste Runde der Gespräche fand vom 4. bis 22. Dezember 1982 statt. Der Bericht der Moderatoren wurde am 23. Januar 1983 in der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der Brief des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter von der Heydt (1938-2008) an Deutsche Bank-Vorstand Alfred Herrhausen vom 12. November 1982 steht zeitlich kurz vor der Berufung Herrhausens zum Stahlmoderator. Von der Heydt, der dem Bundestag seit 1976 angehörte, verweist auf ein Gespräch im Sommer, bei dem es um „Kohl und Stahl“ ging. Es ist in der Tat Kohl und nicht Kohle gemeint, freilich ist dem Schreiber der Wortwitz, der im Kontext mit dem Montanrevier entsteht, bewusst. Bemerkenswert ist, dass bereits vor dem Regierungswechsel aus dem Kreis der zukünftigen christlich-liberalen Koalitionäre nach Experten für die Stahlgespräche gesucht wurde. Ebenso bemerkenswert ist von der Heydts Bemerkung, dass Helmut Kohl dabei ist, „sich auf viele Jahre Regierungszeit einzurichten“ – es wurden bekanntlich 16 Jahre. Dem Schreiben ist auch bereits ein Entwurf für Lösungsvorschläge in der Stahlkrise beigefügt, zu dem Herrhausen in seinem Antwortschreiben mit freundlicher Skepsis bemerkt „daß die Lösungsvorschläge zwar beherzigende Grundsätze, aber verhältnismäßig wenig konkrete Hinweise und Maßnahmen enthalten. Ohne solche werden wir aber mit den Schwierigkeiten nicht fertig werden. Die eigentliche Problematik beginnt ja immer dann, wenn man vernünftige Prinzipien in konkrete Alltagsmaßnahmen umsetzen soll.“
Letztlich scheiterte die Umsetzung der detaillierten Vorschläge, die Herrhausen mit Bierich und Vogelsang zur Reorganisation der Branche in der Folgezeit erarbeiteten, damals genau daran. An der zögernden oder unkonkreten Haltung der Politik, wie auch an der mangelnden Bereitschaft der großen und nach wie vor selbstbewusst auftretenden Traditionsunternehmen, aufeinander zuzugehen.
weiterführende Informationen
Friederike Sattler - Herrhausen – Banker, Querdenker, Global Player. Ein deutsches Leben
Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
