Vortragsveranstaltungen
Zeige Inhalt von 2025 - Lunch Lecture "Wie die Amerikaner zu Investoren wurden"
Am 27. Oktober durfte die Historische Gesellschaft ihre Mitglieder zu einer weiteren Lunch Lecture einladen, diesmal zum Thema "Wie die Amerikaner zu Investoren wurden".
2021 stieg der Wert von Eigenheimen in den Vereinigten Staaten um 30 Prozent. Die Altersvorsorgekonten von älteren Bürgern wuchsen um durchschnittlich 20 Prozent, die von jüngeren um 33 Prozent. Im gleichen Zeitraum legten die Einkommen um 11 Prozent zu. Die wirtschaftlichen Aussichten von US-Amerikanern sind zunehmend von Arbeitsplätzen und Einkommen entkoppelt. Sie sind stattdessen enger an die Renditen aus ihrem Vermögen gebunden. Dies ist eine neue Entwicklung und eine deutliche Abkehr von der Ordnung der Nachkriegszeit, als der Konsum auf dem Lohnwachstum basierte.

In ihrem Vortrag beschrieb Chloe Thurston, Professorin für Politische Wissenschaften an der Northwestern University, die Ursachen und Folgen des Aufstiegs von Masseninvestitionen. Sie beleuchtete das Zusammenspiel technologischer, regulatorischer und politischer Faktoren, die zu dieser Verschiebung beigetragen haben. Der Bogen spannt sich vom New Deal bis zu den heutigen Debatten über Kryptowährungen.
Die anschließende Frage-und-Antwort-Runde wurde von Robin Winkler, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank, moderiert.
Zeige Inhalt von 2025 - Sport und Geld
Im Sport spielt Geld eine immer größere Rolle. Das belegen nicht nur Rekordtransfersummen im Männerfußball, wie sie auch in diesem Sommer gemeldet wurden. Auch andere Sportarten werden zunehmend kommerzieller. Das gilt insbesondere für Profiligen in den USA, aber auch in Asien und der arabischen Welt.
In vielen olympischen Sportarten ist das Bild hingegen ein ganz anderes. Hier sind viele Athletinnen und Athleten auf Fördergelder wie die der Deutschen Sporthilfe angewiesen, um ihren Sport überhaupt auf professionellem Niveau ausüben zu können. Vom Sport leben können die wenigsten.
Diese Bedingungen werfen Fragen auf: Wie sichert man die Vielfalt im Leistungssport, auch jenseits der medial dominanten Disziplinen? Und wie fördert man Talente, ohne dass finanzielle Unsicherheit zur Hürde wird?
Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Themenabend „Sport und Geld“ der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank. Alexander von zur Mühlen, seit Juni 2025 auch Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte dazu über 250 Gäste in den Deutsche-Bank-Türmen in Frankfurt. Dabei hob er zum einen die sportliche Begeisterung der Mitarbeitenden, andererseits das Engagement der Bank im Sport hervor.
Hauptredner des Abends war der Moderator, Autor, Podcaster und Stadionsprecher Arnd Zeigler, vielen bekannt durch seine wöchentliche Fernsehsendung zur „wunderbaren Welt des Fußballs“. Auf unterhaltsame, satirische Weise ging er anhand zahlreicher Fernsehbilder der vergangenen 60 Jahre der Frage nach, was die Wirtschaft vom Fußball lernen könne. Das sei „erschreckend wenig“, räumte er ein. Das Verhältnis von Fußball und Geld bezeichnete er als „Traum-Zwangs-Ehe“.
In der anschließenden Gesprächsrunde, die Ralf Drescher aus der Kommunikationsabteilung moderierte, diskutierte Arnd Zeigler mit der Weitspringerin und Deutsche-Bank-Sportstipendiatin Mikaelle Assani und Tobias Osterkamp aus dem Wealth Management unserer Bank.
Die Leichtathletin Assani finanziert sich durch die Sporthilfe, ihren Verein und Sponsoren. Für die Sponsorensuche nutzt sie Social Media als Multiplikator. Eine höhere Medienpräsenz der Leichtathletik steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Sie habe jedoch nie gedacht, die falsche Sportart gewählt zu haben. Sie betreibe Sport nicht wegen des Geldes, sondern aus Leidenschaft.
Spitzensportlerinnen und -sportler, die oft schon in jungen Jahren viel Geld verdienen, berät Tobias Osterkamp in Vermögensfragen. Die Herausforderung dabei sei es, mit den Kunden eine langfristige Strategie zu entwickeln und diese konsequent zu verfolgen, um die Zeit nach der aktiven Sport-Karriere vorzubereiten.
Er machte dabei deutlich, dass der Schlüssel für eine langfristige Zusammenarbeit ist, Vertrauen aufzubauen und als Sparringspartner für den Sportler zu dienen. So ließe sich auch das Spannungsfeld der langfristigen Ausrichtung mit kurzfristigem Konsum gut balancieren.
Einig war sich die Runde am Ende, dass Geld nicht zum alleinig bestimmenden Faktor werden dürfte. In den Worten Arnd Zeiglers: „Fußball ohne Fans und Emotionen funktioniert nicht.“
Zeige Inhalt von 2024 - Preview des Films "Herrhausen - Herr des Geldes"
Auf Einladung der Historischen Gesellschaft fand am 30. September 2024 eine Preview des ersten Teils von "Herrhausen - Herr des Geldes" statt. Der Erste Vorsitzender Clemens Börsig konnte im Frankfurter Kino "Cinéma" rund 200 Gäste begrüßen.
Auf die Vorabvorführung folgte eine Gesprächsrunde mit der Produzentin des Films Gabriela Sperl, dem leitenden Produzent Christer von Lindequist, Drehbuchautor Thomas Wendrich und der Historikerin und Herrhausen-Biografin Friederike Sattler. Deutsche-Bank-Mediensprecher Hanswolf Hohn moderierte.

Die Teilnehmenden der Gesprächsrunde (von links) Christer von Lindequist,
Thomas Wendrich, Friederike Sattler, Gabriela Sperl
mit Regisseurin Pia Strietmann und Moderator Hanswolf Hohn.
Die Runde diskutierte Fragen wie: Wo muss ein Drehbuch vereinfachen, sich auf eine Auswahl von Akteuren fokussieren? Wo gibt es bewusst Abweichungen zu den historischen Abläufen? Wo fanden die Drehs der aufwändigen Produktion statt? In der Tat wurden die meisten Sets nachgebaut, da zum Beispiel die Deutsche-Bank-Türme im Innern heute völlig anders aussehen wie vor 35 Jahren. Und natürlich gab es einen freien Umgang mit historischen Details. Das Publikum, darunter Weggefährten Herrhausens, diskutierte lebhaft mit.

Zeige Inhalt von 2024 - 50 Jahre Schrägstrich im Quadrat

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Deutsche-Bank-Logos lud die Historische Gesellschaft am 2. September 2024 zu einem Themenabend in die Deutsche-Bank-Türme nach Frankfurt ein zu dem der Erste Vorsitzende Clemens Börsig rund 250 Gäste begrüßen konnte.


Christina Thomson, Leiterin der Sammlung Grafikdesign, Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin stellte in ihrem Vortrag 'Form und Funktion: Anton Stankowski und die Fluidität des Kunstbegriffs' den Schöpfer des Deutsche Bank-Logos in den Mittelpunkt. "Ob Kunst oder Design ist egal, nur gut muss es sein". Stankowski waren herkömmliche Abgrenzungen fremd. Für ihn zählte nur die Qualität eines Entwurfs. Über frühere Firmenzeichen der Bank und wie sich vor 50 Jahren der Schrägstrich im Quadrat unter 140 Entwürfen in einem Gestaltungswettbewerb durchsetzte sprach Jens Müller, Professor für Corporate Design an der Fachhochschule Dortmund. Gleichzeitig ordnete er Stankowskis Sieger-Entwurf in den Kontext der damaligen Zeit ein.

In der anschließenden Gesprächsrunde wurden Anwendungen, Bedeutung und Zukunft des Logos aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Unter diesen Perspektiven durfte auch die der Praxis nicht fehlen. Neben Christina Thomson und Jens Müller saß mit Harald Eisenach, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung Ost und seit 42 Jahren für die Deutsche Bank im In- und Ausland tätig, ein Bankvertreter auf dem Podium, der die Wirkung des Logos auf Kunden und Mitarbeitende einzuordnen wusste. Christian Rummel, Leiter des zentralen Markenmanagements der Deutschen Bank, moderierte das Gespräch.

Die Veranstaltung bot auch den perfekten Anlass, die soeben erschienene Publikation „50 Jahre Schrägstrich im Quadrat“ einem breiteren Publikum zu präsentieren.
Zeige Inhalt von 2023 - Die wilden Zwanziger

Rund 300 Gäste konnte der Erste Vorsitzende Clemens Börsig am 11. Oktober 2023 zur Abendveranstaltung „Die wilden Zwanziger“ in den Deutsche-Bank-Türmen begrüßen.
Es war ein Jahrzehnt der krassen Gegensätze: Vor genau 100 Jahren erreichte die Hyperinflation in Deutschland ihren Höhepunkt. Breite Bevölkerungsschichten erlitten damals einen Totalverlust ihrer Ersparnisse - eine traumatische Erfahrung, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt hat. Gleichzeitig sind die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts aber bis heute auch für ihre kreative Kulturszene und die ausschweifende Feierkultur berühmt und berüchtigt.
Die Teilnehmenden bekamen neue Einblicke auf diese politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich unruhige Zeit. Den Anfang machten Ausschnitte aus dem ältesten Werbefilm des deutschen Bankwesens, den 1927 die Disconto-Gesellschaft produzierte, eines der Vorläuferinstitute der Deutschen Bank. Die Pianistin Christina Becht begleitete den Stummfilm live am Flügel.

Texte zur Kultur der Bankangestellten trug Peter Schröder vor, Mitglied des Ensembles am Schauspiel Frankfurt. Er zitierte aus Siegfried Kracauers berühmter Studie „Die Angestellten“ von 1929/30, worin es heißt: „Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins, und doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme, deren Sitten die Angestellten in den Filmen bewundern.“

Zwei Vorträge vertieften das Thema. Nadine Rossol, Professorin am Department of Modern European History der University of Essex, sprach über Kultur und Geschichte der zwanziger Jahre. Sie betonte den sozialen und ästhetischen Umbruch, der mit Filmen von Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang, der Architektur des Bauhauses und dem „Epischen Theater“ von Bertolt Brecht zum Ausdruck kam. In der Politik waren die Einführung des Frauenwahlrechts und des Achtstundentages Meilensteine. “In dieser Zeit wurde das Verhältnis von Bürger und Staat neu definiert. Was damals errungen wurde, kennzeichnet bis heute den modernen Sozialstaat”, so Rossol.

Der Journalist und Buchautor Frank Stocker sprach abschließend über die Hyperinflation von 1923 und ihre Folgen. Er schilderte eindrucksvoll das Ausmaß dieser Geldentwertung, an deren Ende für einen US-Dollar 4,2 Billionen Mark bezahlt werden mussten: “Wenn ich Ihnen jede Sekunde einen Euro gebe, würde es 31.500 Jahre dauern, um eine Billion zu erreichen”. Der Schock des Verlusts jeglicher Geldfunktion saß tief und war nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmend für die antiinflationäre Geldpolitik in der Bundesrepublik.

Sänger und Conférencier Denis Wittberg umrahmte das Programm musikalisch, Christina Becht am Flügel und Katrin Becht an der Violine begleiteten ihn. Viele Schlager der damaligen Zeit, wie “Ich brauche keine Millionen” oder das Lied vom „Kleinen grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists, klingen uns heute noch im Ohr.



Denis Wittberg sagte über seine Interpretationen alter Evergreens: „Sie klingen Sehnsucht erweckend wie die gepflegten Automobile einer Oldtimer-Rallye, und sehen zugleich wie neu aus! Aber fürchten Sie sich nicht – denn alle Lieder swingen, foxtrotten und walzern sich wie eh und je in Ihre Ohren.“

von links: Martin L. Müller, Geschäftsführer Historische Gesellschaft; Frank Stocker, Wirtschaftsredakteur WELT;
Nadine Rossol, University of Essex; Clemens Börsig, Erster Vorsitzender Historische Gesellschaft; Katrin Becht;
Denis Wittberg; Christina Becht; Peter Schröder, Schauspiel Frankfurt
Zeige Inhalt von 2023 - Ludwig Knoop
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 20. Juni 2023 hielt der Historiker Dittmar Dahlmann, emeritierter Professor und Experte für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn, unter dem Titel „Vater denkt und träumt nur noch in Baumwolle“ einen Vortrag über den Bremer Großkaufmann und Deutsche-Bank-Kunden der ersten Stunde Ludwig Knoop (1821-1894).

Zeige Inhalt von 2023 - Lunch Lecture zur Geschichte von Eintracht Frankfurt
Am 24. März fand die nächste Lunch Lecture der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank e.V. statt. Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums, sprach zum Thema "Eintracht Frankfurt – Geschichte(n) – Stadt – Menschen".
Thoma ist eine Instanz, wenn es um die Frankfurter Sport- und Fußballgeschichte geht. Wie kein anderer kennt er die Geschichte der Eintracht und versteht es, die dazugehörigen Anekdoten lebendig zu erzählen – von den Gründern bis in die Gegenwart. Zur Lunch Lecture brachte er die Meisterschale von 1959 mit.
Auch die NS-Vergangenheit der Eintracht kam zur Sprache. Das Eintracht-Museum engagiert sich für die Aufarbeitung dieser Zeit, wofür ihm der Deutsche Fußball-Bund 2021 den renommierten Julius-Historisch-Preis verlieh. Die Historische Gesellschaft und das Eintracht-Museum kooperieren seit mehreren Jahren bei den Stolpersteinen in Frankfurt für in der NS-Zeit verfolgte Bankangestellte und Vereinsmitglieder.
Zeige Inhalt von 2022 - "Die Bank lebt nicht von Geld allein" (In Erinnerung an Hilmar Kopper)
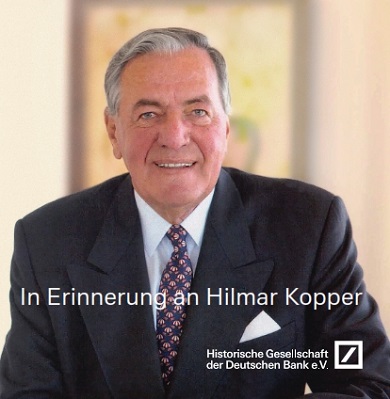
Er war ein Urgestein der Deutschen Bank. Vor einem Jahr verstarb der langjährige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende Hilmar Kopper. Aus diesem Anlass hat die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank eine Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde organisiert, die auf Koppers erfülltes Berufsleben zurückblickte. Dieses hatte er ab 1954 fast ein halbes Jahrhundert lang ausschließlich in der Deutschen Bank verbracht.
Mit rund 300 Gästen, die der Einladung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank folgten, war das Forum in den Deutsche-Bank-Türmen bis auf den letzten Platz besetzt. Im Publikum eine Reihe von Familienmitgliedern und Weggefährten.
Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Vorstandsmitglied der Historischen Gesellschaft, machte in seiner Begrüßung deutlich: Das Interesse Hilmar Koppers galt nicht ausschließlich dem Bankgeschäft. So spielte zum Auftakt und zum Ausklang ein Ensemble des Musikgymnasiums Schloss Belvedere in Weimar – eine Institution, der Hilmar Kopper seit Anfang der 1990er-Jahre eng verbunden war.

Die Schülerinnen Paula Wettengel und Maria Hauptmann vom Musikgymnasium Weimar bezauberten das Publikum mit ihrem Harfenspiel.
Eng verbunden blieb er ‚seiner‘ Deutschen Bank auch nach seiner aktiven Zeit, wie Karl von Rohr aus eigener Erinnerung weiß: „Wann immer er es einrichten konnte, war er dabei, bewusst sichtbar, wohlwollend, unterstützend, ermutigend. Wenn man seinen Rat brauchte, war er da. Wenn nicht, drängte er sich nicht auf. Aber man wollte seinen Rat und er gab ihn großzügig und durchdacht.“
Ausschnitte aus einem 2013 geführten Interview vermittelten noch einmal ein lebendiges Bild der eindrucksvollen Persönlichkeit Hilmar Koppers.
Harold James, Professor an der Princeton University, herausragender Kenner der Deutschen Bank und einer der bedeutendsten Wirtschaftshistoriker unserer Tage, ordnete die Lebensleistung Hilmar Koppers ein – für die Bank, sowie für die Nachkriegsentwicklung in Deutschland, Europa und der globalisierten Welt. Die Transformation, die die Bank in Koppers Sprecherzeit (1989 bis 1997) erlebte, fasste James pointiert zusammen: „Mitte der 1990er Jahre hatte das Institut die Grenzen dessen erreicht, was organisch machbar war. Wie die Martinis von James Bond musste sie geschüttelt, nicht gerührt werden.“

Harold James von der Princeton University zeichnete ein eindrucksvolles Bild der Lebensleistung Hilmar Koppers.
Die anschließende Gesprächsrunde thematisierte unter anderem Koppers kulturelles Engagement und ging der Frage nach, wie sich heute, in Zeiten begrenzterer Ressourcen, die Beziehung zwischen Geschäft und kultureller Förderung gestalten lässt. Gemeinsam mit Karl von Rohr diskutierten Julia Heraeus-Rinnert, Wolfgang Kirsch und Professor Hartmut Leppin als Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Institutionen, für die sich Hilmar Kopper persönlich engagiert hat – die Universität Frankfurt, das Städel und das Historische Kolleg in München.
„Die Bank lebt nicht von Geld allein“ lautet der Titel einer Sammlung mit Reden Hilmar Koppers zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen. Mit diesem Motto war auch die Gesprächsrunde überschrieben. Wolfgang Kirsch, viele Jahre selbst bei der Deutschen Bank tätig und später Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, war sich sicher: „Eine Bank, die nicht in der Mitte der Gesellschaft steht, ist nicht in der Lage, aufkommende Trends zu erkennen.“ Angesichts der markanten Persönlichkeit Hilmar Koppers diskutierte die Runde auch darüber, ob eine solche Führungskraft heute noch denkbar sei. „Wenn Personality erlernbar wäre, dann wäre es keine Personality mehr“, gab Hartmut Leppin zu bedenken.

Wieviel „Personality“ verträgt eine Führungskraft? Über diese und andere Fragen diskutierte eine Gesprächsrunde unter der Leitung von Anke Hallmann,
Co-Leiterin des Bereichs Kommunikation und Soziale Verantwortung der Deutschen Bank.
Hilmar Kopper hatte einmal geäußert, dass er keiner sei, der ein Replay mache, sondern am Abend sage, jetzt ist Schluss für heute. Wie es gelinge, den Arbeitsalltag nicht mit nach Hause zu nehmen, fragte Moderatorin Anke Hallmann abschließend die Runde. Julia Heraeus-Rinnert machte deutlich, dass es bei einem Familienunternehmen nicht so einfach sei, die Themen des Tages am Abend außen vor zu lassen. Karl von Rohr schloss sich der Kopper'schen Haltung an und fasste es humorvoll in die alte Operettenweisheit „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“.

Wolfgang Kirsch, Vorsitzender der Administration des Städels; Hartmut Leppin, Vorsitzender des Kuratoriums des Historischen Kollegs; Gerold Herzog,
Direktor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere; Julia Heraeus-Rinnert, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Freunde und Förderer der
Goethe-Universität; Hilmar Koppers Witwe Brigitte Seebacher; Harold James, Princeton University; Christopher Kopper; Karl von Rohr; Anke Hallmann (von links).
Zeige Inhalt von 2021 - Banken und Bankiers als Kunstsammler
Digitale Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde zum Thema "Banken und Bankiers als Kunstsammler" am 18. Oktober 2021
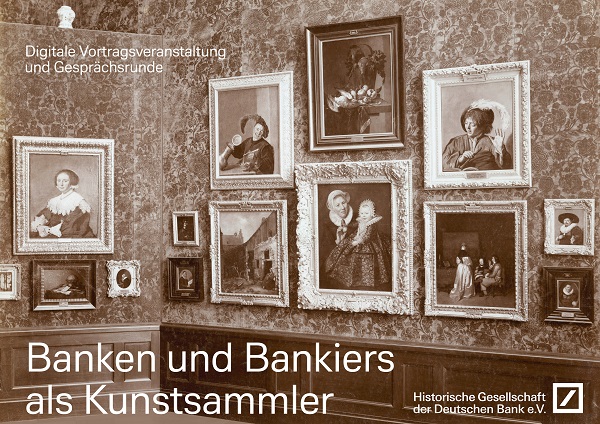
Zur digitalen Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde "Banken und Bankiers als Kunstsammler" lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 18. Oktober 2021 ein.
Rund 200 Mitglieder und Interessierte hatten sich an dem Abend eingewählt. Die nach wie vor geltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie erlaubten es noch nicht, mit größerem Publikum in Präsenz im gewohnten Vortragssaal in den Deutsche-Bank-Türmen zusammenzukommen.

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, machte in seiner Begrüßung deutlich, dass das Sammeln und Fördern von bildender Kunst heute fester Bestandteil der Philosophie vieler Unternehmen, nicht zuletzt im Bankwesen ist. Doch die oft sehr weit zurückreichende Unterstützung von Künstlern geht meist auf das persönliche Engagement der Bankiers und Bankmanager zurück. So lässt sich ein Interesse am Sammeln von bildender Kunst schon für die Führungspersönlichkeiten der Großbanken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachweisen.

Als erste Vortragende sprach die Kunsthistorikern Wibke Vera Birth, Kuratorin am Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen, über den Sammler und Kunstmäzen Barthold Suermondt. Suermondt, der 1847 eine Privatbank in Aachen gründete (eine lokale Vorläuferin der Deutschen Bank), besaß Mitte des 19. Jahrhunderts eine der hochkarätigsten privaten Kunstsammlungen in Deutschland.

Der Soziologe Stephan Wolff, der am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim lehrt, beschäftigte sich mit dem Bankier und Kunstsammler Alfred Wolff. Über die Freundschaft zwischen Alfred Wolff, der zwischen 1905 und 1911 als Direktor der Deutschen Bank tätig war, und dem Künstler Henry van de Velde hat er bereits 2018 einen Bildband veröffentlicht, der mit Unterstützung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank erschienen ist. Neben dem wissenschaftlichen Interesse an den Berührungspunkten zwischen Wirtschafts- und Kultureliten hatte er auch ein persönliches Interesse an dem Thema: Der Bankier und Kunstsammler Alfred Wolff ist sein Großvater.

Friedhelm Hütte, der seit mehreren Jahrzehnten die Kunstabteilung der Deutschen Bank leitet, beschrieb die Entstehung und Geschichte der Sammlung der Deutschen Bank und das berühmte Konzept „Kunst am Arbeitsplatz“.

Unmittelbar an die Vorträge schloss sich eine Gesprächsrunde an, die von Lisa Zeitz, Kunsthistorikerin und Chefredakteurin des Magazins „Weltkunst“, moderiert wurde. Als weiteren Gast begrüßte sie dazu Dirk Boll, Europa-Chef des Auktionshauses Christie’s, für das er seit 1998 tätig ist. Zugleich lehrt er Management und bildende Kunst mit dem Schwerpunkt Kunstmarkt am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg.

Dirk Bolls pointierter Hinweis, dass "Bankiers immer über Kunst reden wollen und Künstler über Geld", eröffnete einen angeregten Gedankenaustausch über die vielfältigen Künstler-Unternehmer-Beziehungen von der Renaissance bis in die heutige Zeit.

Möchten Sie in Zukunft direkt zu allen unseren Veranstaltungen eingeladen werden? Dann werden Sie hier Mitglied!
Zeige Inhalt von 2019 - Alfred Herrhausen und der Aufbruch ins globale Bankgeschäft
Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde zum Thema "Alfred Herrhausen und der Aufbruch ins globale Bankgeschäft"
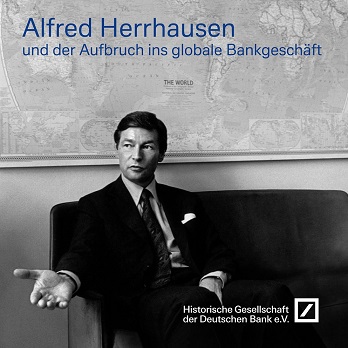 Alfred Herrhausen – War er der inspirierende Querdenker und Quereinsteiger, den die Deutsche Bank bei ihrem Aufbruch ins globale Bankgeschäft an ihrer Spitze brauchte?
Alfred Herrhausen – War er der inspirierende Querdenker und Quereinsteiger, den die Deutsche Bank bei ihrem Aufbruch ins globale Bankgeschäft an ihrer Spitze brauchte?
Und ist die Bank nach seinem Tod am 30. November 1989 „seinen Weg“ weiter gegangen oder hat sie ihn verlassen?
Diesen inhaltlichen Bogen spannte die Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde der Historischen Gesellschaft am 19. Dezember 2019 in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt, zu der die im letzten November erschienene und vielbeachtete Biographie „Herrhausen – Banker, Querdenker, Global Player“ den Anlass gab.
Außer Frage steht, dass die Persönlichkeit Herrhausens bis heute fasziniert. Schon wer das bis auf den letzten Platz besetzte Forum in der Taunusanlage betrat, passierte die Inschrift mit der bekannten Herrhausen-Sentenz: „Freiheit – und Offenheit, die damit einhergeht – wird uns nicht geschenkt. Die Menschen müssen darum kämpfen, immer wieder.“
Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte die mehr als 300 Teilnehmer, darunter Herrhausens Witwe Traudl Herrhausen und seine Tochter Anna Herrhausen. Zunächst kam Alfred Herrhausen selbst zu Wort – in Ausschnitten aus seinem letzten großen Fernsehinterview, das der Journalist und Produzent Gero von Boehm im Oktober 1989 mit ihm führte. Verblüffend aktuell klangen seine Äußerungen, etwa zur Verantwortung der Weltgemeinschaft für den brasilianischen Regenwald, die auch aus einer Rede im Jahr 2019 stammen könnten.
 Herrhausen in seiner Zeit: Der Wirtschaftshistoriker Johannes Bähr, Professor am Historischen Seminar der Goethe-Universität, untersuchte in seinem Vortrag "Alfred Herrhausen – ein inspirierender Querdenker in der Deutschen Bank" die Bedeutung Herrhausens, der 1970 in den Vorstand der Deutschen Bank eintrat und spätestens in seiner Sprecherzeit zu deren Aushängeschild avancierte, nicht zuletzt dank seiner Eloquenz und visionären Kraft. Bähr identifizierte Herrhausen als ersten global denkenden Vertreter einer deutschen Großbank, der mehr als nur ein „Herr des Geldes“ sein wollte. Mit seinen für einen Banker ungewöhnlichen Impulsen – vor allem seiner Forderung nach einem teilweisen Schuldenerlass für die Länder der Dritten Welt – habe er in großen Teilen der Finanzwelt heftige Reaktionen ausgelöst, die man heute als „Shitstorm“ bezeichnen würde.
Herrhausen in seiner Zeit: Der Wirtschaftshistoriker Johannes Bähr, Professor am Historischen Seminar der Goethe-Universität, untersuchte in seinem Vortrag "Alfred Herrhausen – ein inspirierender Querdenker in der Deutschen Bank" die Bedeutung Herrhausens, der 1970 in den Vorstand der Deutschen Bank eintrat und spätestens in seiner Sprecherzeit zu deren Aushängeschild avancierte, nicht zuletzt dank seiner Eloquenz und visionären Kraft. Bähr identifizierte Herrhausen als ersten global denkenden Vertreter einer deutschen Großbank, der mehr als nur ein „Herr des Geldes“ sein wollte. Mit seinen für einen Banker ungewöhnlichen Impulsen – vor allem seiner Forderung nach einem teilweisen Schuldenerlass für die Länder der Dritten Welt – habe er in großen Teilen der Finanzwelt heftige Reaktionen ausgelöst, die man heute als „Shitstorm“ bezeichnen würde.

Und nach Herrhausen: Ist die Bank seitdem einen Weg gegangen, den auch Herrhausen eingeschlagen hätte, oder hätte Herrhausen die Weichen anders gestellt?
Jan Pieter Krahnen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung im House of Finance und (Co-) Direktor des Center for Financial Studies in Frankfurt, konstatierte eine „signifikante Underperformance“ der Bank in den letzten Jahrzehnten. Er bezeichnete das seit den 1980er Jahren von der Deutschen Bank verfolgte Modell einer Universalbank mit integrierter Investmentbank als einen Sonderweg im internationalen Bankgeschäft.
Krahnens These war der Ausgangspunkt der anschließenden Gesprächsrunde unter der Moderation von Rainer Hank, des langjährigen Leiters der Finanz- und Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Neben Krahnen diskutierten der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, die Journalistin Ursula Weidenfeld und die Autorin der Herrhausen-Biografie, Friederike Sattler.

Am Ende der lebhaften Runde stand die Frage, wo der Typ des politischen Bankers geblieben ist, den Herrhausen wie kaum ein anderer verkörperte. Ist er unzeitgemäß geworden, oder ist diese Rolle in Zeiten des verschärften Wettbewerbs einfach nicht mehr zu leisten? Friederike Sattler betonte, dass die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmers nach wie vor davon abhängt, wie glaubwürdig das ist, was er sagt. In den Worten Alfred Herrhausens: „Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.“

Zeige Inhalt von 2019 - Die Wiener Rothschilds
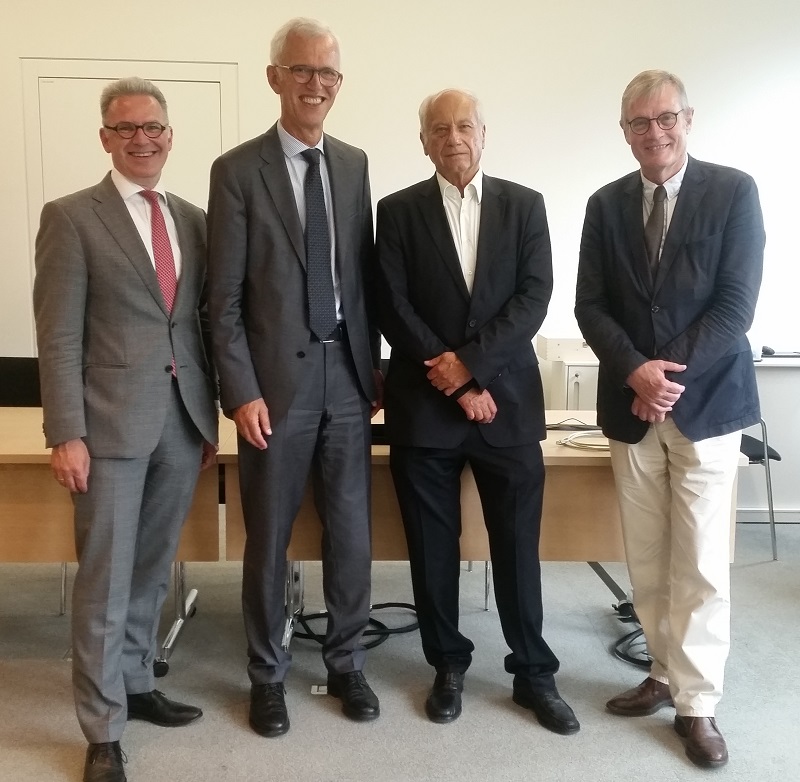 Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. Juni 2019 hielt der Historiker und ehemalige Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz, Prof. Roman Sandgruber, einen außerordentlich interessanten und unterhaltsamen Vortrag über den bislang wenig erforschten Wiener Zweig der Rothschilds. Die Ausführungen basierten auf seinem gerade erschienenen Buch „Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses“, das den Preis zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 erhalten hat.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. Juni 2019 hielt der Historiker und ehemalige Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz, Prof. Roman Sandgruber, einen außerordentlich interessanten und unterhaltsamen Vortrag über den bislang wenig erforschten Wiener Zweig der Rothschilds. Die Ausführungen basierten auf seinem gerade erschienenen Buch „Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses“, das den Preis zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 erhalten hat.
Zeige Inhalt von 2018 - Bankiers und Wein
Symposium der Historischen Gesellschaft zu „Bankiers und Wein“
Was haben Bankiers mit Wein zu tun? Dieser auf den ersten Blick ungewöhnlich scheinenden Kombination widmete sich am 28. August 2018 ein Symposium – ein Begriff aus der Antike, der sinngemäß für „gemeinsames, geselliges Trinken“ steht – der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank. Mehr als 300 Gäste, in dem bis zum letzten Platz gefüllten Forum in den Frankfurter Deutsche-Bank-Türmen, belegten das große Interesse am Thema.
Ein aktuelles Jubiläum lud ein für den Blick zurück: Vor 150 Jahren ersteigerte der Pariser Bankier James de Rothschild das Château Lafite. Das Weingut befindet sich bis heute im Besitz der Familie. Die Rothschilds waren zwar die berühmtesten, aber bei weitem nicht die einzigen Bankiers, die ein Weingut erwarben. In Deutschland taten sich die Mendelssohns hervor, die Güter bei Koblenz und im Bordelais besaßen. Aber Bankiers investierten nicht nur in Wein und tranken ihn, er war auch ein häufiges Gesprächsthema unter Geschäftspartnern. Nicht selten wechselte die Korrespondenz übergangslos von schwierigen Finanzthemen zu Kommentaren über jüngste Verkostungen und edle Gewächse. Auch im Vorstand der Deutschen Bank spielte Wein bis in die jüngere Zeit eine wichtige Rolle. Dem sogenannten Weinausschuss anzugehören, dessen vornehmste Aufgabe die regelmäßige Ergänzung des bankeigenen Weinkellers war, galt – wie der Erste Vorsitzende der Historischen Gesellschaft Dr. Clemens Börsig in seiner Begrüßung verriet – als eine besondere Auszeichnung.

Daniel Deckers breitete die Weinkultur des 19. Jahrhunderts in seinem Vortrag aus
Woher die enge Verbindung zwischen Bankiers und Wein kommt, welche geschäftlichen und sozialen Zwecke sie erfüllte und wie sich der Weinkonsum wandelte, diesen Fragen widmete sich der FAZ-Redakteur Dr. Daniel Deckers. Er ist zudem Dozent für die Geschichte des Weinbaus und Weinhandels an der Hochschule Geisenheim im Rheingau.
In einer Tour d’Horizon beleuchtete er die Anfänge der Weinvermarktung im frühen 19. Jahrhundert durch die Rothschilds, den Statusgewinn deutscher Weine nach der Reichsgründung als Zeichen kultureller Selbstbehauptung, aber auch Weingeschmack als Spiegel eines Lebensgefühls. Bankiers nutzten Wein als Ausweis materiellen Reichtums und kultureller Verfeinerung.
An der von Deckers moderierten Gesprächsrunde nahmen zwei der bedeutenden und traditionsreichen Winzer Deutschlands teil: Bettina Bürklin-von Guradze, die seit 1990 das Weingut Dr. Bürklin-Wolf im pfälzischen Wachenheim leitet, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1597 zurückreichen, und Wilhelm Weil, Inhaber des Weinguts Robert Weil in Kiedrich im Rheingau, das 1867 gegründet wurde. Der Weinhandel wurde durch Heinz-Josef Klaeren vertreten, dem Geschäftsführer der 1859 gegründeten Bremer Firma Segnitz. Segnitz importierte über den Seeweg vor allem Weine aus Bordeaux, um sie am deutschen Markt zu verkaufen. Die Finanzierung dieses Handels brachte Segnitz mit der Deutschen Bank in Kontakt. Als die Deutsche Bank 1881 ihr Kapital erhöhte, zählte Segnitz zu den Zeichnern der neuen Aktien.
Unter der Fragestellung „Wein und Kapital?“ diskutierten sie lebhaft die spezifischen Risiken der Branche, die schon für manches Traditionsgut das Aus bedeuteten. Ebenso kam zur Sprache, wie die Preisexplosion bei Spitzenweinen in den vergangenen beiden Jahrzehnten dazu geführte habe, dass die besten Weine heute kaum mehr getrunken, sondern vor allem als Wertanlage betrachtet würden.

Die Winzer Bettina Bürklin-von Guradze (rechts) und Wilhelm Weil (2. v.l.), der Weinhändler Heinz-Josef Klaeren (2. v.r.), der Weinjournalist Daniel Deckers (links)
Dass sich das Thema Wein wie ein roter Faden auch durch die Musikliteratur zieht, bewies eine Auswahl von Arien und Lieder, darunter die berühmte Champagner-Arie aus Mozarts „Don Giovanni“. Zwei Meisterschüler der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt – Andrea Cueva Molnar (Sopran) und Florian Marignol (Bariton) – trugen die Stücke vor, am Flügel begleitet von Hedayet Djeddikar.

Was aber wäre eine Veranstaltung zum Thema Wein ohne anschließenden Weingenuss. Nach dem offiziellen Programm hatte die Teilnehmer Gelegenheit, ein Bukett edler Tropfen zu verkosten, darunter auch Weine der beiden anwesenden Winzer.
Zeige Inhalt von 2017 - Lunch Lecture zur Konzernentwicklung in der Deutschen Bank mit Hans-Peter Ferslev
Welche Strategie verfolgte die Konzernentwicklung der Deutschen Bank in den 1980er- und 1990er-Jahren? Wie veränderte sich die Konzernstruktur in dieser Zeit und welchen Anteil hatte daran die von Vorstandssprecher Alfred Herrhausen geschaffene "Abteilung für Konzernentwicklung"?
 Vor rund 80 Teilnehmern sprach der langjährige Leiter der "Abteilung für Konzernentwicklung" (AfK) Hans-Peter Ferslev am 4. Dezember 2017 zu diesen und weiteren Aspekten im Rahmen eines "Gesprächs am Mittag" in den Deutsche Bank-Türmen. Dem Gespräch mit Martin Müller vom Historischen Institut der Deutschen Bank schlossen sich Fragen aus dem Publikum und Stellungnahmen der früheren Vorstandsmitglieder Hilmar Kopper und Ulrich Weiss an. Nachzulesen sind Ferslevs Erinnerungen an seine Zeit bei der AfK in einer soeben erschienenen Publikation der Historischen Gesellschaft.
Vor rund 80 Teilnehmern sprach der langjährige Leiter der "Abteilung für Konzernentwicklung" (AfK) Hans-Peter Ferslev am 4. Dezember 2017 zu diesen und weiteren Aspekten im Rahmen eines "Gesprächs am Mittag" in den Deutsche Bank-Türmen. Dem Gespräch mit Martin Müller vom Historischen Institut der Deutschen Bank schlossen sich Fragen aus dem Publikum und Stellungnahmen der früheren Vorstandsmitglieder Hilmar Kopper und Ulrich Weiss an. Nachzulesen sind Ferslevs Erinnerungen an seine Zeit bei der AfK in einer soeben erschienenen Publikation der Historischen Gesellschaft.
Zeige Inhalt von 2017 - Geld und Film - Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren
Vortragsveranstaltung "Geld und Film – Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren"
weiterführende Informationen:
Vortrag Thomas Elsaesser "Die Ufa - Entstehung eines Mythos"
Vortrag Michael Töteberg "Die Ufa - Regisseure, Wirtschaft und Politik"
„Die Methoden nach denen der Kaufmann arbeitet, dürfen den Künstler nicht mit Passiva belasten“
, sagte Starregisseur Fritz Lang schon 1926. Der Adressat: Emil Georg von Stauß, ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Der Bankier hatte es gewagt, auf die ausufernden Produktionskosten des Stummfilms „Metropolis“ hinzuweisen. Peter Schröder vom Schauspiel Frankfurt trug diese und andere Passagen aus Briefen des berühmten Regisseurs bei der Vortragsveranstaltung „Geld und Film“ vor, zu der die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank anlässlich der Gründung der Ufa vor 100 Jahren eingeladen hatte. Was kaum jemand weiß: Die Deutsche Bank war damals Geburtshelfer der legendären deutschen Filmgesellschaft und ihr über viele Jahre als wichtiger Aktionär eng verbunden.

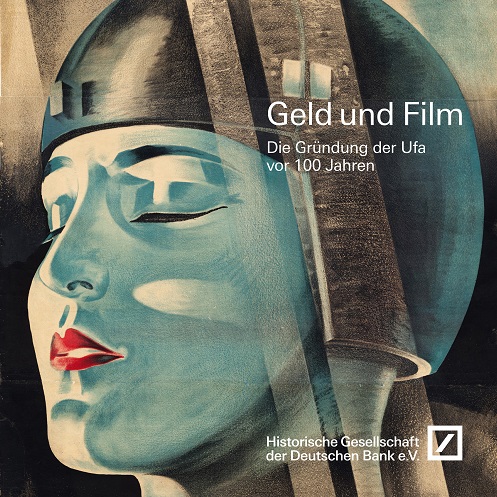
Mit mehr als 300 Gästen war das Forum in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt am 20. November 2017 bis auf den letzten Platz besetzt. Michael Münch, Geschäftsführender Vorstand der Historischen Gesellschaft, umriss in seiner Einführung die Höhen und Tiefen des Engagements der Deutschen Bank in der Filmwirtschaft.
Schöpfer der Ufa war kein Filmschaffender und kein Unternehmer, sondern Erich Ludendorff, der Chef der Obersten Heeresleitung. Er war am Ende des Ersten Weltkriegs besonders an der Rolle von Propaganda für die Kriegsführung interessiert. Früh erkannte er die Bedeutung des Films für diese Zwecke. Ihm schwebte ein großer, nationaler Filmkonzern vor, der vom Staat gesteuert werden sollte. Einig waren sich die staatlichen Stellen darin, einen erfahrenen Finanzier hinzuzuziehen. Die Wahl fiel auf das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank Emil Georg von Stauß. Dieser wurde Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ufa und gewann weitere führende Unternehmen für dieses Projekt. Am 18. Dezember 1917 wurde die Universum-Film AG (Ufa) als Zusammenschluss privater Filmfirmen in Berlin gegründet.Die Suche nach qualifizierten Fachleuten für Produktion und Finanzen gestaltete sich schwierig. 1921 zog sich der Staat aus der Ufa zurück. Die Deutsche Bank sprang ein und wurde Hauptaktionär. Zwei Jahre später stieß Erich Pommer zur Ufa und wurde Chef aller Produktionsbetriebe. Mit Filmen wie „Dr. Mabuse” und „Die Nibelungen” stieg die Ufa zur direkten Konkurrenz für Hollywood auf. Doch schon 1927 befand sich die Ufa in großen finanziellen Schwierigkeiten. Durch die Stabilisierung der deutschen Währung ab November 1923 geriet die deutsche Filmbranche allgemein in eine Krise, der Auslandsabsatz stagnierte durch deutlich gestiegene Preise. Wie stark die Produktionskosten explodierten, zeigt besonders der Film „Metropolis“. 1927 ging die Ufa an die Verlagsgruppe Scherl über. Sie gehörte zum rechtsgerichteten Konzern von Alfred Hugenberg, der auch den Aufsichtsratsvorsitz der Ufa übernahm. Unter dem neuen Eigentümer stellte die Ufa in Rekordzeit auf den Tonfilm um und holte den Produzenten Erich Pommer, der 1926 im Unfrieden nach Hollywood gegangen war, zurück. Pommer war Garant für eine herausragende Qualität der von ihm produzierten Filme. Gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Gleichschaltung der Filmindustrie betrieben. Ein Aderlass für die Ufa war der Beschluss ihres Vorstandes vom März 1933, alle jüdischen Mitarbeiter zu entlassen. Die Gesellschaft verlor damit einen Großteil ihrer produktivsten Kräfte und hatte Schwierigkeiten, genügend Fachleute für ihre Produktionen zu gewinnen. Die Verstaatlichung der Filmwirtschaft, die bereits 1933 eingeleitet wurde, fand für die Ufa im März 1937 ihren Abschluss. Die Reichsregierung erwarb die kompletten Ufa-Aktien und Emil Georg von Stauß übernahm nochmals den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die Ufa produzierte nunmehr eindeutige Propagandafilme, gleichzeitig aber Unterhaltungsfilme mit bevorzugt unpolitischen Themen. Die letzte Großproduktion war der "Durchhaltefilm" „Kolberg“, der Anfang 1945 aufgeführt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Deutsche Bank nochmals für einige Jahre mit der Ufa verbunden. Hinter der Gründung der neuen Universum-Film AG 1957 stand ein Bankenkonsortium unter ihrer Führung. Die finanziellen Schwierigkeiten der Ufa waren aber ähnliche wie Mitte der zwanziger Jahre. 1961 wurde die Kinofilmproduktion eingestellt und 1964 erwarb Bertelsmann die komplette Ufa von dem Bankenkonsortium. Unter diesem Konzerndach befindet sich die Ufa bis heute.



Die Filmhistoriker Thomas Elsaesser von der Universität Amsterdam und Michael Töteberg, Leiter der Rowohlt Medienagentur, gingen in ihren Vorträgen der spannungsgeladenen Beziehung zwischen künstlerischem Anspruch und wirtschaftlichen Anforderungen auf den Grund. Budgetüberschreitungen von Regisseuren wie Fritz Lang und horrende Honorarforderungen, die Schauspieler wie Hans Albers stellten, waren an der Tagesordnung.
Ausschnitte aus dem Filmklassiker und seinerzeitigen Millionengrab „Metropolis“, der Filmoperette „Die Drei von der Tankstelle“ und dem in der Deutschen Bank gedrehten Kurzfilm „Hinter den Zahlen“ zeigten die Bandbreite der Produktionen der deutschen Traumfabrik vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die abschließende Podiumsdiskussion, die von Claudia Dillmann vom Deutschen Filminstitut moderiert wurde, drehte sich um die aktuelle Filmfinanzierung in Deutschland, in der Banken keine Rolle spielen. Wie Günter Winands, Ministerialdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, betonte, trete der Staat nicht mehr wie in der Anfangszeit der Ufa als direkter Produzent von Filmen auf, sondern beschränke sein Engagement auf die Filmförderung. Diese sei mit einem dreistelligen Millionenbetrag zwar ansehnlich, doch gemessen am Volumen der US-amerikanischen Filmwirtschaft, bleibe es für den deutschen Film schwer, international Anschluss zu halten. Neue Produktions- und Vertriebsformen, wie sie etwa Netflix betreibt, veränderten insgesamt die Branche. Hans Joachim Mendig, Geschäftsführer der HessenFilm und Medien GmbH, wies auf Erfolge bei der Nachwuchsförderung und beim Dokumentarfilm hin. Blockbuster-Erfolge könne man jedoch damit nicht erwarten. Was bleibt 100 Jahre nach der Gründung vom Mythos Ufa? Die Erinnerung an grandiose Fehlspekulationen ebenso wie an spektakuläre Erfolge, glaubt Filmhistoriker Elsaesser.
Zeige Inhalt von 2017 - 125 Jahre Deutsche Bank in Bayern
"Standort weiß-blau". Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde in München
Etwa 70 Gäste konnte die Historische Gesellschaft am 5. Oktober 2017 in der Kaulbach-Villa im Historischen Kolleg zur Vortragsveranstaltung "Standort weiß-blau. 125 Jahre Deutsche Bank in Bayern" begrüßen.


Was ist das Erfolgsrezept der Wirtschaft in Bayern? Und welchen Anteil hat die Deutsche Bank am ökonomischen Aufstieg des Freistaats in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg? Diesen Fragen standen im Zentrum der Veranstaltung. Zu Beginn skizzierte der Wirtschaftshistoriker Jan-Otmar Hesse, der an der Universität Bayreuth lehrt, die außergewöhnliche Entwicklung Bayerns vom Agrarstaat zum Hochtechnologiestandort. Einer der entscheidenden Faktoren sei gewesen, dass bedeutende Unternehmen wie Siemens und die Allianz infolge des Zweiten Weltkriegs von Berlin nach München umsiedelten. Staatliche Subventionen in sterbende Branchen seien in Bayern unterblieben, stattdessen habe der Freistaat die Hochschulen enorm ausgebaut und in die Forschung investiert.
Zu dieser Entwicklung trug nicht zuletzt die Deutsche Bank bei, wie der Freiburger Wirtschaftshistoriker Roman Köster unterstrich. 1892 sei sie als erste „preußische“ Bank nach München gekommen. Von ihren internationalen Geschäftsbeziehungen und ihrer Kapitalmarktkompetenz profitierten fortan die dortigen Unternehmen – denn keine der etablierten bayerischen Banken konnte damals solche Dienstleistungen anbieten. Die Münchner Fabrik Krauss lieferte beispielweise Lokomotiven für das von der Bank finanzierte Großprojekt „Bagdad-Bahn“. Mit der Gründung des Bayerischen Lloyds belebte sie die Schifffahrt auf der Donau. Als in der Nachkriegszeit bayerische Unternehmen im Ausland Tochterunternehmen gründeten, stellte die Deutsche Bank Finanzierungen über den heimischen Kapitalmarkt bereit. Bis heute begleitet sie Weltmarktführer wie das Münchener Familienunternehmen Bauer Kompressoren. Geschäftsführer Philipp Bayat betonte in der anschließenden Gesprächsrunde, wie wichtig für seine Firma der Heimatstandort Bayern sei: „Obwohl längst an vielen Orten der Welt gefertigt wird, kommt das Herzstück aller Produkte, der Kompressor, ausschließlich aus Bayern.“
Mit dem Historischen Kolleg, einem renommierten Zentrum für Geschichtswissenschaft, ist die Deutsche Bank seit dessen Gründung 1978 eng verbunden. Der spätere Vorstandssprecher Alfred Herrhausen hatte sich dafür stark gemacht und die finanziellen Mittel organisiert. Heute steht der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft, Clemens Börsig, der die Gäste in München begrüßte, an der Spitze des „Freundeskreises des Historischen Kollegs“.
Zeige Inhalt von 2017 - Carl Duisberg
 Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. April 2017 hielt der soeben in den Vorstand der Historischen Gesellschaft gewählte Frankfurter Wirtschaftshistoriker Prof. Werner Plumpe einen mit großem Beifall bedachten Vortrag über den Industriellen Carl Duisberg (1861-1935), dessen Name engstens mit der Entwicklung der chemischen Industrie in Deutschland verbunden ist. Aus Plumpes Feder ist im Herbst 2016 eine vielbeachtete Unternehmerbiographie zu Duisberg erschienen.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. April 2017 hielt der soeben in den Vorstand der Historischen Gesellschaft gewählte Frankfurter Wirtschaftshistoriker Prof. Werner Plumpe einen mit großem Beifall bedachten Vortrag über den Industriellen Carl Duisberg (1861-1935), dessen Name engstens mit der Entwicklung der chemischen Industrie in Deutschland verbunden ist. Aus Plumpes Feder ist im Herbst 2016 eine vielbeachtete Unternehmerbiographie zu Duisberg erschienen.
Zeige Inhalt von 2016 - "It's history, stupid!" (Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Historische Gesellschaft)
Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. November 2016 zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „It’s history, stupid! Zur Rückkehr der Geschichte nach der Epochenwende 1990“ in Frankfurt ein.
In seiner Begrüßung erinnerte Clemens Börsig, Erster Vorsitzender des Vorstands der Historischen Gesellschaft, an die Gründungsveranstaltung im Jahr 1991 als der fast 90-jährige Hermann Josef Abs ohne Manuskript seinen Eintritt in die Deutsche Bank schilderte. Nach einem kurzen filmischen Rückblick, der einige Höhepunkte aus 25 Jahren Historische Gesellschaft Revue passieren ließ, konnte Börsig den mehr als 300 Gästen einen hochkarätigen Kreis von Mitwirkenden vorstellen.
Als Hauptredner sprach Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz, dessen im letzten Jahr erschienene Studie „21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ große Beachtung gefunden hat. „Der Versuch, die Welt zu verwestlichen, ist gescheitert“ zitierte Rödder eingangs den Politikwissenschaftler Carlo Masala. Die nach dem Mauerfall weitverbreitete Vorstellung, dass nun das westliche Gesellschaftsmodell weltweit seinen Siegeszug antreten würde, sei mitnichten eingetroffen und so stünden wir heute „vor den Trümmern unserer Erwartungen.“ Diesen Sachverhalt legte Rödder an der Entwicklung in einzelnen Weltregionen dar und ging auch auf jüngste Ereignisse wie die US-Wahl, den Brexit und die Krisensituation im Nahen Osten ein. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass der Aufstieg der einen nicht immer automatisch den Abstieg der anderen bedeute. Die historische Bilanz eines Landes enthalte niemals ausschließlich Aktiva oder Passiva.
Beitrag von Prof. Andreas Rödder: Ein Vierteljahrhundert wird besichtigt. Eine Geschichte der Gegenwart

In der anschließenden von Jürgen Kaube, Herausgeber des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, moderierten Gesprächsrunde diskutierten Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, der Ehrenvorsitzende der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank Hilmar Kopper, Nike Wagner, Intendantin und Geschäftsführerin des Beethovenfestes Bonn, und Andreas Rödder über Themen wie Politik und Wirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung, den Stellenwert des Nationalstaats im Verhältnis zu Europa und den Siegeszug des Populismus.

Aus der Rückschau eines reichen Erfahrungsschatzes als langjähriges Mitglied des Vorstands und als Vorstandssprecher der Deutschen Bank betonte Kopper, dass die Welt kleiner geworden sei: „Was uns vor 50 Jahren noch nicht zu kümmern brauchte, muss uns heute angehen.“ Der Westen als Wertegemeinschaft, der die Nachkriegsjahrzehnte geprägt habe, existiere laut Ulrike Guérot nicht mehr. Rödder warnte hingegen davor, den eigenen nationalen Anspruch nicht zu verabsolutieren. Politisch-kulturelle Unterschiede müsse man ernst nehmen. Es gelte zunächst, das eigene Haus in Ordnung zu halten, die eigene Rechtstaatlichkeit zu bewahren, bevor versucht werde, die Entwicklung in Staaten wie Ungarn, Polen oder der Türkei von außen zu beeinflussen.
Antworten auf den Erfolg der Populisten zu finden, fiel auch dieser Runde schwer. Kopper verwies auf den Wohlstand, der in weiten Teilen Europas nie größer als heute gewesen sei, und Nike Wagner erinnerte an das Goethe-Wort „Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen“, um den Widerspruch zwischen objektivem Reichtum und subjektivem Unwohlsein in der globalisierten Welt deutlich zu machen. Einig war man sich darin, dass man denjenigen, die sich als Globalisierungsverlierer fühlten, nicht mit Herablassung und Ausgrenzung begegnen dürfe.
Im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn für gegenwärtige Szenarien musste der Historiker Rödder gleichwohl zum Abschluss konstatieren: „Leider betätigt sich die Geschichte nicht als verlässliche Lehrmeisterin, sondern gebärdet sich als kapriziöses Orakel.“

v.l.: Clemens Börsig, Jürgen Kaube, Ulrike Guérot, Hilmar Kopper, Nike Wagner, Andreas Rödder
Zeige Inhalt von 2016 - Architekten, Bankiers und ihre Villen
Auf große Resonanz stieß am 22. Juni 2016 die öffentliche Vortragsveranstaltung „Architekten, Bankiers und ihre Villen“ mit anschließendem Podiumsgespräch.

 Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte rund 280 Gäste in den Deutsche Bank-Türmen begrüßen. In seiner Einführung wies er auf daraufhin, dass sich das politische Spektrum von führenden Bankiers des späten 19. Jahrhundert auch in ihrem persönlichen Repräsentationsbedürfnis widerspiegelte. Während der konservative Chef der Disconto-Gesellschaft in den 1880er Jahren eine freistehende Doppelvilla im Berliner Tiergartenviertel bewohnte, errichtete der dem linksliberalen Lager zuzurechnende Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg von Siemens zur gleichen Zeit ein weitläufiges Mietshaus, das er in einer Art gründerzeitlichen „Wohngemeinschaft“ mit Verwandten und Freunden bewohnte.
Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte rund 280 Gäste in den Deutsche Bank-Türmen begrüßen. In seiner Einführung wies er auf daraufhin, dass sich das politische Spektrum von führenden Bankiers des späten 19. Jahrhundert auch in ihrem persönlichen Repräsentationsbedürfnis widerspiegelte. Während der konservative Chef der Disconto-Gesellschaft in den 1880er Jahren eine freistehende Doppelvilla im Berliner Tiergartenviertel bewohnte, errichtete der dem linksliberalen Lager zuzurechnende Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg von Siemens zur gleichen Zeit ein weitläufiges Mietshaus, das er in einer Art gründerzeitlichen „Wohngemeinschaft“ mit Verwandten und Freunden bewohnte.
 Zwei Zeiträume, die Jahre um 1800 und die Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg, identifizierte die an der Frankfurter Goethe-Universität lehrende Soziologin Marianne Rodenstein als besonders prägende Zeit für den Bau von Bankiersvillen, den sie an Beispielen aus Hamburg, Frankfurt und Berlin beschrieb. Gerade Hamburg kam durch seine Verbindungen zu England eine Schlüsselrolle zu. An der Elbe, inmitten großer Gartenanlagen, wurden die ersten Villen nach englischem Vorbild für Bankiers erbaut. Im Unterschied zu Künstler- oder Fabrikantenvillen habe die Bankiersvilla allerdings keinen eigenständigen Typus hervorgebracht. Die Bankiersvilla zeichnete sich dadurch aus, dass ihr Bauherr oder Bewohner ein wohlhabender Bankier war.
Zwei Zeiträume, die Jahre um 1800 und die Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg, identifizierte die an der Frankfurter Goethe-Universität lehrende Soziologin Marianne Rodenstein als besonders prägende Zeit für den Bau von Bankiersvillen, den sie an Beispielen aus Hamburg, Frankfurt und Berlin beschrieb. Gerade Hamburg kam durch seine Verbindungen zu England eine Schlüsselrolle zu. An der Elbe, inmitten großer Gartenanlagen, wurden die ersten Villen nach englischem Vorbild für Bankiers erbaut. Im Unterschied zu Künstler- oder Fabrikantenvillen habe die Bankiersvilla allerdings keinen eigenständigen Typus hervorgebracht. Die Bankiersvilla zeichnete sich dadurch aus, dass ihr Bauherr oder Bewohner ein wohlhabender Bankier war.
 Volker M. Welter, Architekturhistoriker an der University of California in Santa Barbara, stellte in seinem Beitrag „Moderne Architekten, traditionelle Bauherren“ die 1928-30 von Ernst L. Freud in Geltow errichtete Villa Frank bei Potsdam in den Mittelpunkt. Das im Stil der neuen Sachlichkeit erbaute Landhaus entwarf der Sohn des Psychoanalytikers Sigmund Freud für Theodor Frank, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft von 1929 bis 1933.
Volker M. Welter, Architekturhistoriker an der University of California in Santa Barbara, stellte in seinem Beitrag „Moderne Architekten, traditionelle Bauherren“ die 1928-30 von Ernst L. Freud in Geltow errichtete Villa Frank bei Potsdam in den Mittelpunkt. Das im Stil der neuen Sachlichkeit erbaute Landhaus entwarf der Sohn des Psychoanalytikers Sigmund Freud für Theodor Frank, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft von 1929 bis 1933.
In seiner 2014 erschienenen Publikation "Ernst L. Freud und das Landhaus Frank" sind seine Erkenntnisse zu diesem ungewöhnlichen Bauprojekt nachzulesen.
 Im anschließenden Podiumsgespräch, das der frühere stellvertretende Direktor des Deutschen Architekturmuseums Wolfgang Voigt moderierte, konnte die Frankfurter Architektin Marie-Theres Deutsch aus ihrer Praxis beim zeitgenössischen Bau anspruchsvoller Wohnformen berichten, etwa im neuen Frankfurter Stadtteil Riedberg. Hans-Hermann Reschke, langjähriger persönlich haftender Gesellschafter bei B. Metzler seel. Sohn & Co., war es schließlich vorbehalten, dem Publikum einige interessante Einblicke zur Bedeutung der Bankiersvilla als privatem, gesellschaftlichem und geschäftlichen Schauplatz zu gewähren.
Im anschließenden Podiumsgespräch, das der frühere stellvertretende Direktor des Deutschen Architekturmuseums Wolfgang Voigt moderierte, konnte die Frankfurter Architektin Marie-Theres Deutsch aus ihrer Praxis beim zeitgenössischen Bau anspruchsvoller Wohnformen berichten, etwa im neuen Frankfurter Stadtteil Riedberg. Hans-Hermann Reschke, langjähriger persönlich haftender Gesellschafter bei B. Metzler seel. Sohn & Co., war es schließlich vorbehalten, dem Publikum einige interessante Einblicke zur Bedeutung der Bankiersvilla als privatem, gesellschaftlichem und geschäftlichen Schauplatz zu gewähren.
Zeige Inhalt von 2016 - Die Fed vor den Krisen von 1929 und 2007
Vortrag "Die U.S. Federal Reserve Bank vor den Krisen von 1929 und 2007"

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 23. Mai 2016, hielt Vorstandsmitglied Prof. Volker Berghahn, der an der Columbia University in New York Geschichte lehrt, einen Vortrag zur Rolle der amerikanischen Federal Reserve Bank vor den großen Wirtschaftskrisen von 1929 und 2007.
Vortrag Volker Berghahn "Die U.S. Federal Reserve Bank vor den Krisen von 1929 und 2007"
Zeige Inhalt von 2015 - 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern
Vereint. 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern - Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde

Ein Vierteljahrhundert deutsche Einheit nahm die Historische Gesellschaft zum Anlass, ihre Vortragsveranstaltung 2015 unter den Titel „Vereint – 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern“ zu stellen. Im Blickpunkt standen dabei vor allem die finanzwirtschaftlichen Aspekte im Einigungsprozess und die Aufbauleistung in den neuen Ländern, an die auch die gleichnamige im Juni erschienene Publikation erinnert.
Zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen eines mehrtägigen Bürgerfests in Frankfurt in Erinnerung an die Wiedervereinigung stattfand, konnte Michael Münch, Geschäftsführender Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, am 2. Oktober 2015 rund 250 Gäste in den Türmen der Deutschen Bank begrüßen. Zum Auftakt wurden die Besucher mit einem Kurzfilm auf das Thema emotional eingestimmt.

Professor Karl-Heinz Paqué, ehemaliger Finanzminister von Sachsen-Anhalt und heute Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Otto-von Guericke-Universität in Magdeburg, zog mit dem Vortrag „Von der Plan- zur Marktwirtschaft" eine Bilanz nach 25 Jahren Wiedervereinigung. Faktenreich und prononciert dargelegt, kam Paqué in seinem Beitrag zu dem Schluss, dass die deutsche Einheit auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte ist und nach schweren Jahren der Transformation in den neunziger Jahren heute nichts mehr an die sozialistische Planwirtschaft der Vergangenheit erinnere. Es gebe längst eine moderne Industrie, die technisch hochwertige Güter produziere, ein breites Spektrum an professionellen Dienstleistungen sowie eine Agrarwirtschaft mit hoher Wettbewerbsfähigkeit. Infrastruktur, Bildungsangebot und Verwaltung seien auf gleichem Niveau wie im Westen.Gleichzeitig wies er auf den immer noch vorhandenen Rückstand der Produktivität und der Innovationskraft. Während die großen Forschungszentren der Industrie nach wie vor im Westen lägen, fungiere der Osten oftmals noch als ‚verlängerte Werkbank‘, wo im Rahmen des Möglichen zwar beste Wertarbeit geleistet werde, aber die großen innovativen Durchbrüche noch eher selten seien.


Unter der Leitung von Fernsehmoderatorin Corinna Wohlfeil berichteten in der anschließenden Gesprächsrunde Führungskräfte und Mitarbeiter der Bank, die den Geschäftsaufbau in den neuen Ländern wesentlich vorangetrieben haben, über ihre Erfahrungen:




Georg Krupp, Vorstandsmitglied von 1985 bis 1998 und damals für Osteuropa und das Privatkundengeschäft zuständig, Wolfgang Kellert, 1990 Vorstandsmitglied der Deutsche Bank-Kreditbank AG und später Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Leipzig, Birgit Krüger, die 1990 von der Staatsbank der DDR kam und heute das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank im Marktgebiet Rostock/Neubrandenburg verantwortet, sowie Rüdiger Wrede, der am Tag der Währungsunion als Filialleiter der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz den Ansturm Tausender DDR-Bürger zu bewältigen hatte, die bereits um Mitternacht D-Mark eintauschen wollten.


Auch das Publikum beteiligte sich mit substantiellen Wortbeiträgen, etwa Hilmar Kopper, 1990 amtierender Vorstandssprecher der Deutschen Bank sowie Ulrich Weiss, der als Personaldezernent großen Anteil am Aufbau der Filialen in den neuen Ländern hatte.

Aus Weimar angereist waren vier Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, die das Publikum mit zwei Sätzen aus dem Streichquartett g-Moll op. 27 von Edvard Grieg künstlerisch durch das Programm begleiteten. Das Musikgymnasium Schloss Belvedere ist ein seit 1995 bestehendes Kulturengagement der Deutschen Bank in den neuen Bundesländern.
Zeige Inhalt von 2014 - Wirtschaft und Politik im Ersten Weltkrieg
"Alles Denken ist durch den großen Krieg beherrscht" - Vortragsveranstaltung und Podiumsdiskussion
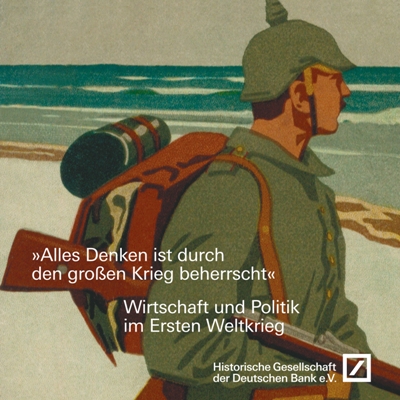

Mehr als 200 Teilnehmer folgten der Einladung der Historischen Gesellschaft zu einer Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion am 21. Oktober 2014 in Frankfurt, die die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Wirtschaft beleuchtete. Der Erste Vorsitzende Clemens Börsig betonte in seinen einleitenden Worten die einschneidende Zäsur, die der Kriegsbeginn für die damalige Weltwirtschaft und insbesondere für die international tätigen Banken bedeutete.
Allein bei der Deutschen Bank wurden von 8500 Mitarbeitern 2500 zum Kriegsdienst eingezogen, von denen 1023 nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten (siehe zu diesem Thema auch Historische Rundschau 2014/1 "Bankangestellte im Ersten Weltkrieg"). Annika Mombauer, Historikerin an der Open University in Milton Keynes, legte eingangs die deutschen Zukunftsvisionen in der Vorkriegszeit dar. Inwieweit diese Pläne kriegsauslösend waren, wird seit dem Erscheinen von Christopher Clarks vielbeachtetem Buch „Die Schlafwandler“ wieder sehr kontrovers diskutiert. Mombauer konstatierte, dass bei allen Großmächten eine gefährliche Mischung aus Überheblichkeit des eigenen Militärs, der Furcht vor dem Machtzuwachs der anderen Seite und der Sorge um die Zuverlässigkeit der Verbündeten geherrscht habe. Die Hauptverantwortung für die Eskalation sah sie aber bei der politischen und militärischen Führung in Deutschland. „Für die deutschen Industriellen bedeutete der Krieg in erster Linie ein wirtschaftliches Desaster, das Deutschland in seiner kommerziellen Entwicklung um 50 Jahre zurückwarf“, befand Mombauer.
Annika Mombauer, Historikerin an der Open University in Milton Keynes, legte eingangs die deutschen Zukunftsvisionen in der Vorkriegszeit dar. Inwieweit diese Pläne kriegsauslösend waren, wird seit dem Erscheinen von Christopher Clarks vielbeachtetem Buch „Die Schlafwandler“ wieder sehr kontrovers diskutiert. Mombauer konstatierte, dass bei allen Großmächten eine gefährliche Mischung aus Überheblichkeit des eigenen Militärs, der Furcht vor dem Machtzuwachs der anderen Seite und der Sorge um die Zuverlässigkeit der Verbündeten geherrscht habe. Die Hauptverantwortung für die Eskalation sah sie aber bei der politischen und militärischen Führung in Deutschland. „Für die deutschen Industriellen bedeutete der Krieg in erster Linie ein wirtschaftliches Desaster, das Deutschland in seiner kommerziellen Entwicklung um 50 Jahre zurückwarf“, befand Mombauer. Boris Barth, der als Professor am Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Universität Konstanz lehrt, setzte sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie gut die Banken der einzelnen Kriegsnationen auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet waren. Mit Hinweis auf den Zusammenbruch der Londoner Börse am 31. Juli 1914 konstatierte Barth, dass das deutsche Finanzwesen die Herausforderungen des Krieges damals wesentlich besser einschätzte als ihr französisches und britisches Pendant. Grund hierfür seien die engen Kontakte der deutschen Banken zur Regierung gewesen, durch den sie bei Kriegsbeginn einen entscheidenden Informationsvorsprung erlangten und auf die Krisensituation entsprechend vorbereitet waren.
Boris Barth, der als Professor am Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Universität Konstanz lehrt, setzte sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie gut die Banken der einzelnen Kriegsnationen auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet waren. Mit Hinweis auf den Zusammenbruch der Londoner Börse am 31. Juli 1914 konstatierte Barth, dass das deutsche Finanzwesen die Herausforderungen des Krieges damals wesentlich besser einschätzte als ihr französisches und britisches Pendant. Grund hierfür seien die engen Kontakte der deutschen Banken zur Regierung gewesen, durch den sie bei Kriegsbeginn einen entscheidenden Informationsvorsprung erlangten und auf die Krisensituation entsprechend vorbereitet waren.  Volker Berghahn, Professor am Department of History der New Yorker Columbia University ging in seinem Beitrag auf die Rolle der Siegermacht USA beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Europas ein. Die Vereinigten Staaten hätten vor der Entscheidung gestanden, ob sie Europa mit großzügigen Krediten beim Wiederaufbau und der Modernisierung der Industrie unterstützen wollen oder ob sie die Reparationskosten den Verlierermächten überlassen sollten. Führende US-Bankiers sprachen sich für ersteren Weg aus, Amerikas Politik und die dortige öffentliche Meinung aber tendierten zur "splendid isolation". Die Kredithilfe für Europa blieb damals aus.
Volker Berghahn, Professor am Department of History der New Yorker Columbia University ging in seinem Beitrag auf die Rolle der Siegermacht USA beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Europas ein. Die Vereinigten Staaten hätten vor der Entscheidung gestanden, ob sie Europa mit großzügigen Krediten beim Wiederaufbau und der Modernisierung der Industrie unterstützen wollen oder ob sie die Reparationskosten den Verlierermächten überlassen sollten. Führende US-Bankiers sprachen sich für ersteren Weg aus, Amerikas Politik und die dortige öffentliche Meinung aber tendierten zur "splendid isolation". Die Kredithilfe für Europa blieb damals aus. In der abschließenden Podiumsdiskussion, die der FAZ-Politikredakteur Rainer Blasius moderierte, wurde die Frage nach der Verantwortung der USA für den Wiederaufbau der Wirtschaft Europas nach Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die amerikanische Gesellschaft aus den Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg gelernt habe. Volker Berghahn resümierte: "Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die USA wieder als Sieger hervor, nur entschieden sie sich dieses Mal für den Weg, die europäische Industrie wieder aufzubauen und Deutschland auf diese Weise in ein friedliches Europa zu integrieren. Mit Erfolg, wie wir heute wissen."
In der abschließenden Podiumsdiskussion, die der FAZ-Politikredakteur Rainer Blasius moderierte, wurde die Frage nach der Verantwortung der USA für den Wiederaufbau der Wirtschaft Europas nach Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die amerikanische Gesellschaft aus den Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg gelernt habe. Volker Berghahn resümierte: "Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die USA wieder als Sieger hervor, nur entschieden sie sich dieses Mal für den Weg, die europäische Industrie wieder aufzubauen und Deutschland auf diese Weise in ein friedliches Europa zu integrieren. Mit Erfolg, wie wir heute wissen."
Zeige Inhalt von 2014 - Franz Urbig
Franz Urbig - Aus dem Leben eines deutschen Bankiers. Vortragsveranstaltung und Lesung zum 150. Geburtstag
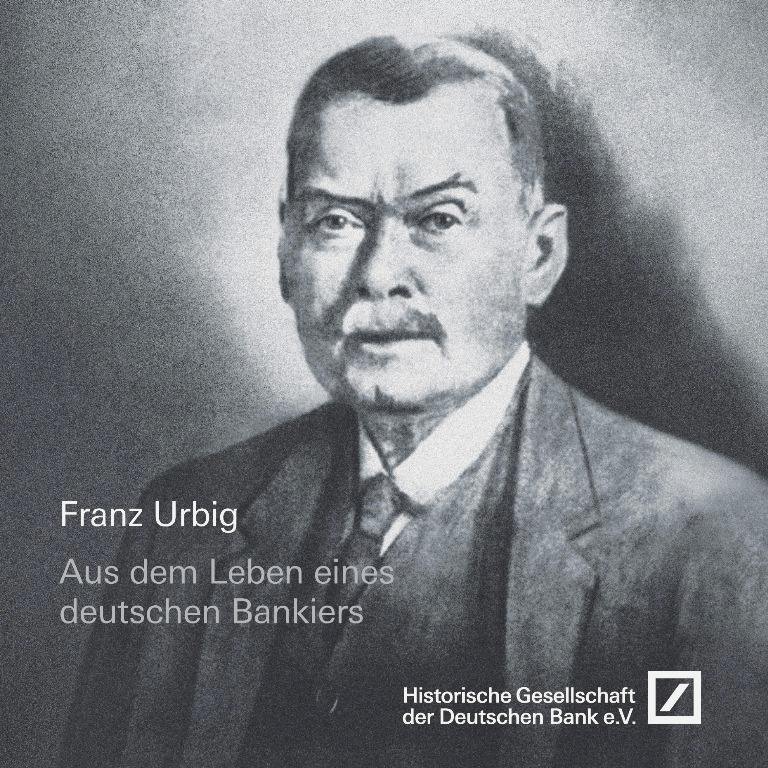
Am 23. Januar 1864 wurde der bedeutende Bankier Franz Urbig geboren. Von 1902 bis 1929 war er einer der persönlich haftenden Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft und nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank von 1930 bis 1942 Vorsitzender des Aufsichtsrats des vereinten Instituts.
Anlässlich seines 150. Geburtstages lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. Januar 2014 zu einer Vortragsveranstaltung und Lesung in Frankfurt ein.
Zeitgleich hat die Historische Gesellschaft Urbigs farbige Schilderung seiner frühen Berufszeit in Berlin und Ostasien als Druck und als Hörbuch herausgegeben.
Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte unter den rund 150 Teilnehmern auch mehrere Nachkommen Franz Urbigs persönlich begrüßen. In seiner Einführung gab er einen Überblick zur beruflichen Karriere Urbigs, der sich aus einfachen Verhältnissen bis an die Spitze der deutschen Finanzwirtschaft emporarbeitete.
Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, Lehrstuhlinhaber an der Goethe-Universität Frankfurt, beschrieb mit einem Referat über "Unternehmer und Politik im Kaiserreich und der Weimarer Republik" das wirtschaftliche und politische Umfeld in welchem Franz Urbig agierte. Plumpe charakterisierte Urbig als Unternehmer der Generation der „Wilhelminer“, die in den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg die deutsche Wirtschaft lenkte. Als weitere Vertreter dieser Generation nannte er u.a.Robert Bosch und Walther Rathenau. Der Staat habe in dieser Phase großen Wachstums und rascher Internationalisierung kaum Einfluss auf die Wirtschaft genommen. Entsprechend schwer sei es Unternehmern und Bankiers wie Franz Urbig gefallen, die Eingriffe der Weimarer Republik in das wirtschaftliche Geschehen zu akzeptieren.
Peter Schröder, Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, trug mehrere Episoden aus den Erinnerungen Franz Urbigs an seine Berufszeit vor - sowohl aus dessen frühen Berliner Jahren als auch aus seiner Zeit bei der Deutsch-Asiatischen Bank in China - und vermittelte dem Publikum einen lebendigen Eindruck von der Persönlichkeit des Bankiers. Auch für das jetzt veröffentlichte Hörbuch lieh Schröder Franz Urbig seine Stimme.



v.l.n.r. Peter Schröder (Schauspiel Frankfurt), Werner Plumpe (Goethe-Universität), Andreas Gericke (Enkel von Franz Urbig), Daniel Kloepfer (Urenkel von Franz Urbig), Clemens Börsig (Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft)
Zeige Inhalt von 2013 - Gründerkrise und Antisemitismus
Vortrag „Der Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus“
Der amerikanische Historiker Jonathan Steinberg sprach in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt vor 250 Gästen über den Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus. Der Vortrag gehört zum Begleitprogramm der aktuellen Ausstellung „Juden. Geld. Eine Vorstellung“ des Jüdischen Museums Frankfurt.
Professor Steinberg, der an der University of Pennsylvania lehrt, ist der Geschichte der Deutschen Bank seit vielen Jahren zugetan. Er gehörte dem Beraterkreis für das Buch zum 125-jährigen Jubiläum der Deutschen Bank an und er war Mitglied der Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte der Deutschen Bank während der NS-Zeit. Der erschütternde Bericht über die Goldtransaktionen der Bank während des Zweiten Weltkrieges stammt von ihm. Zuletzt hat er eine vielbeachtete Bismarck-Biografie vorgelegt.
Jonathan Steinberg, Der Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus - Redemanuskript Jonathan Steinberg
Zeige Inhalt von 2013 - City of London und Deutsche Bank
Vortragsveranstaltung mit Lesungen und Podiumsdiskussion zum Thema
"Die City of London und die Deutsche Bank"
Aus Anlass des 140jährigen Jubiläums der Deutschen Bank in London lud die Historische Gesellschaft am 10. Juni 2013 zu einer Vortragsveranstaltung in Frankfurt ein, an der mehr als 300 Gäste teilnahmen.

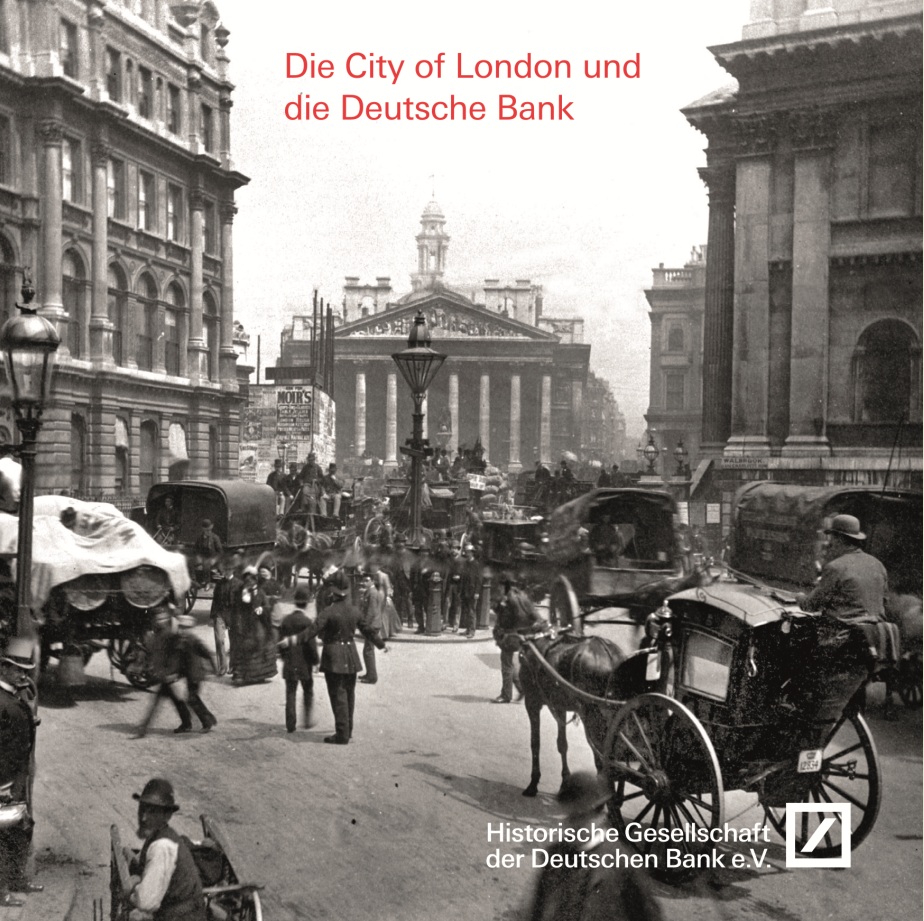
In seiner Begrüßungsrede skizzierte Clemens Börsig, Erster Vorsitzenden der Historischen Gesellschaft, den Aufbau der Präsenz der Bank in der britischen Hauptstadt.
Ein kurzer Film bot Einblicke in die Gründung der Niederlassung im Jahr 1873. Die Londoner Filiale war die erste europäische Auslandsniederlassung, nachdem im Jahr davor schon in China und Japan Filialen eröffnet worden waren. Sie entwickelte sich bald zur wirtschaftlich erfolgreichsten Niederlassung außerhalb Deutschlands. Ihre Domäne wurde das internationale Geschäft mit Handelswechseln. Außerdem spielte der Devisen- und Edelmetallhandel eine wichtige Rolle. Im August 1914 bereitete der Beginn des Ersten Weltkrieges der prosperierenden Filiale ein plötzliches Ende. Die Banken der Kriegsgegner Großbritanniens kamen unter Zwangsverwaltung. Die komplizierte Liquidation der Niederlassung zog sich noch bis 1928 hin. In der Zwischenkriegszeit und den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bank nicht in London vertreten. Erst 1973, genau 100 Jahre nach der Eröffnung der ersten Filiale, kehrte die Deutsche Bank mit einer Repräsentanz in die City zurück. Drei Jahre später wurde sie in eine geschäftsfähige Filiale umgewandelt. Ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau ihrer Präsenz in der britischen Hauptstadt gelang der Deutschen Bank 1989 mit der Akquisition der traditionsreichen Merchant Bank Morgan Grenfell. Im Winchester House fanden 1999 die in London konzentrierten Geschäftseinheiten ein neues Domizil – es liegt nur einen Steinwurf von der Old Broad Street entfernt, wo 1873 alles begann.

Über Gegenwart und Zukunftsperspektiven der Deutschen Bank in London sprach Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG. Er beschrieb die schwierige Situation am Standort London nach der Finanzkrise.
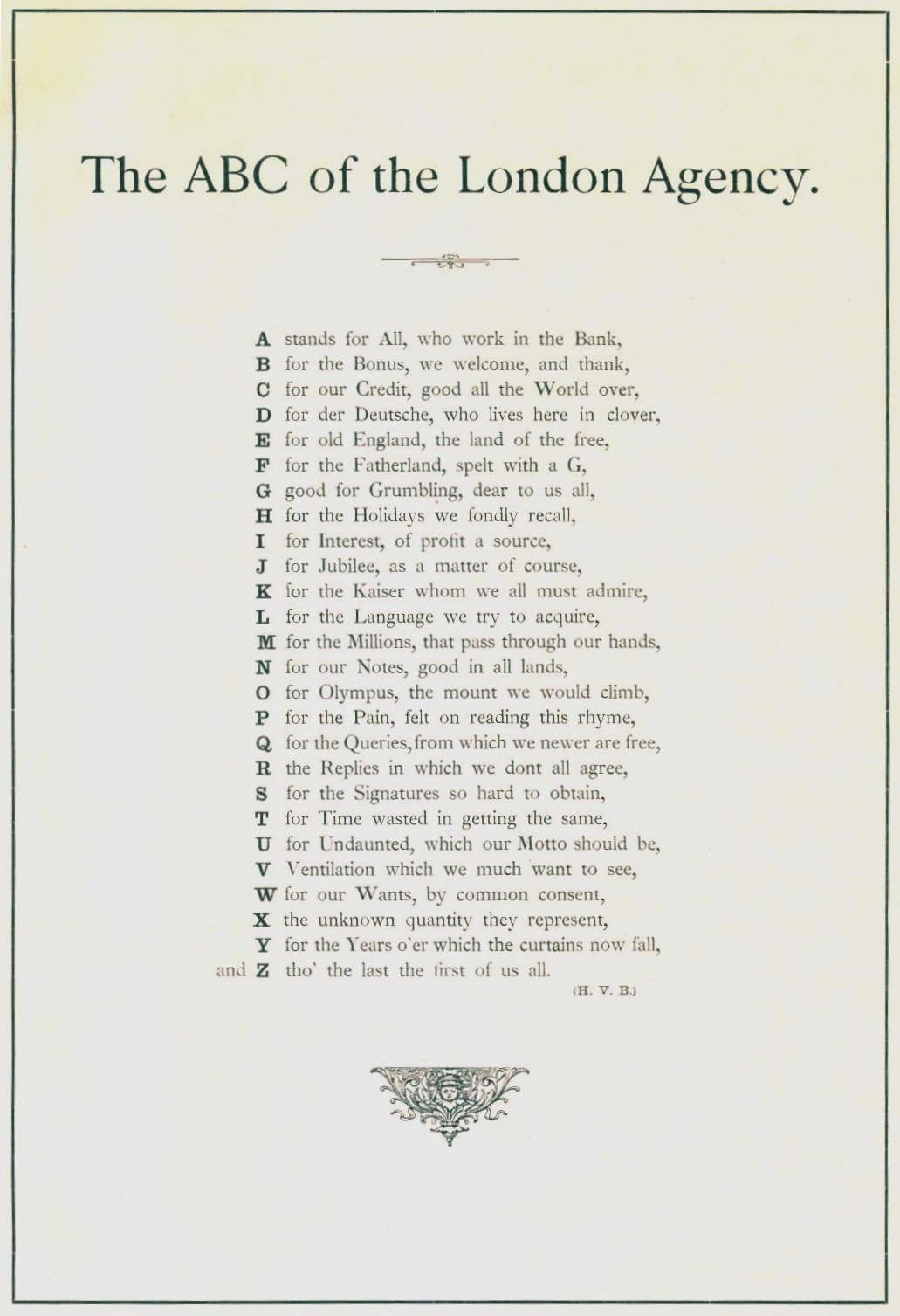
Im Anschluss lasen die beiden Schauspieler Sinead Kennedy und Thomas Huber aus historischen Dokumenten, u.a. das „ABC of the London Agency“ von 1895.
Die zwei Gesichter der Londoner City: das des modernen Finanzplatzes und das einer pittoresk archaischen Lokalverwaltung beschrieb der Historiker Prof. Andreas Fahrmeir von Goethe-Universität Frankfurt in seinem Vortrag "Ehrbare Spekulanten. Die City of London und ihre Akteure vor dem Ersten Weltkrieg".

Podiumsdiskussion mit Markus A. Will, Jürgen Fitschen, Lord Aldington, Andreas Fahrmeir, Reinhard H. Schmidt (v.l.n.r.)
Dr. Markus A. Will , von 1996 bis 1998 Pressesprecher der Deutschen Morgan Grenfell, heute Hochschuldozent und Unternehmensberater, moderierte die lebhafte Diskussion, an der neben Jürgen Fitschen und Prof. Fahrmeir, auch der frühere Chef der Deutschen Bank in London Lord Aldington und der Finanzwissenschaftler Prof. Reinhard H. Schmidt, Goethe-Universität Frankfurt, teilnahmen. Titel: "London - ein Abonnement zur Weltfinanzhauptstadt." Dabei wurde unter anderem erörtert, welche Voraussetzungen einen guten Finanzplatz ausmachen. Durch seine offene Haltung gegenüber ausländischen Anlegern, seine liberale Verfassung und vielen günstigen strukturellen Vorgaben hätte der Standort London sich seine Vormachtstellung bislang erhalten können war die übereinstimmende Meinung der Runde. Auf die spannende Schlussfrage welche Standorte wohl in Zukunft ebenfalls an der Weltspitze stehen könnten, gab es erwartungsgemäß unterschiedliche Einschätzungen. Außerhalb der europäisch-amerikanischen Sphäre wurden die Finanzplätze Singapur, Shanghai und Hongkong genannt.
Zum Abschluss der Veranstaltung zog Jürgen Fitschen die Gewinner der Werbeaktion "2000. Mitglied der Historischen Gesellschaft". Preis: Eine Wochenendreise nach Florenz einschließlich eines Besuchs der Villa Romana (ältestes Kulturengagement der Deutschen Bank).
Zeige Inhalt von 2012 - Deutsche Bank in Lateinamerika
Vortragsveranstaltung mit Lesung und Podiumsdiskussion zu "125 Jahre Deutsche Bank in Lateinamerika"
Zu dieser Veranstaltung am 3. September 2012 in den Türmen der Deutschen Bank in Frankfurt konnte die Historische Gesellschaft mehr als 300 Gäste begrüßen.

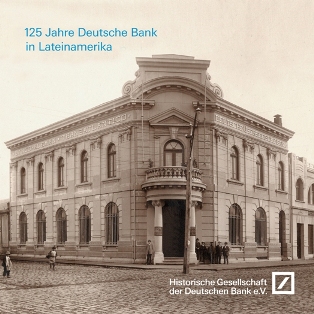
Bereits 1887 wurde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die erste Niederlassung der Deutschen Bank in Lateinamerika eröffnet. Filialen in Chile, Brasilien, Mexiko und Peru kamen bald hinzu. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Lateinamerika seine Bedeutung als wichtigster Standort der Deutschen Bank ausbauen konnte und 2011 in der regionalen Management-Struktur der Deutschen Bank zu einer eigenständigen Region innerhalb des Konzerns aufgewertet wurde.

Nach der Begrüßung durch Dr. Clemens Börsig sprach Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG, über Gegenwart und Zukunftsperspektiven der Deutschen Bank in Lateinamerika. 
Ein Beitrag von Prof. Thomas Fischer (Universität Eichstätt-Ingolstadt) beschäftigte sich mit Lateinamerika im Prozess der Globalisierung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

An einer von Claus Döring (Börsen-Zeitung) moderierten Podiumsdiskussion zur Fragestellung "Lateinamerika - ein Kontinent im wirtschaftlichen Aufbruch?" nahmen der chilenische Botschafter in Deutschland Jorge O’Ryan Schütz, Georg Daschner (Münchener Rück), Bodo Liesenfeld (Lateinamerika Verein) und Peter Tils (Deutsche Bank) teil.

Abgerundet wurde das Programm durch eine Lesung (Felix von Manteuffel, Schauspiel Frankfurt) aus Reisebriefen von Ernst Enno Russell und Paul Wallich sowie einem kurzen Film über die historische Entwicklung der Bank in der Region.
Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der ersten Geschäftseröffnung in Buenos Aires ist der reich illustrierte Bildband "Woven in - 125 years of Deutsche Bank in Latin America" erschienen, der die enge Verflechtung der Deutschen Bank mit dieser Region veranschaulicht.
Zeige Inhalt von 2012 - Symposium über Georg Solmssen
Der „Rheinische Kapitalismus" - ein Modell mit Zukunft? Symposium über Georg Solmssen
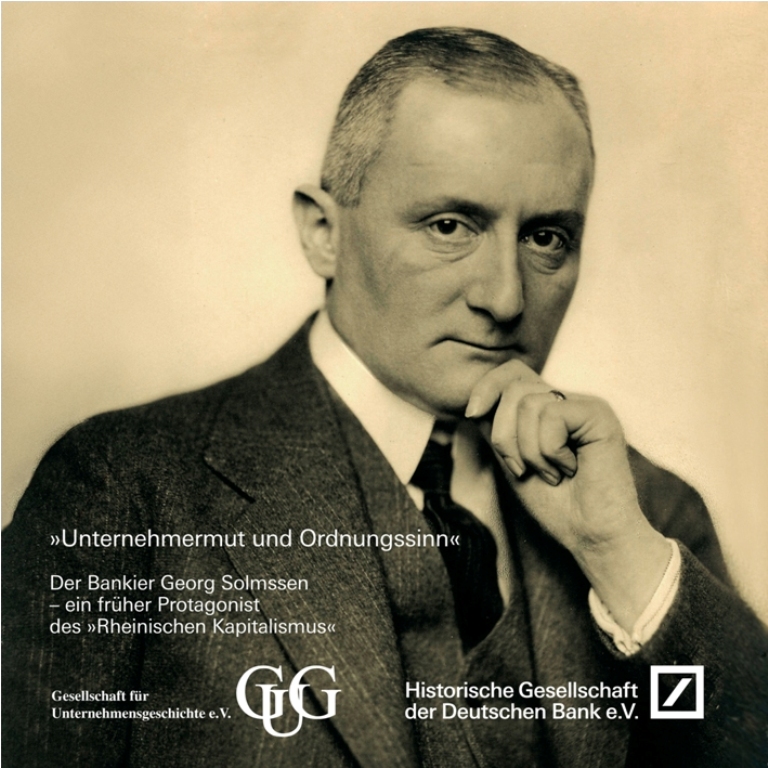 „Rheinischer Kapitalismus“, „Deutschland AG“, „Soziale Marktwirtschaft“ – verschiedene Begriffe für ein ähnliches Phänomen. Was kennzeichnet ihn, den deutschen Sonderweg des Kapitalismus? Gerade vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Europa und der Rolle Deutschlands bei deren Bekämpfung ein aktuelles Thema.
„Rheinischer Kapitalismus“, „Deutschland AG“, „Soziale Marktwirtschaft“ – verschiedene Begriffe für ein ähnliches Phänomen. Was kennzeichnet ihn, den deutschen Sonderweg des Kapitalismus? Gerade vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Europa und der Rolle Deutschlands bei deren Bekämpfung ein aktuelles Thema.
Georg Solmssen (1869-1957), Vorstandssprecher der Deutschen Bank in den Jahren 1933/34, gilt als ein früher Vertreter des sogenannten Rheinischen Kapitalismus, der als koordinierte Form der Marktwirtschaft vor allem die frühe Bundesrepublik prägte.
Anlässlich einer soeben erschienenen, umfangreichen Edition der Briefe Georg Solmssens veranstaltete die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank gemeinsam mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte am 19. März 2012 ein Symposium unter dem Titel:
„Unternehmermut und Ordnungssinn“ Der Bankier Georg Solmssen – ein früher Protagonist des Rheinischen Kapitalismus.
Vor über 200 Besuchern in den Deutsche Bank-Türmen skizzierte Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, in seiner Einführung Solmssens als einflussreichen deutschen Bankier jüdischer Herkunft, der ausgerechnet in den schwersten Krisenjahren, die Deutschland im 20. Jahrhundert erlebte, auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand.
Einen Eindruck von Solmssens wirtschaftlicher und politischer Bedeutung und dem hohen sprachlichen Niveau seiner Korrespondenz vermittelte die Lesung einiger ausgewählter Briefe. Peter Schröder, Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, gab Solmssen an diesem Abend seine Stimme.
Harold James, Professor am Department of History der Princeton University und Mitherausgeber der Briefedition, unternahm eine biographische Annäherung und beschrieb Solmssens Werdegang im Kaiserreich, der Weimarer Republik und im beginnenden Nationalsozialismus. Er charakterisierte Solmssen als Vertreter des typischsten Geschäftsfelds der traditionellen deutschen Universalbank: die Industriefinanzierung durch Bankkredite und die Emission von Aktien und Anleihen.
In der anschließenden Podiumsdiskussion gingen neben Clemens Börsig und Harold James, Volker Berghahn, Professor für Geschichte an der Columbia University und Rolf Nonnenmacher, Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, der Frage nach, welche Aspekte des „Rheinischen Kapitalismus“ bereits verschwunden oder überholt sind und welche weiterhin eine Stärke des Wirtschaftsstandorts ausmachen. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Gerald Braunberger, Leiter des „Finanzmarkts“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Das Buch „Georg Solmssen - Ein deutscher Bankier. Briefe aus einem halben Jahrhundert 1900-1956, München 2012, 645 S.“ ist hier erhältlich. Mitglieder der Gesellschaft bekommen ein kostenloses Exemplar.
Zeige Inhalt von 2011 - Geist und Geld
Geist und Geld - Ein literarisch-musikalischer Streifzug
 Unter dem Titel "Geist und Geld – Ein literarisch-musikalischer Streifzug" lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. April 2011 in den Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt am Main ein. Anhand unterhaltsamer Texte von Shakespeare, Molière, Heine, Thomas Mann bis hin zu Hans Magnus Enzensberger wurde den rund 300 Gästen das Thema Geld in der Literatur vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch Beispiele aus der Musikliteratur, in der das Thema "Geld" ebenfalls eine Rolle spielt. Hier reichte das Spektrum von "Fidelio" bis zu "Cabaret". Als Vortragende konnten für diese Veranstaltung der Charakterdarsteller Christian Redl sowie Sängerinnen und Sänger der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main gewonnen werden. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, eröffnete die Veranstaltung. Die Moderation und die Einführung in das Thema gestaltete der ehemalige Leiter des Insel Verlags Hans-Joachim Simm.
Unter dem Titel "Geist und Geld – Ein literarisch-musikalischer Streifzug" lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. April 2011 in den Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt am Main ein. Anhand unterhaltsamer Texte von Shakespeare, Molière, Heine, Thomas Mann bis hin zu Hans Magnus Enzensberger wurde den rund 300 Gästen das Thema Geld in der Literatur vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch Beispiele aus der Musikliteratur, in der das Thema "Geld" ebenfalls eine Rolle spielt. Hier reichte das Spektrum von "Fidelio" bis zu "Cabaret". Als Vortragende konnten für diese Veranstaltung der Charakterdarsteller Christian Redl sowie Sängerinnen und Sänger der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main gewonnen werden. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, eröffnete die Veranstaltung. Die Moderation und die Einführung in das Thema gestaltete der ehemalige Leiter des Insel Verlags Hans-Joachim Simm.
Zeige Inhalt von 2010 - Max von Oppenheim
Max von Oppenheim – Diplomat, Archäologe, Forschungsreisender
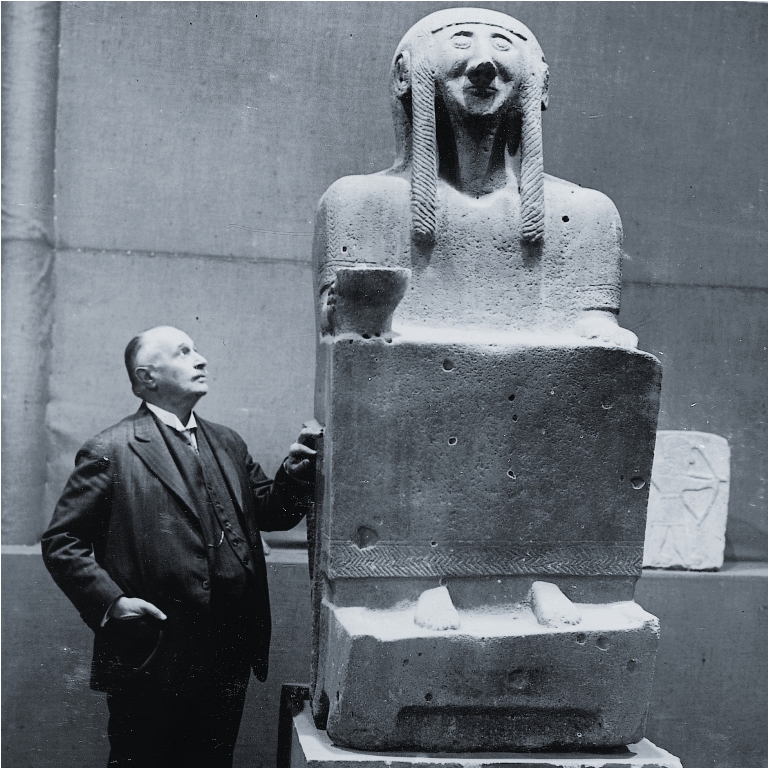 Das abenteuerliche Leben Max von Oppenheims (1860-1946), Spross der bekannten Kölner Bankiersfamilie, steht dem seines ungleich berühmteren Vorbildes Heinrich Schliemann in nichts nach. Den Archäologen, Entdeckungsreisenden, Berater zur wirtschaftlichen Nutzung der Bagdadbahn, Beduinenforscher und Diplomaten, der im Ersten Weltkrieg zum Gegenspieler von Lawrence von Arabien wurde, stellte die Historische Gesellschaft am 17. Juni 2010 in den Mittelpunkt einer Vortragsveranstaltung im Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt am Main. Nach Dr. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG und Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte Gabriele Teichmann, Leiterin des Hausarchivs des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, die rund 250 Gäste.
Das abenteuerliche Leben Max von Oppenheims (1860-1946), Spross der bekannten Kölner Bankiersfamilie, steht dem seines ungleich berühmteren Vorbildes Heinrich Schliemann in nichts nach. Den Archäologen, Entdeckungsreisenden, Berater zur wirtschaftlichen Nutzung der Bagdadbahn, Beduinenforscher und Diplomaten, der im Ersten Weltkrieg zum Gegenspieler von Lawrence von Arabien wurde, stellte die Historische Gesellschaft am 17. Juni 2010 in den Mittelpunkt einer Vortragsveranstaltung im Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt am Main. Nach Dr. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG und Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte Gabriele Teichmann, Leiterin des Hausarchivs des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, die rund 250 Gäste.
Im Anschluss referierten:
Professor Dr. Gregor Schöllgen, Direktor des Zentrums für Angewandte Geschichte, Universität Erlangen „Per Bahn bis Bagdad. Was wollten die Deutschen im Orient?“ - Redemanuskript
Dr. Martin Kröger, Referent im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin „Max von Oppenheim im Auswärtigen Dienst“ - Redemanuskript
Dr. Lutz Martin, Archäologe am Vorderasiatischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin „Die Entdeckung des Tell Halaf“
Dr. Nadja Cholidis, Archäologin am Vorderasiatischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin "Kopf hoch! Mut hoch! Und Humor hoch! – Wie aus 27.000 Bruchstücken wieder Bildwerke wurden"
Zeige Inhalt von 2009 - Symposium über Wilfried Guth
Die Verantwortung der Wirtschaft - Symposium in Erinnerung an Wilfried Guth
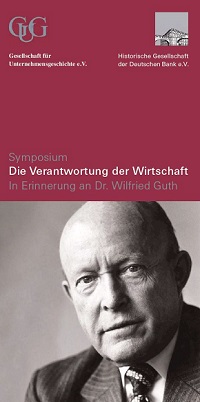
Der studierte Nationalökonom, der im Mai 2009 im Alter von 89 Jahren verstarb, hat als langjähriges Mitglied und Sprecher des Vorstands die Entwicklung der Deutschen Bank maßgeblich mitgeprägt und war überdies in zahlreichen internationalen Gremien aktiv, die sich beispielsweise mit Fragen der Währungs und Entwicklungspolitik und der zwischenstaatlichenWirtschaftsbeziehungen befassten.
Vor den rund 300 Teilnehmern des Symposiums, darunter zahlreiche ehemalige Vorstände der Deutschen Bank, würdigte Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrates, in seiner Begrüßung Wilfried Guth als „herausragende Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Managementfähigkeiten“. Aus den vielfältigen Interessen und Aktivitäten Guths seien für dieses Symposium die Bereiche Entwicklungspolitik und Verantwortung vonUnternehmen ausgewählt worden.
Jürgen Kocka, Professor für Geschichte und Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, stellte in seinem Vortrag über den Wandel der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen die gegenseitige Pflicht zur Rücksichtnahme zwischen Wirtschaft und Gesellschaft heraus. So seien gesamtgesellschaftliche Bedingungen und nachhaltiger Unternehmenserfolg eng miteinander verflochten.
Hermann Scholl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH, machte die weltweite Dimension der Unternehmensverantwortung im 21. Jahrhundert deutlich. „Unternehmer müssen die gleiche Verantwortung für Mitarbeiter in Bangalore, Shanghai und Stuttgart an den Tag legen“, betonte Scholl, der auch auf den wichtigen Beitrag der internationalen Präsenz von Unternehmen für die Entwicklung einzelner Länder hinwies. So könnten internationale Forschungs- und Entwicklungsetats von Unternehmen die Weltwirtschaft mehr voranbringen als viele politische Appelle.
Die wichtige Rolle Guths in der deutschen und internationalen Entwicklungshilfe stellte Monika Pohle Fraser von der Universität Oslo in ihrem Vortrag heraus. Für sie sei der ehemalige Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank „einer der letzten staatsmännischen Bankiers Deutschlands“ gewesen. Auch Wolfgang Kroh, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe, lobte Guth als einen „Vorkämpfer für Entwicklungspolitik“. In der Schaffenszeit Guths seien wichtige Leitsätze wie die „Hilfe zur Selbsthilfe“ entstanden, die bis heute die internationale Entwicklungspolitik prägten.
Über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern im Zeichen der Krise referierte Wolfgang Kroh, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe.

Die Referenten des Symposiums: Hermann Scholl, Wolfgang Kroh, Monika Pohle Fraser, Jürgen Kocka (v.l.)
Die abschließende Podiumsdiskussion widmete sich besonders dem Thema Unternehmensethik und Moral. Auf Basis des Wirkens von Wilfried Guth versuchten die Diskussionsteilnehmer, die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise unter moralischen Gesichtspunkten zu beleuchten und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu geben.
Zeige Inhalt von 2009 - 50 Jahre Retail Banking in der Deutschen Bank
50 Jahre Retail Banking in der Deutschen Bank - Privatkundengeschäft
Am 2. Mai 1959 stieg die Deutsche Bank in das Privatkundengeschäft auf breiter Basis ein. Aus einem ursprünglich auf Kleinkredite fokussierten Geschäftszweig entwickelte sich im Lauf der Jahrzehnte eine national und international erfolgreiche Unternehmenseinheit.
Unter dem Titel "Für Sie privat, für Sie geschäftlich - 50 Jahre Retail Banking in der Deutschen Bank" hat die Historische Gesellschaft am 29. April 2009 eine Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Privatkundengeschäfts durchgeführt.
Zum 50 jährigen Jubiläum des modernen Privatkundengeschäfts ist auch eine reich bebilderte Publikation erschienen. In ihr werden die großen strategischen Entscheidungen, die technischen Innovationen und gesellschaftlichen Veränderungen dargestellt, die das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank geprägt haben.
Referenten und Teilnehmer der Podiumsdiskussion:
Frank Strauß, Vorsitzender der Geschäftsleitung PBC Deutschland; Daniel Schäfer, Financial Times Deutschland; Prof. Dr. Dominik Georgi, Frankfurt School of Finance & Management; Rainer Neske, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank AG; Michael Münch, Geschäftsführender Vorsitzender der Historischen Gesellschaft; Prof. Dr. Dieter Ziegler, Universität Bochum, Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte; Guido Heuveldop, Mitglied des PBC Global Executive Committee
Weitere Informationen
Prof. Dieter Ziegler: "Sparen, Kredit und Konsum in Deutschland" - Redemanuskript
Zeige Inhalt von 2008 - Die Deutsche Bank und die USA
"Amerika Du hast es besser, als unser Kontinent, das alte"? Die Deutsche Bank und die USA Geschäft und Politik von 1870 bis heute
Anlässlich der neu erschienenen Publikation über die Deutsche Bank und die USA von Christopher Kobrak lud die Historische Gesellschaft am 17. April 2008 zu einer Vortragsveranstaltung mit anschließender Podiumsdiskussion in den Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt.
Referenten und Teilnehmer der Podiumsdiskussion
Volker Berghahn, Department of History, Columbia University, New York; Hansjürgen Rosenbauer, Medienrat Berlin-Brandenburg (Moderation); Christopher Kobrak, Autor des Buchs "Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute", European School of Management, Paris; Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank; Karsten D. Voigt, Koordinator für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit, Auswärtiges Amt
Information
Volker Berghahn: "Die Deutsche Bank und die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen in historischer Perspektive" - Redemanuskript
Zeige Inhalt von 2007 - Die Wiedervereinigung der Deutschen Bank 1957
Wiedervereinigung der Deutschen Bank vor 50 Jahren
In der Geschichte der Deutschen Bank hat der 2. Mai 1957 die Bedeutung eines zweiten Geburtstages. An diesem Tag wurde die neue Deutsche Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ins Handelsregister eingetragen. Unmittelbar vorausgegangen waren die Beschlüsse der Hauptversammlungen der drei Nachfolgegesellschaften (Norddeutsche Bank AG, Deutsche Bank AG West - bis 1956 Rheinisch-Westfälische Bank AG - und Süddeutsche Bank AG), sich wieder zu einem einheitlichen Institut zusammenzuschließen. Die Jahre der Teilung gingen damit für das Institut zu Ende.
Aus diesem Anlass veranstaltete die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 2. Mai 2007 eine Vortragsveranstaltung mit anschließender Podiumsdiskussion:
"Zusammenwachsen sieht man jetzt das Haus" – Die Wiedervereinigung der Deutschen Bank vor 50 Jahren
Referenten und Teilnehmer der Podiumsdiskussion
Dr. Tessen von Heydebreck, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank AG
Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, Institut für Geschichtswissenschaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Dr. Wilfried Guth, ehemaliger Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank AG
Hilmar Kopper, ehemaliger Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank AG
Jürgen Jeske, ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Download:
Joachim Scholtyseck : "Die Rückkehr der Deutschen Bank auf die Weltbühne - Die Wiedervereinigung der deutschen Großbanken und das Ende der Nachkriegszeit im Epochenjahr 1957" - Redemanuskript
Zeige Inhalt von 2006 - Fußball und Geld
Fußball und Geld
 Am 28. Juni 2006 lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Fußball und Geld“ ein.
Am 28. Juni 2006 lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Fußball und Geld“ ein.
FAZ-Kulturkorrespondent Dirk Schümer ging als erster in medias res und nahm mit viel Witz das Fußball-Business als Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe. „Denn kein BWL-Grundkurs, kein Treffen mit Wirtschaftsweisen, ja nicht einmal (…) die Lektüre des Wirtschaftsteils der FAZ vermag so viele Geheimnisse der Ökonomie und Finanzwissenschaft zu enthüllen, wie das Nachdenken über Fußball“, brachte er den Diskussionsgegenstand des Abends auf den Punkt.
Dirk Schümer - Fußball und Geld - Redemanuskript
Anschließend skizzierte die Historikerin Prof. Christiane Eisenberg den Weltfußballverband FIFA als Global Player. Allerdings müsse man in ihr weniger ein Unternehmen im klassischen Sinne als eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO) sehen. Zwar handele die FIFA gewinnorientiert, schütte jedoch Überschüsse nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit an Fußballverbände in aller Welt aus, ohne sich am erbrachten Kapitaleinsatz ihrer Mitglieder zu orientieren.
Christiane Eisenberg - Das Business der FIFA - Redemanuskript
In der lebhaften, von Dirk Schümer geleiteten Podiumsdiskussion betonte Uli Hoeneß (FC Bayern München AG), daß wirtschaftliche Besonnenheit bei einem Fußballverein durchaus angebracht ist. Nur auf der Basis von wirtschaftlicher Vernunft könne die Aktie eines börsennotierten Fußballunternehmens erfolgreich sein. Mit dem Hinweis, dass bei vielen Vereinen das Ziel, Gewinne zu machen, zugunsten des sportlichen Erfolgs vernachlässigt werde, erklärte Axel Benkner, Sprecher der Geschäftsführung der DWS GmbH, warum die DWS-Fonds keine Fußball-Aktien in ihre Portfolios aufnehmen. Als Sponsor des VfL Bochum nutze die DWS den Fußball aber als Werbeträger, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Sportreporter-Legende Rudi Michel störte sich hingegen an den ständigen Werbeunterbrechungen, deren man längst überdrüssig sei: „Muss den der Oliver Bierhoff, den ich sehr schätze, da in jeder Halbzeitpause an sein Glas klopfen.“
Zeige Inhalt von 2005 - Die Deutsche Bank und die Erdölindustrie
»Das schwarze Gold« - Die Deutsche Bank und die Erdölindustrie
"Das schwarze Gold" Die Deutsche Bank und die Erdölindustrie - die Hitorische Gesellschaft lud ihre Mitglieder zu einer Vortragsveranstaltung mit diesem Titel am 4. Juli 2005 ein. Begrüßt wurden die Anwesenden von Dr. Rolf-E. Breur. Es folgte nach einer Filmsequenz, ein Vortrag von Prof. Dr. Peter Hertner zum Thema "Die Deutsche Bank und die Erdölindustrie". Nach einer weiteren Filmsequenz folgte ein Vortrag von Lutz Feldmann mit dem Titel "Erdöl im 21. Jahrhundert". An diesen Vortrag schloss sich eine Podiumsdiskussion zum Thema "Machtfaktor Energie" an. Teilnehmer der Diskussiion waren neben den Referenten Dr. Burckhard Bergmann, Dr. Rolf-E. Breuer und Prof. Dr. Claudia Kemfert.
Wie kaum ein anderer Rohstoff hat das Erdöl die Welt verändert und die Industrialisierung maßgeblich beeinflußt. Die Nutzung des Öls für Produkte der chemischen Industrie schuf ein hohes ökonomisches Potential und bildete die Basis für einen veränderten Massenkonsum. Und im Gegensatz zu anderen Industriezweigen hatte der Staat zur Sicherstellung der privaten und öffentlichen Energieversorgung stets ein besonderes Interesse am "schwarzen Gold".
Auch die Banken stiegen selbstverständlich in das Erdölgeschäft ein, das viel Kapital erforderte. Die Deutsche Bank erwarb 1903 die rumänische Erdölgesellschaft Steaua Romana, die über umfangreiche Erdölvorkommen an den Ost- und Südhängen der Karpaten verfügte.
Obwohl das Unternehmen in Rumänien selbst eine gute Marktposition erreichen konnte, diktierten auf den Exportmärkten, und besonders in Deutschland, amerikanische Firmen die Preise.
"Wir mußten lernen, daß die Hauptschwierigkeit nicht die Gewinnung des Erdöls, sondern sein Verkauf ist", so beschrieb der damalige Vorstandssprecher Arthur von Gwinner in seinen Erinnerungen die Lage. Aber schließlich hat "die Deutsche Bank sogar viel Geld an dem Geschäft verdient", bemerkte Gwinner rückblickend, fügte jedoch hinzu, daß er als Bankmann diese Geschäfte nie wieder anrühren würde.
Der erste Generaldirektor der Steaua Romana wurde 1903 der Deutschrusse Georg Spies. Arthur von Gwinner ließ ihm zunächst freie Hand.
Später kam es jedoch zwischen beiden zu größeren Meinungsverschiedenheiten und Gwinner baute seinen Sekretär Emil Georg von Stauß zum starken Mann im Ölgeschäft der Deutschen Bank auf: Stauß trat 1905 in die Steaua Romana ein, 1914 wurde er deren Generaldirektor. Daneben fungierte er als Geschäftsführer der Europäischen Petroleum-Union und Generaldirektor der Deutschen Petroleum-AG. 1915 wurde Stauß in den Vorstand der Deutschen Bank berufen.
Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs hatte sich die Steaua Romana zur größten und bedeutendsten Produktionsstätte Rumäniens entwickelt.
Während des Krieges waren die rumänischen Erölgebiete zwischen Mittelmächten und Entente umkämpft.
Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete das Aus für die deutschen Erdölinteressen in Rumänien. Der Deutschen Bank gelang es dabei, ihre Beteiligung an der Steaua Romana ohne Verlust an ein rumänisch-französisch-englisches Bankenkonsortium zu verkaufen.
In den 1920er Jahren konzentrierte die Deutsche Bank ihre Erdölinteressen in der Deutschen Petroleum-AG. Um ein einheitliches Vorgehen auf dem von den meisten wesentlichen Erdölfördergebieten abgeschnittenen deutschen Markt zu ermöglichen, beschlossen die Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft 1922, daß die Deutsche Petroleum-AG die Ölinteressen beider Banken (die 1929 fusionierten) vereinigen sollte. Als Verkaufsgesellschaft fungierte die OLEX, die unter dem Namen OLEX Deutsche Petroleum-Verkaufs-Gesellschaft mbH ins Handelsregister eingetragen wurde.
In den Jahren bis 1931 erwarb die Anglo-Persian Oil Company - die nachmalige BP - sukzessive das gesamte Aktienkapital der Deutschen Petroleum-AG. Die große Zeit der Deutschen Bank im Erdölgeschäft war spätestens zu diesem Zeitpunkt beendet.
Zeige Inhalt von 2004 - Frauen in der Deutschen Bank
Die Frau, die entscheidende Kraft des 21. Jahrhunderts - Eine historische Entwicklungslinie
Am 26.Mai 2004 lud die Historische Gesellschaft zu einer Vortragsveranstaltung "Die Frau, die entscheidene Kraft des 21. Jahrhunderts - Eine historische Entwicklungslinie" in die Taunusanlage 12 ein.
Nach der Begrüßung durch Dr. Rolf-E. Breuer referierte Prof. Lothar Gall, Goethe-Universität Frankfurt am Main, über "Frauen in der Bank - Ein historischer Rückblick". Es folgten Beiträge von Kathrin Leeb, Deutsche Bank, "Eine Frauenperspektive" und Prof. Jean-Christophe Ammann, ehemaliger Direktor des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, "Frauen in der Kunst".
Frauen in der Deutschen Bank:
Die Weiberwirtschaft einiger hiesiger Großbanken ist sehr zu verwerfen" - so kommentierte 1914 ein Bankangestellter in Berlin die Arbeit seiner Kolleginnen. Was ihn auch immer zu diesem Stoßseufzer veranlaßte, Tatsache war, Frauen hatten es schwer, überhaupt in einer Bank Fuß zu fassen. Der Beruf des Bankkaufmanns blieb bis in die Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts eine Domäne des männlichen Geschlechts. In Deutschland wurden im Jahre 1878 im gesamten Bankgewerbe gerade vier weibliche Lehrlinge gezählt. Eine Banklehre setzte eine höhere Schulbildung voraus, die den Mädchen traditionell verwehrt blieb. Sie konnten daher nur als Ungelernte mit niedrigen Gehältern eingestellt werden.
In den Jahren nach 1900 wurden erstmals weibliche Mitarbeiter als Telefonistinnen und Stenotypistinnen bei der Deutschen Bank eingestellt (weibliches Reinigungs- und Kantinenpersonal hatte die Bank bereits seit ihren Anfängen beschäftigt).
Die erste "Beamtin", d.h. eine Mitarbeiterin die eine Banklehre, bzw. kaufmännische Ausbildung durchlaufen hatte, ist für das Jahr 1913 nachgewiesen. Erst während des Ersten Weltkrieges und der anschließenden Inflationszeit mit ihrem erhöhten Bedarf an Büropersonal kamen Frauen in größerer Zahl in die Banken. Sie arbeiteten überwiegend als Hilfskräfte an den Büromaschinen, die im Zuge der zunehmenden Automatisierung eingesetzt wurden. Die Deutsche Bank beispielsweise beschäftigte im Jahre 1927 8.363 männliche und 2.082 weibliche Tarifangestellte sowie 711 männliche und 150 weibliche Lehrlinge. Unter den 1.245 Direktoren, Prokuristen und sonstigen Oberbeamten befand sich allerdings noch keine einzige Frau.
Die Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1929 bis 1932 erhöhte die Arbeitslosigkeit unter den Angestellten erheblich, wobei die der Frauen stärker als die der Männer anstieg. Hier lag der Höhepunkt einer bereits seit Mitte der 1920er Jahre andauernden Agitation gegen die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen, gegen das sogenannte Doppelverdienertum.
Die Nationalsozialisten griffen zunächst die üppig wuchernden Ressentiments gegen die weibliche Erwerbstätigkeit auf und propagierten die Beschränkung der Frauen auf Haushalt, Familie und Kinder. Dies sollte durch Ehestandsdarlehen gefördert werden, wenn die Ehefrau bei die Berufstätigkeit aufgab.
Ab 1936 versuchte die nationalsozialistische Regierung jedoch, den wachsenden Arbeitskräftemangel, auch im Angestelltenbereich, durch Frauenarbeit auszugleichen. So fiel 1937 auch das weibliche Beschäftigungsverbot bei Gewährung eines Ehestandsdarlehens. Im Zweiten Weltkrieg wurde schließlich die Berufstätigkeit aller Frauen - auch der verheirateten - vom Staat weiter forciert. Dabei verstärkte sich der Zustrom der Frauen in die Büros.
In der Deutschen Bank z.B. stieg die Zahl der weiblichen Angestellten von rd. 2 200 (Ende 1934) auf rd. 3 400 (Ende 1940), das waren 14,4 bzw. 17,6 % der aller Angestellten. Die Ansichten zur Berufstätigkeit der Frau haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg und erst recht im Zuge der Emanzipationsbewegung vollständig geändert.
Bereits im Jahre 1956 waren im privaten Bankgewerbe der Bundesrepublik von 100 Tarifangestellten 45 Frauen; heute stellen Frauen in den Banken die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Belegschaft. Bis eine "Karriere" für Frauen möglich wurde, sollten jedoch noch einige Jahre vergehen. So startete die Deutsche Bank z.B. 1973/74 eine Kampagne "Frauen in Führungspositionen". 1988 trat mit Ellen R. Schneider-Lenné die erste und bislang einzige Frau in den Vorstand der Deutschen Bank (und einer deutschen Großbank überhaupt) ein.
Prof. Dr. Lothar Gall: Frauen in der Bank - Ein historischer Rückblick - Redemanuskript
Zeige Inhalt von 2003 - Die Deutsche Bank in Ostasien

Am 23. Juni 2003 lud die Historische Gesellschaft zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Die Deutsche Bank in Ostasien 1872-2003" in die Taunusanlage ein.
Vor der Eröffnung und Begrüßung der Veranstaltung durch Dr. Rolf-E. Breuer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, sang der Kinderchor der Japanischen Internationalen Schule Frankfurt zur Einstimmung zwei Lieder. Es folgten Filmausschnitte über China aus den Jahren 1935/36 und eine Lesung aus den Lebenserinnerungen von Herrmann Wallich, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank von 1870-1894, vorgetragen durch die Schauspielerin Hannelore Elsner. Prof. Werner Plumpe, Goethe-Universität Frankfurt am Main referierte im Anschluss über "Die Deutsche Bank in Ostasien 1872-1988". Beendet wurde die Veranstaltung durch eine Lesung des Schriftstellers Bodo Kirchhoffs aus seinem Buch "Parlando".
Die Deutsche Bank in Ostasien:
So schnell wie möglich Niederlassungen in Ostasien zu errichten, das war eines der Vorhaben, die die Deutsche Bank seit ihrer Gründung 1870 beschäftigten. Mit Hermann Wallich, der für eine Pariser Bank in Japan, Indien und China gearbeitet hatte, trat 1870 ein profilierter Fachmann für die asiatischen Geschäfte in den Vorstand ein. Die Märkte in Ostasien mit den zwei großen Ausfuhrartikeln Tee und Seide galten zu dieser Zeit als äußerst zukunftsträchtig. Bereits im Mai 1872 eröffnete daher die Deutsche Bank ihre ersten Auslandsfilialen in Shanghai und Yokohama, den wichtigsten Außenhandelsplätzen Chinas und Japans. Es waren - nach der Etablierung der Bank in Bremen und in Hamburg - die Filialen Nummer drei und vier.
Die in das Ostasiengeschäft gesetzten Erwartungen erfüllten sich zunächst jedoch nicht. Das Deutsche Reich, das nach 1871 von der Silber- zur Goldwährung überging, beauftragte die Deutsche Bank mit dem Verkauf seiner großen Silbervorräte, und Hermann Wallich sah Ostasien als geeigneten Absatzmarkt an. So erzielte die Deutsche Bank in den Jahren 1873 bis 1876 zwar stattliche Gewinne aus den Silberverkäufen, doch dadurch sank der Silberpreis erheblich. Dies schädigte die Filialen Shanghai und Yokohama, deren Betriebskapital auf Silber basierte. Nach zwei verlustreichen Geschäftsjahren entschloß sich daher der Vorstand in Berlin, die Filialen 1875 zu schließen. Geschäfte mit Ostasien wurden fortan über die 1873 gegründete Londoner Filiale der Bank getätigt.
Erst vierzehn Jahre später kehrte die Deutsche Bank wieder nach Ostasien zurück: im Rahmen ihrer Beteiligung an der Deutsch-Asiatischen Bank, die 1889 von einem Konsortium namhafter Aktienbanken und Privatbankiers mit Sitz in Shanghai gegründet wurde. Die Deutsch-Asiatische Bank errichtete Filialen in China, Japan und Indien und erhielt 1906 die Konzession zur Ausgabe eigener Banknoten in China. Die Haupttätigkeit der Bank war die Handelsfinanzierung; sie spielte, zusammen mit englischen und französischen Banken, aber auch eine hervorragende Rolle bei der Finanzierung von Anleihen des chinesischen Staates sowie bei der Finanzierung des Eisenbahnbaus in China.
Der Erste und der Zweite Weltkrieg zerschlugen das Filialnetz und die Geschäftsaktivitäten der Deutsch-Asiatischen Bank. 1953 startete sie in Hamburg den Wiederbeginn. Zusammen mit ihren Partnerbanken in der EBIC-Gruppe gründete die Deutsche Bank dann 1972 die "Europäisch-Asiatische Bank" (später "European Asian Bank"), in der die traditionsreiche Deutsch-Asiatische Bank aufging. Die Partnerbanken zogen sich nach und nach zurück und seit Ende 1986 firmierte die Bank als "Deutsche Bank (Asia)", die 1987/88 mit ihren damals 14 Filialen mit der Deutschen Bank verschmolzen wurde.
Nach Shanghai kehrte die Deutsche Bank 1995 zurück, zunächst mit einer Repräsentanz und seit 1999 mit einer eigenen Filiale - 1981 hatte sie bereits eine Repräsentanz in der Hauptstadt Peking eröffnet. In Japan begannen die Aktivitäten bereits 1962 mit der Eröffnung einer Vertretung in Tokio, und 1976 wurde die dortige Niederlassung der Deutschen Ueberseeischen Bank als eigene Filiale übernommen.
Zeige Inhalt von 2000 - Von Stambul nach Bagdad
Am 8. Februar 2000 fand in der Taunausanlage eine Vortragsveranstaltung und Buchvorstellung der Historischen Gesellschaft statt. Begrüßt wurden die Gäste von Dr. Rolf-E. Breuer, Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank. Es folgten historische Filmausschnitte über die Bagdadbahn und ein Vortrag von Prof. Manfred Pohl - "Von Stambul nach Bagdad - Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn" aus Anlass einer unter gleichem Titel neu erschienenen Publikation. Den Abschluss bildete eine Vorführung des Dokumentarfilms "Die Bagdadbahn" von Jürgen Lodemann.
Die Bagdadbahn:
Eines der bekanntesten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte, an dem die Deutsche Bank als Finanzier und Betreiber beteiligt war, ist zweifellos der Bau der Bagdadbahn. Doch kaum eine Eisenbahn hat vor dem Ersten Weltkrieg die Gemüter so erregt wie diese Bahnlinie, die vom Bahnhof Haidarpascha im asiatischen Teil Istanbuls bis an den Persischen Golf führen sollte.
Sultan Abdul Hamid II. wandte sich im Jahre 1888 an deutsche Finanzkreise. Eine Eisenbahn sollte das riesige Türkenreich vom Bosporus bis zum Schat el Arab wirtschaftlich und strategisch erschließen. Nach anfänglicher Skepsis engagierte sich die Deutsche Bank für dieses Projekt. Im Oktober 1888 erhielt sie die Konzessionen für die ersten Teilstrecken von Haidarpascha nach Ismid und von dort weiter nach Ankara.
Die Bauarbeiten wurden hauptsächlich von der Frankfurter Firma Philipp Holzmann durchgeführt. Trotz des schwierigen Streckenverlaufs ging es rasch voran. Bereits Ende 1892 war die nahezu 600 Kilometer lange Strecke nach Ankara fertiggestellt. 1896 konnte auch die Eisenbahnlinie nach Konya mit weiteren 400 Streckenkilometern eröffnet werden.
Die Verhandlungen über die Weiterführung der Eisenbahn von Konya nach Bagdad und weiter zum Persischen Golf nahmen die folgenden Jahre in Anspruch. Auseinandersetzungen mit den anderen europäischen Großmächten, deren politische und wirtschaftliche Interessensphären durch den Bahnbau berührt wurden, brachten die Bagdadbahn immer wieder in die öffentliche Diskussion. "Ich pfeife auf diese Konzession und die ganze Bagdadbahn", wetterte Georg von Siemens, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank 1898. Die vielfachen politischen Hindernisse hatten ihm das Projekt so leidig gemacht, daß er die Bagdadbahn Anfang 1899 sogar dem russischen Finanzminister Witte anbot. Dieser lehnte jedoch dankend ab.
Die Bau- und Betriebskonzession für die Eisenbahn wurde einer eigens gegründeten Aktiengesellschaft türkischen Rechts, der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft, übertragen. Ihre Aktien waren mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bank.
Im März 1903 unterzeichnete die Deutsche Bank schließlich doch die sogenannte Bagdadkonzession.
Der Weiterbau der Bahnlinie von Konya über das Taurus- und Amanusgebirge nach Mosul, Bagdad und Basra ging in Etappen von jeweils 200 Kilometern weiter.
Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wurden rund 600 Kilometer fertiggestellt. Dennoch fehlten bis Bagdad noch immer 650 Kilometer.
Krieg und der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs brachten die Bauarbeiten völlig zum Erliegen. Erst in den Jahren 1936 bis 1940 baute der irakische Staat die Bagdadbahn zu Ende. Am 15. Juli 1940 konnte der erste Reisezug von Istanbul nach Bagdad fahren.
Zeige Inhalt von 1999 - Die Deutsche Bank in den USA
"Amerika Du hast es besser, als unser Kontinent, das alte"? Die Deutsche Bank und die USA Geschäft und Politik von 1870 bis heute

Am 9. März 1999 veranstaltete die Historische Gesellschaft im Hermann Josef Abs-Saal, Junghofstraße 11, Frankfurt am Main, eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Zur deutschen und amerikanischen Identität 1870-1999. Die Deutsche Bank in den USA“.
Dr. Rolf-E. Breuer, Sprecher des Vorstandes der Deutschen Bank AG, eröffnete die Veranstaltung eröffnen und ging auf die aktuelle Geschäfte in den USA ein. Prof. Jonathan Steinberg, Universität Cambridge, schilderte in seinem Vortrag "Warum Deutsche und Amerikaner einander mißverstehen: Überlegungen zur Fusion von Deutscher Bank und Bankers Trust" seine interessanten Überlegungen zu den unterschiedlichen Kulturen und nationalen Identitäten beider Länder. Prof. Manfred Pohl, Leiter des Historischen Instituts der Deutschen Bank, beschrieb in seinem Vortrag "Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999" die Geschäftsbeziehungen zu den USA seit Gründung der Deutschen Bank. Frank N. Newman, Chairman sprach im Anschluss einige Grußworte von dem Hintergrund der anstehenden Fusion der Deutschen Bank mit Bankers Trust.
Die Veranstaltung wurde abgerundet mit Lesungen des Schauspielers Karl Michael Vogler aus Briefen und Tagebüchern: "Eine amerikanische Reise im Jahre 1883" - Aus Briefen von Georg von Siemens, Vorstandssprecher der Deutschen Bank von 1870 bis 1900 und "Eine Fahrt auf der Northern Pacific Railroad im Jahre 1896" - Aus den Lebenserinnerungen Arthur von Gwinners, Vorstandssprecher der Deutschen Bank von 1910 bis 1919.
Die Deutsche Bank und die USA
Eine Führungsmannschaft ohne Auslandserfahrung war für eine Bank, die sich die Förderung des deutschen Außenhandels in ihr Statut geschrieben hatte, schwer vorstellbar. Der erste Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Georg Siemens und sein Kollege Hermann Wallich, besaßen Auslandserfahrung, wenn auch nicht in Nordamerika.
Ein weiteres Vorstandsmitglied der ersten Zeit, den es allerdings nicht lange in den dunklen Büros in der Französischen Straße in Berlin hielt, war ein Deutsch-Amerikaner: Wilhelm Platenius, dessen Kenntnis des New Yorker Geschäfts der Bank von Nutzen sein sollte.
Die ersten Versuche der Bank, auf dem amerikanischen Kontinent Fuß zu fassen, standen allerdings unter keinem glücklichen Stern. Sie beteiligte sich an der in Südamerika tätigen Deutsch-Belgischen La Plata Bank und schon 1872 an dem neugegründeten New Yorker Bankhaus Knoblauch & Lichtenstein.
Als überseeische Stützpunkte brachten beide Firmen mehr Ärger als Freude. In den 1880er Jahren wurden sie liquidiert.
Das war zu einer Zeit, da die Deutsche Bank bereits eine starkes Geschäftsinteresse an nordamerikanischen Eisenbahnwerten entwickelt hatte, ein Engagement, das ihre Aktivitäten in den Vereinigten Staaten bis zum Ersten Weltkrieg prägen sollte. Amerikanische Eisenbahnpapiere waren seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland beliebt geworden - unter Anlegern wie Spekulanten gleichermaßen. Die Auswahl war riesig, das Risiko manchmal aber auch.
Die Deutsche Bank kam in eine enge Verbindung mit dem schillernden Eisenbahnmagnaten Henry Villard. Er stammte aus Deutschland und hatte sich aus kleinen Verhältnissen an die Spitze mehrerer Eisenbahngesellschaften hinaufgearbeitet.
Er lud Georg Siemens 1883 in die USA ein - es war ein regelrechtes Expeditionskorps, das sich in Bremerhaven einschiffte, um gemeinsam mit Villard im Fernen Westen der USA mit geradezu byzantinischem Aufwand die Vollendung der Northern Pacific Railroad zu feiern. Aber im Überschwang lag der Niedergang bereits begründet.
Siemens sah die Risiken zwar deutlich, gewann aber einen positiven Eindruck von den Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Er setzte sich für eine Beteiligung der Deutschen Bank an der Northern Pacific ein. So wurde das Jahr 1883 der Ausgangspunkt für das nordamerikanische Konsortialgeschäft der Deutschen Bank in den folgenden drei Jahrzehnten.
Die Northern Pacific blieb natürlich nicht die einzige Bahn, für die sich die Deutsche Bank engagierte oder mit der sie Geschäftsbeziehungen unterhielt, aber sie war diejenige, die dem Vorstand die meisten Sorgen machte. Sie geriet immer wieder in Schwierigkeiten, weil sie mehr investierte als sie finanzieren konnte. Die Risiken des Engagements waren bereits deutlich absehbar, als die Deutsche Bank 1890 die Gründung der Deutsch-Amerikanischen Treuhand-Gesellschaft anstieß. Sie sollte, wie der Geschäftsbericht der Bank es formulierte, "ein Concentrationspunkt werden, um welchen sich die europäischen Besitzer amerikanischer Actien und Bonds gruppiren können, wenn es sich um juristische und finanzielle Vertretung ihres Besitzes im regelmäßigen Geschäft oder in Nothlagen handelt."
Eine solche Notlage trat 1893 ein: Die Northern Pacific wurde zahlungsunfähig.
Siemens sah sich im Interesse der deutschen Investoren gezwungen, persönlich die Sanierung zu bewerkstelligen. Mit Hilfe eines internationalen Konsortiums wurde die Gesellschaft auf eine solide finanzielle Basis gestellt.
Es kam zum Bruch mit Villard, der persönlich nichts riskiert oder verloren hatte: »Was mir am meisten für Sie leid tut, ist, daß Sie bei dem Zusammenbruch der Northern Pacific ein reicher Mann geblieben sind«, schrieb Siemens ihm ungewohnt bissig.
In dem profilierten Bankier und Industriellen Edward D. Adams dem Vorsitzenden des Reorganisations-Komitees für die Northern Pacific, gewann die Deutsche Bank den Mann, der für die nächsten zwanzig Jahre, bis zum Ersten Weltkrieg, ihre Interessen in den Vereinigten Staaten wahrnehmen sollte.
Eine eigene Niederlassung in den Vereinigten Staaten hatte die Bank allerdings nicht. Zwar wurde 1914 erwogen, eine Filiale in New York zu eröffnen, um den durch den Ersten Weltkrieg bedingten Ausfall des Finanzplatzes London auszugleichen, doch geriet diese Idee niemals in das Stadium konkreter Planungen.
Eisenbahnen waren zwar die wichtigste, aber natürlich nicht die einzige Branche, in der sich die Deutsche Bank in Nordamerika engagierte. In der Liste der Konsortialgeschäfte sind auch die Elektroindustrie, der Maschinenbau und die Montanindustrie prominent vertreten. Zu den Firmen, mit denen die Bank in Verbindung stand gehörten zum Beispiel Edison General Electric Company, Allis Chalmers, American Telephone & Telegraph Company, Anaconda Kupferminen, International Paper, Lackawanna Steel, Lehigh Coke, Niagara Falls Power Company, Standard Oil Company of New York und Westinghouse. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs wandelte sich das Geschäft mit den Vereinigten Staaten fundamental. Der florierende Kapitalverkehr der Vorkriegszeit war Vergangenheit. Deutschland war nun der größte Schuldner, die Vereinigten Staaten das größte Gläubigerland der Welt.
Die Deutsche Bank ging nur zurückhaltend an die Wiederherstellung ihrer amerikanischen Geschäftsbeziehungen und die Rückgewinnung ihrer Stellung in den Vereinigten Staaten. Immerhin bestand in New York auf dem Broadway eine Vertretung, die erst in den späten dreißiger Jahren aufgegeben wurde.
Bedeutsam wurde der Einsatz der Bank für die Freigabe der im Krieg beschlagnahmten deutschen Vermögenswerte. Viele USA-Aktivitäten in den zwanziger Jahren waren eine Abwicklung von Vorkriegs-Engagements. Neues Geschäft war selten, und wenn, dann waren die Rollen umgekehrt: 1927 nahm die Bank in den USA eine Anleihe über den Betrag von 25 Millionen Dollar auf. Mit der Weltwirtschaftskrise verlor das Auslandsgeschäft der Deutschen Bank zusehends an Bedeutung. Der dramatische Einbruch des Welthandels, die Konjunktur des Protektionismus ließen die Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland immer unwichtiger werden. Der Zweite Weltkrieg zerstörte die Geschäftsbeziehungen der Bank zu den Vereinigten Staaten vollends.
Nach dem Krieg verzichtete die Bank darauf, eine eigene operative Auslandspräsenz zu errichten. Das Geschäft mit dem Ausland lebte vor allem von Beziehungen zu Korrespondenzbanken und wurde durch einige Repräsentanzen und Beteiligungen gestützt. Dem Korrespondenzbankprinzip war auch die EBIC verpflichtet, eine Gruppe europäischer Banken, die - unter Beteiligung der Deutschen Bank - 1968 in New York die European-American Banking Corporation und die European-American Bank & Trust Company gründete.
Sie boten ihre Dienste vor allem europäischen Firmen an, die Geschäfte in den Vereinigten Staaten tätigten, und gaben amerikanischen Niederlassungen europäischer Unternehmen Finanzierungshilfen. 1974 wurde die insolvent gewordene Franklin National Bank übernommen, wodurch sich der Weg in das Privatkundengeschäft öffnete. 1988 zog sich die Deutsche Bank aus dem Unternehmen zurück. Ergänzend kam 1971 die UBS-DB Corporation hinzu, die neben dem Effekten- und Emissionsgeschäft auch Leasing-Transaktionen und die Vermittlung von Beteiligungen anbot. Aus ihr wurde 1985 - nach der Zwischenstufe Atlantic Capital Corporation - die Deutsche Bank Capital Corporation.
Erst 1979 eröffnete die Deutsche Bank eine Filiale in New York. Sie kam damit als letzte der deutschen Großbanken mit einer Niederlassung unter eigenem Namen nach Manhattan. Der Grund für dieses lange Abwarten war die Präsenz in Form ihrer Beteiligungsgesellschaften. Mit der verstärkten Hinwendung der Deutschen Bank zum Investment Banking in den 1990er Jahren wurde das Nordamerika-Geschäft immer wieder neu strukturiert.
Wichtige Zwischenschritte waren 1991 die Deutsche Bank North America Holding und 1995 die Gründung der Deutsche Morgan Grenfell. Es wurde aber deutlich, daß die Bank aus eigener Kraft die in diesem Geschäftszweig nötige Größe nicht würde erreichen können. Sie begann daher nach einer amerikanischen Bank Ausschau zu halten, mit der sie zusammengehen könnte. Diese wurde in der New Yorker Bankers Trust gefunden, die 1999 übernommen wurde.
Mit ihr kam auch das traditionsreiche Bankhaus Alex. Brown in Baltimore zur Deutschen Bank, das Bankers Trust zwei Jahre zuvor übernommen hatte. Mit dieser Transaktion erreichte das Geschäft der Bank in der Region eine völlig neue Größenordnung. Seine Bedeutung wurde durch die Notierung an der New Yorker Börse 2001 untermauert. Im gleichen Jahr erwarb die Bank ein neues Bürogebäude im Süden Manhattans, das in den nächsten beiden Jahren schrittweise bezogen wurde.
Zeige Inhalt von 1998 - Die Deutsche Bank und die Automobilindustrie
Am 22. Juni 1998 lud die Historische Gesellschaft ihre Mitglieder zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Die Deutsche Bank und die Automobilindustrie" in die Taunusanlage ein. Begrüßung und Eröffnung erfolgten durch Dr. Rolf-E. Breuer, Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Es folgte ein Fachvortrag von Prof. Gerald D. Feldman an den sich historische Filmsequenzen anschlossen, die von der Rennfahrerlegende Stirling Moss erläutert und kommentiert wurden. Jürgen E. Schrempp, Vorsitzender des Vorstands der Daimler-Benz AG referierte über "Das Auto und die Zukunft". Zum Abschluss der Veranstaltung wurde Hilmar Kopper die Ehrenmitgliedschaft der Historischen Gesellschaft verliehen.
Die Deutsche Bank und die Automobilindustrie:
Die Geburtsstunde des Automobils schlug 1886, als Gottlieb Daimler und Karl Benz mit ihren Erfindungen den Grundstein für diese technische Revolution legten. Die Namen der beiden Pioniere stehen noch heute gemeinsam für den ältesten Automobilhersteller der Welt: die Daimler-Benz AG. Sie wurde 1926 aus den beiden Ursprungsfirmen, der Daimler-Motoren-Gesellschaft in Stuttgart und der Firma Benz & Cie in Mannheim, gebildet.
Die Deutsche Bank wurde zum Vermittler und zur treibenden Kraft dieser Fusion. Sie war kurz nach dem Ersten Weltkrieg in die Geschäfte der damals hochverschuldeten Firmen Daimler und Benz involviert worden, und zwar durch die beiden mit ihr eng verbundenen Banken in Süddeutschland - die Württembergische Vereinsbank in Stuttgart und die Rheinische Creditbank in Mannheim, die Hausbanken von Daimler und von Benz.
Das Stuttgarter Kreditinstitut ging dann 1924 und die Rheinische Creditbank 1929 in der Deutschen Bank auf.
Seit 1920 saß das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Emil Georg von Stauss, im Aufsichtsrat der Daimler-Motoren-Werke. Stauss schwebte ein großer Automobiltrust, ähnlich wie General Motors in den Vereinigten Staaten, vor. In diesen Zusammenschluß wollte er eine süddeutsche Gruppe mit Daimler und Benz, möglichst aber auch mit BMW und Opel, einbeziehen.
Diese Idee ließ sich in den nächsten Jahren jedoch nicht vollständig umsetzen. Zunächst schlossen Daimler und Benz im Jahre 1924 einen Interessengemeinschaftsvertrag, bevor beide Firmen im Juni 1926 zur Daimler-Benz AG fusionierten.
Stauss übernahm den Vorsitz im neuen Aufsichtsrat. Seit diesem Zeitpunkt stellt die Deutsche Bank den Aufsichtsratsvorsitzenden der Stuttgarter Automobilfirma.
Aus jenen noch sanierungsträchtigen Anfängen in den zwanziger Jahren stammt etwa die Hälfte des Daimler-Anteils, über den die Deutsche Bank heute verfügt. Die andere Hälfte wurde in den frühen fünfziger Jahren erworben, und 1975 war die Deutsche Bank mit 28,5 Prozent an Daimler-Benz beteiligt. Im selben Jahr übernahm sie - in einer der größten finanziellen Transaktionen ihrer Geschichte - das Daimler-Aktienpaket der Flick-Gruppe in Höhe von 29 Prozent. Ein Verkauf dieser Anteile ins Ausland konnte damals vermieden werden.
Die Deutsche Bank brachte den überwiegenden Teil der Aktien aus dem Flick-Paket in die neugegründete Mercedes-Automobil-Holding ein und verringerte in den nächsten Jahren ihr Daimler-Aktienpaket auf ca. 21,8 Prozent (1998).
Die Deutsche Bank war jedoch nicht nur mit Daimler-Benz eng verbunden, sie verhalf auch den Bayerischen Motoren Werken in München zum Automobilbau: Auf Vermittlung von Emil Georg von Stauss, der seit 1926 auch den Aufsichtsratsvorsitz bei BMW innehatte, kaufte BMW 1928 die darniederliegende Eisenacher Fahrzeugfabrik und übernahm den kleinen "Dixi", der sich als Erfolgsmodell erweisen sollte.
Die Deutsche Bank blieb bis zum Jahre 1960 auch bei BMW engagiert - bis dort der neue Großaktionär Herbert Quandt einstieg.
Vortrag von Prof. Gerald D. Feldman - Die Deutsche Bank und die Automobilindustrie - Redemanuskript
Zeige Inhalt von 1997 - Der Kaiser und sein Reeder
Albert Ballin - die Hapag Lloyd und die Deutsche Bank

"Der Kaiser und sein Reeder" - Albert Ballin, die Hapag und die Deutsche Bank". Unter diesem Titel fand am 23. Juni 1997 in der Taunausanlage eine Vortragsveranstaltung der Historischen Gesellschaft statt. Eröffnung und Begrüßung erfolgten durch den Hilmar Kopper, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Prof. Gerhard A. Ritter, Ludwig-Maximilians Universität München, übernahm den Fachvortrag. Den Abschluss bildete ein Schlusswort von Bernd Wrede, Vorsitzender des Vorstandes der Hapag-Lloyd AG. Zwischen den einzelnen Redebeiträgen wurden kleine Filmausschnitte zur Geschichte und Gegenwart der Hapag-Lloyd AG gezeigt.
Die Deutsche Bank und die Hapag-Lloyd:
Am 27. Mai 1847 gründeten 30 Reeder und Kaufleute in der Hamburger Börse die »Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft«, die Hapag. Sie nahm bereits 1856 den Amerikaverkehr mit Dampfschiffen auf und entwickelte sich bis 1914 zur größten Reederei der Welt. Ihr glanzvoller Aufstieg war im wesentlichen das Werk Albert Ballins (1857-1918).
Er trat im Jahre 1886 in die Hapag ein und wurde bereits zwei Jahre später in den Vorstand berufen. Von 1899 bis zu seinem Tode 1918 war er Vorstandsvorsitzender - Generaldirektor hieß das damals. Als größte Reederei der Welt war die Hapag - seit der Jahrhundertwende Hamburg-Amerika-Linie genannt - nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ein politisches Instrument.
Und dies gerade in einem Deutschen Reich, dessen Kaiser die Zukunft seines Landes »auf dem Wasser« sehen wollte - so formulierte es Wilhelm II. im Jahre 1898. Seit 1905 frühstückte der Monarch bei seinen Besuchen in Hamburg im Hause Ballin. Der Reeder seinerseits zählte in Berlin zu den Tafelgästen Seiner Majestät und durfte anschließend mit ihm im Park spazierengehen. Er wurde »des Kaisers Reeder«, dem sich politische Einflußmöglichkeiten erschlossen.
Trotz der guten Beziehungen zu Wilhelm II. hielt Ballin nicht viel von der damaligen politischen Führung in Deutschland. Für den Reichskanzler Bethmann Hollweg hätte man seiner Meinung nach in der Hapag höchstens eine Verwendung als Bibliothekar gehabt. Überhaupt, so Ballins häufig geäußerte Ansicht: Würde die Hapag so geführt wie das Deutsche Reich, wäre sie längst pleite.
Die Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zur Hapag reichen bis in das Jahr 1856 zurück. Die Verbindung lief zunächst über ihre Vorgängerbank, die Norddeutsche Bank in Hamburg, die »Hausbank« der Hapag. Die Deutsche Bank in Berlin widmete sich nach ihrer Gründung 1870 in erster Linie der Konkurrenz, dem 1857 gegründeten Norddeutschen Lloyd in Bremen.
Nach der Fusion der Norddeutschen Bank mit der Deutschen Bank im Jahre 1929 gingen die Hapag-Finanzierungen auf die Deutsche Bank über. Während der Wirtschafts- und Bankenkrise 1930 schlossen die Hapag und der Norddeutsche Lloyd einen umfassenden Interessengemeinschaftsvertrag. Beide Reedereien, die 1945 nahezu ihre gesamte Flotte verloren hatten, begannen Anfang der fünfziger Jahre mit dem Wiederaufbau. 1970 kam es zu einer engen Zusammenarbeit: Eine Fusion war die Geburtsstunde der Hapag-Lloyd AG.
Das neue Unternehmen erhielt - der Tradition seiner Teile entsprechend - einen Doppelsitz: Hamburg und Bremen.
Die Deutsche Bank übernahm damals an der Hapag-Lloyd AG einen Anteil von rund 30 Prozent. Sie begleitete auch die in den achtziger Jahren erforderlichen Strukturmaßnahmen federführend und gab frisches Kapital. Anfang September 1997 verkaufte die Deutsche Bank ihre 10-prozentige Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG an den neuen Großaktionär Preussag AG.
Zeige Inhalt von weitere Veranstaltungen im Überblick
2006 - Arthur von Gwinner Lebenserinnerungen - Lesung
2005 - Der Bankier Hermann Josef Abs
2002 - Corporate Culture - Die Geschichte einer Identität
2001 - Beschleunigte Zeitenwende
2000 - Vom Bankier zum Manager
1999 - Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben (Lesung)
- Goethe: Geist und Geld
1996 - Lufthansa und die Deutsche Bank
1995 - 125 Jahre Deutsche Bank
1994 - Russland - Politik, Geschäft und Kultur
1993 - Die Deutsche Bank und die UFA
1992 - Privatbankiers in Frankfurt am Main
1991 - Die Bagdadbahn
- Öffentliche Gründungsveranstaltung (Begrüßungsrede Hilmar Kopper) (Eintritt in die Deutsche Bank Hermann J. Abs)

















