Zeige Inhalt von Gebhard, Gustav
| Lebensdaten: | 18.08.1828 in Elberfeld - 06.05.1900 in Berlin | 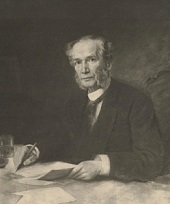 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1900 |
Der Seidenfabrikant Gustav Gebhard war Inhaber des 1797, damals unter dem Namen Bernhard Cahen et Leeser, gegründeten Elberfelder Unternehmens Gebhard & Co., das neben verschiedenen Waren vor allem Seidenstoffe herstellte, verkaufte und exportierte. Die Neugründung auf den Namen Gebhard & Co. erfolgte 1859 durch Gustavs Vater Franz Josef. Im Jahr 1886 wurde der Sitz von Elberfeld nach Vohwinkel, beides heute Stadtteile Wuppertals, verlegt. Der Außenhandel war ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens, und Gustav Gebhard reiste in seiner Funktion als Kaufmann in verschiedene Länder und stellte wichtige internationale Beziehungen her, vor allem nach Frankreich, England, in die USA und in den Orient. 1868 wurde er zum persischen Konsul berufen.
Gebhard beteiligte sich aber auch rege an Bankgründungen, so war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bergisch Märkischen Bank, die 1871 von Textilfabrikanten, unter ihnen auch Gebhard, gegründet worden war. Des Weiteren war er Mitglied des Verwaltungsrats des Barmer Bankvereins und der Deutschen Bank. Dort vertrat er bis zu seinem Tod die Interessen der Textilindustrie in der Rhein-Ruhr-Region. Er hatte 51 000 Talern bei der Gründung gezeichnet und war in den ersten Verwaltungsrat gewählt worden. Gebhard zählte zum persönlichen Freundeskreis von Georg von Siemens. Seine letzten Jahre verbrachte er als Rentier in Berlin.
Zeige Inhalt von Goldschmidt, Meyer
| Lebensdaten: | 14.05.1818 in Danzig - 1884 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1864-1868 |
Zu den engsten Mitarbeitern der von David und Adolph Hansemann in der Frühzeit der Disconto-Gesellschaft gehörte Meyer Goldschmidt, der 1857 Prokura erhielt und nach dem Tod David Hansemanns 1864 zum Geschäftsinhaber ernannt wurde. Als Leiter des Direktionsbüros war er zuständig für das laufende Geschäft, das den Börsen- und Rechnungsverkehr, den Effektenhandel sowie das Wechsel- und Depositengeschäft umfasste. Dem letztgenannten Geschäftszweig galt Goldschmidts besonderes Engagement. Aus gesundheitlichen Gründen schied er 1869 als Geschäftsinhaber aus, blieb der Disconto-Gesellschaft aber noch bis zu seinem Tod als Mitglied des Verwaltungsrats verbunden.
Zeige Inhalt von Gröning, Fritz
| Lebensdaten: | 28.03.1902 in Berlin - 16.09.1978 in Düsseldorf |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied 1953-1968 |
Gröning, der ursprünglich Ingenieur werden wollte und nach der Schulzeit zunächst zwei Jahre als Volontär in mehreren Maschinenbaubetrieben arbeitete, begann 1922 eine Lehre in der Berliner Zentrale der Deutschen Bank. 1929 ging er für ein Jahr nach London, um als Korrespondent beim Bankhaus Jacob Wassermann das englische Bankgeschäft kennenzulernen. 1934 erhielt er Prokura, ab 1938 bearbeitete er als Dezernent im Sekretariat die großen Konsortialgeschäfte der Deutschen Bank sowie das Kreditgeschäft der Berliner Stadtzentrale. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges arbeitete Gröning noch bis 1946 in der Berliner Zentrale, bevor er zu dem bei Kriegsende nach Hamburg ausgewichenen "Führungsstab" der Deutschen Bank stieß. 1952 wurde er Direktor der Rheinisch-Westfälischen Bank in Düsseldorf. Von 1953 bis 1956 gehörte er dem Vorstand dieses Nachfolgeinstituts der Deutschen Bank an. Nach der Wiederrichtung der Deutschen Bank war er dort Vorstandsmitglied bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand. Auch als Vorstand widmete sich Gröning ganz besonders der Förderung und Pflege des Emissionsgeschäfts. Außerdem betreute er im Bereich Düsseldorf die Filialbezirke Bielefeld, Essen und Siegen. Das vor dem Zweiten Weltkrieg nur bescheiden entwickelte Geschäft der Absatzfinanzierung wurde von Gröning mit Nachdruck ausgebaut.
Sein Fachwissen stellte er u.a. als Mitglied des Kapitalmarktausschusses des Bundesverbands des privaten Bankgewerbes zur Verfügung. Gröning war Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Centralbodenkredit AG, der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft, der Knorr-Bremse AG sowie Vorsitzender des Beirats der Gesellschaft für Absatzfinanzierung.
Zeige Inhalt von Guth, Wilfried
| Lebensdaten: | 08.07.1919 in Erlangen - 15.05.2009 in Königstein |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1968-1985 (Sprecher 1976-1985), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1985-1990 |
Nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft (bis 1949) studierte Wilfried Guth an den Universitäten Bonn, Genf, Heidelberg sowie an der London School of Economics Nationalökonomie. 1953 trat er in die Dienste der Bank deutscher Länder (seit 1957 Deutsche Bundesbank) ein. Fünf Jahre später wurde er zum Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Bundesbank ernannt. 1959 ging er als deutscher Exekutivdirektor zum Internationalen Währungsfonds in Washington. Danach war er von 1962 bis 1967 Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Anfang 1968 wurde Guth in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Von 1976 bis Mai 1985 war er - zusammen mit F. Wilhelm Christians - Sprecher dieses Gremiums. Das internationale Emissionsgeschäft zählte hier, in einer von zunehmender Internationalisierung geprägten Phase der Deutschen Bank, zu Guths wichtigen Aufgabengebieten. Nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand gehörte Guth dem Aufsichtsrat der Bank bis 1995 an, von 1985 bis 1990 war er dessen Vorsitzender.
Während seiner Vorstandstätigkeit nahm er Aufsichtsratsmandate, vielfach als Vorsitzender oder als stellvertretender Vorsitzender, in wichtigen deutschen Unternehmen wahr, u.a. bei der Daimler-Benz AG, Siemens AG, Allianz AG und Philipp Holzmann AG. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Deutschen Bank wurde Guth Mitglied im Gesellschafterausschuss der Henkel KGaA und Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG.
Als Währungsexperte wirkte Guth in zahlreichen Gremien mit, die sich mit Fragen der internationalen Währungspolitik und den zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen befaßten. So war er Mitglied des Board of Trustees des Institute for Advanced Study in Princeton, der Group of Thirty und des Comité pour l'Union Monétaire de l'Europe. In den sechziger Jahren hatte er als Mitglied der Pearson Commission im Auftrag der Weltbank an der Formulierung einer entwicklungspolitischen Grundkonzeption mitgewirkt und war im Jahr 1995 europäischer Co-Chairman der Bretton Woods Kommission. Auch in die Diskussion über Lösungsmodelle für die internationale Verschuldungsproblematik schaltete sich Guth mit vielen Beiträgen ein.
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen war für Guth ein zentrales Thema und marktwirtschaftliche Überzeugung tief in seinem Selbstverständnis verwurzelt. So begleitete er in leitender Funktion die Gesellschaft zur Förderung des Unternehmernachwuchses, die die "Baden-Badener Unternehmergespräche" durchführt. Soziale Marktwirtschaft musste nach seiner Auffassung mehr sein als ein Regelkatalog für das Funktionieren der Wirtschaft: „Was sie allen sozialistischen und planwirtschaftlichen Ansätzen überlegen macht, war und ist das dahinterstehende geistige und sittliche Prinzip.“
Auch in Kultur und Wissenschaft engagierte sich Guth in zahlreichen Gremien, u.a. in der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, den Freunden der Alten Oper Frankfurt, als Ehrenmitglied und Förderer der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte und der European Association for Banking and Financial History.
In Wilfried Guths nächster Verwandtschaft finden sich führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Sein Vater Karl Guth fungierte von 1934 bis 1945 als Geschäftsführer der Reichsgruppe Industrie, sein Onkel (von dem er viele Anregungen erhielt) war Bundeswirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard.
Zeige Inhalt von Gwinner, Arthur von
| Lebensdaten: | 06.04.1856 in Frankfurt am Main - 29.12.1931 in Berlin | 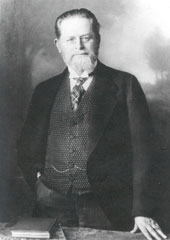 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1894-1919 (Sprecher 1910-1919) |
Arthur von Gwinner stammte aus einer bekannten Frankfurter Juristenfamilie; sein Vater war der Testamentsvollstrecker Arthur Schopenhauers, sein Großvater bekleidete in Frankfurt das Amt des Älteren Bürgermeisters.
Nach einer Banklehre bei der Mitteldeutschen Creditbank in Frankfurt am Main arbeitete er für ein Jahrzehnt im Ausland (England und Spanien) und erwarb sich dort umfangreiche Kenntnisse des internationalen Bankgeschäfts. 1888 erwarb er das Berliner Bankhaus Riess & Itzinger, das er unter eigenem Namen weiterführte, 1894 aber liquidierte, als er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen wurde.
Gwinner war dort vor allem im internationalen Bereich tätig und arbeitete eng mit Georg von Siemens zusammen. Wie klein die Bank rund ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung noch war, geht auch daraus hervor, daß beide Herren zunächst an einem Doppelpult saßen, denn nicht jedes Vorstandsmitglied hatte damals ein eigenes Zimmer. Siemens schied Ende des Jahres 1900 aus dem Vorstand aus, und Gwinner übernahm seine Aufgabenbereiche, vor allem die großen internationalen Geschäfte, wie die Bagdadbahn oder die Eisenbahnfinanzierungen in Nordamerika.
Mit dem Kauf und der Sanierung der rumänischen Erdölgesellschaft "Steaua Romana" begann zudem im Jahre 1903 der Aufbau des "Ölkonzerns" der Deutschen Bank, ein Bereich, für den Gwinner ebenfalls verantwortlich zeichnete. Sein Name ist ferner eng verbunden mit der Entwicklung des Auslandsgeschäfts der elektrotechnischen Industrie, vor allem mit den ausländischen Engagements der Firmen AEG und Siemens sowie deren Holding-Gesellschaften.
Sowohl die Bagdadbahn als auch die Erdölgeschäfte der Deutschen Bank waren wirtschaftliche und zugleich politische Unternehmungen, die viel diplomatisches Geschick erforderten. Gwinner erwarb sich hier den Ruf als "Diplomat der Bank", eine Aufgabe, für die er durch seine kosmopolitischen Eigenschaften und seine hervorragenden Sprachkenntnisse besonders befähigt war. Zwar hatte seit 1901 zunächst Rudolph von Koch - bedingt durch das Anciennitätsprinzip - die Sprecherfunktion inne, doch Gwinner galt, sowohl innerhalb des Hauses als auch in der Öffentlichkeit, als der Nachfolger von Siemens in der Leitung der Bank, als Vollstrecker der großen Auslandsprojekte. Die ersten fünfzig Jahre der Deutschen Bank wurden von Siemens und Gwinner wesentlich geprägt, beide waren die Garanten für die Kontinuität der Entwicklung des Unternehmens.
Im Januar 1910 berief der Kaiser Arthur von Gwinner für seine Verdienste im Osmanischen Reich in das preußische Herrenhaus, das "Oberhaus" des Parlaments. Hier hielt Gwinner 1910 eine aufsehenerregende Rede, in der er Kritik an der Budgetierung sowie der den Staatskredit schädigenden Defizitwirtschaft des preußischen Finanzministeriums übte. Sein berühmter Ausspruch während dieser Debatte: "es gehört Talent zu allem, aber zum Borgen gehört Genie!" wurde später in Berlin noch häufig kolportiert.
Zu dem auch von Gwinner gepflegten "Stil" der Deutschen Bank gehörte es im übrigen, daß der jeweilige Sprecher des Vorstands keinen herausgehobenen Titel führte. Gwinner schrieb deshalb am 3. Mai 1912 - "vertraulich und nicht zur Veröffentlichung bestimmt" - an das "Berliner Tageblatt": "Unter Bezug auf Ihren vorgestrigen Bericht über die Bergmann-Generalversammlung bitte ich freundlichst, mich nicht als Generaldirektor zu bezeichnen. Die Deutsche Bank hat nie einen solchen gehabt und wird auch, so lange ich Mitglied des Vorstandes bin, keinen erhalten. Unsere Verfassung ist eine demokratische."
Gwinner schied 1919 aus dem Vorstand aus und trat in den Aufsichtsrat der Bank ein, dessen stellvertretender Vorsitzender er von 1923 bis zu seinem Tode im Jahre 1931 war. Für die Bankmitarbeiter stiftete er im Jahre 1917 einen Betrag von 300.000 Mark, mit dem ein Erholungsheim auf dem Krähenberg bei Caputh, in der Nähe von Potsdam, errichtet wurde. Über das Bankfach hinaus galten Gwinners vielfältige Interessen vor allem der Mineralogie und Botanik.
weitere Informationen
Arthur von Gwinner – Lebenserinnerungen. Gelesen von Robert Atzorn (Hörbuch)
Zeige Inhalt von Halt, Karl Ritter von
| Lebensdaten: | 02.06.1891 in München - 05.08.1964 in München |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1938-1945 |
Der Sohn eines Kunstschlossers begann seine berufliche Tätigkeit 1908 als Lehrling bei der Deutschen Bank Filiale München und besuchte nebenher die Luitpold-Oberrealschule, wo er 1911 das Abitur ablegt. Als Kriegsfreiwilliger wurde er 1917 mit dem Max-Joseph-Ritterorden ausgezeichnet, der ihn auch zur Führung des Adelsprädikats berechtigte.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte von Halts sportliche Karriere begonnen. Zwischen 1911 und 1921 war er fünfmal deutscher Meister im Zehnkampf und belegte in dieser Disziplin Platz acht bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm. Als Sportlehrer an der Münchener Militärsportschule materiell abgesichert, promovierte er 1922 an der Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München über "Die Pflege der Leibesübungen an Hochschulen. Ein Beitrag zur regenerativen Bevölkerungspolitik".
In seinen erlernten zivilen Beruf zurückgekehrt, war er von 1923 bis 1935 Personalchef beim Bankhaus H. Aufhäuser in München, das wegen seiner jüdischen Inhaber nach 1933 bald unter die Restriktionen der Nationalsozialisten geriet. Nebenher verfolgte er aber weiterhin seine Karriere als Sportfunktionär, die 1929 mit der Aufnahme ins IOC ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Bei den Olympische Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen fungierte Halt als Präsident des Organisationskomitees und noch 1944 wurde er (seit 1933 Mitglied der NSDAP) zum kommissarischen Reichssportführer ernannt.
Als die Deutsche Bank von Halt 1935 einen Direktorenposten in der Berliner Zentrale anbot, geschah dies - obgleich er über langjährige Erfahrung im Bankfach verfügte und seine Berufslaufbahn sogar bei der Deutschen Bank begonnen hatte - vor allem aus taktischem Kalkül. Er galt zwar als prominenter, aber nicht ideologisch verbissener Nationalsozialist, von dem man sich eine Zähmung der die "Revolution von unten" proklamierenden Parteimitglieder innerhalb der eigenen Belegschaft erhoffte. Im Vorstand der Deutschen Bank, dem er seit 1938 angehörte, fiel ihm das Personalressort zu. Sein Einfluss auf das eigentliche Bankgeschäft blieb aber unbedeutend, so nahm er etwa nur ein einziges Aufsichtsratsmandat wahr.
Kurz nach Kriegsende wurde von Halt, der als Kommandeur des Volkssturm-Bataillons "Reichssportfeld" noch am Kampf um Berlin teilgenommen hatte, von den Sowjets verhaftet und danach bis Anfang 1950 im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald interniert (die Entlassung erfolgte trotz Intervention des IOC erst bei Auflösung des Speziallagers). Im Gegensatz zu seinem Comeback als Spitzenfunktionär des deutschen Sports (NOK-Präsident von 1951 bis 1961) nahm von Halt in den Nachfolgeinstituten der bis 1957 zerschlagenen Deutschen Bank keine leitende Funktion mehr ein. Lediglich dem Aufsichtsrat der Süddeutschen Bank gehörte er noch von 1952 bis 1957 an.
Zeige Inhalt von Hammonds, Kim
| Lebensdaten: | 21.05.1967 Battle Creek (Michigan) - 28.06.2022 |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: |
Mitglied des Vorstands vom 01.08.2016 - 24.05.2018 |
Kim Hammonds hatte einen MBA der Western Michigan University und einen Abschluss in Maschinenbau an der University of Michigan.
Sie bekleidete eine Reihe von Führungspositionen bei Dell und der Ford Motor Company in den Bereichen Produktentwicklung, Fertigung, Marketing und Technologiemanagement. Danach war sie von 2008 bis 2013 bei Boeing, zuletzt als Chief Information Officer (CIO).
2013 kam Kim Hammonds als Global Co-Head of Group Technology & Operations zur Deutschen Bank als Global Co-Head of Group Technology & Operations. Am 1. August 2016 wurde sie als Chief Operating Officer & Group Chief Information Officer in den Vorstand der Deutschen Bank aufgenommen und war verantwortlich für Technologie und interne Abläufe, Informationssicherheit, Datenmanagement, digitale Transformation und Corporate Services. Sie verließ die Deutsche Bank im Mai 2018.
Zeige Inhalt von Hansemann, Adolph von
| Lebensdaten: | 27.07.1826 in Aachen - 09.12.1903 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1857-1903 |
Adolph von Hansemann nahm am Ende des 19. Jahrhunderts für die Disconto-Gesellschaft eine ähnlich zentrale Stellung ein wie Georg von Siemens für die Deutsche Bank.
Wie sein Vater David zeigte auch Adolph Hansemann schon früh eine ausgesprochene Neigung für den Kaufmannsberuf. Nach dem Schulbesuch in Aachen schloss sich ab 1841 eine kaufmännische Lehrzeit in Hamburg, Berlin und Leipzig an. Als Siebzehnjähriger wurde er Teilhaber in der Tuchfabrik seines Vetters in Eupen. 1857 wurde er von seinem Vater als Geschäftsinhaber in die Disconto-Gesellschaft berufen. Während sich der Vater die Vertretung der Bank nach außen vorbehielt, fiel dem Juniorpartner zunächst die Organisation und Betreuung der laufenden Geschäfte zu.
Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1864 trat Adolph Hansemann die Nachfolge an. Er konnte jetzt seine eigenen, den gewandelten wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen angepassten Ideen und Pläne durchführen. Hansemann wurde einer der angesehensten und tatkräftigsten Bankiers der Bismarckzeit. Er machte die Disconto-Gesellschaft zur führenden Berliner Großbank. Unter seiner Geschäftsleitung stieg das Aktienkapital der Bank, die seit 1895 eng mit der Norddeutschen Bank in Hamburg verbunden war, von 30 auf 150 Millionen Mark, der Umsatz erweiterte sich von 840 Millionen 1857 auf 24,7 Milliarden Mark 1900. Die bereits von David Hansemann betriebene Konsortialbildung von Banken zwecks Unterbringung großer staatlicher oder privater Emissionen wurde unter Adolph fortentwickelt.
Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 fungierte Hansemann als Finanzberater der preußischen Regierung. Seiner Mission in London war es zu verdanken, dass erstmals ein deutsches Staatspapier, nämlich preußische Schatzanweisungen, die der Kriegsfinanzierung dienten, an einer ausländischen Börse untergebracht werden konnte. Hansemanns Erhebung in den erblichen preußischen Adelsstand im Jahre 1872 war wohl auch eine Honorierung seiner Verdienste um die deutschen Kriegsfinanzen.
Nach der Reichsgründung von 1871 erschlossen sich für Adolph Hansemann neue Betätigungsgebiete. So baute er die Beziehungen zur westdeutschen Montanindustrie systematisch aus. Bei der Gelsenkirchener Bergwerks-AG war er seit ihrer Gründung 1873 Aufsichtsratsvorsitzender. Die von ihm 1896 sanierte und in eine Gewerkschaft umgewandelte Mengeder Bergwerks AG erhielt seinen Namen.
Sein besonderes Augenmerk richtete er auch auf den weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes, für das sich schon sein Vater besonders engagiert hatte, jedoch beschränkte er sich jetzt nicht allein auf die Finanzierung inländischer Eisenbahnanlagen, sondern beteiligte sich auch an zahlreichen ausländischen Bahnunternehmen. So war er u. a. im Verwaltungsrat der Gotthardbahn-Gesellschaft und der Warschau-Wiener-Eisenbahn-Gesellschaft. Um 1890 finanzierte er zusammen mit der Norddeutschen Bank in Hamburg den Bau der Großen Venezuela-Eisenbahn. Bei Gründung der Schantung-Eisenbahn-Gesellschaft im Jahre 1899 übernahm er den Vorsitz im Aufsichtsrat, den er bis zu seinem Tode behielt. Schon in den 1870er Jahren gelang Hansemann die Sanierung der vor dem Zusammenbruch stehenden Rumänischen Eisenbahnen des "Eisenbahnkönigs" Bethel Henry Strousberg, gemeinsam mit dem Bankhaus Bleichröder.
In diese Zeit fällt auch der Beginn der Freundschaft zwischen Hansemann und den letzten Inhabern des Bankhauses Mayer Carl und Wilhelm Carl v. Rothschild. Die Frankfurter Rothschild der Carl-Linie starben 1901 aus und die Frankfurter Firma liquidierte. An ihre Stelle trat die Frankfurter Filiale der Disconto-Gesellschaft.
Die kolonialen Bestrebungen Deutschlands unterstützte Hansemann durch die Gründung der Deutschen See-Handelsgesellschaft, die den Erwerb von vier Samoa-Inseln durch das Deutsche Reich vorbereitete. 1885 hatte er die Neu-Guinea-Compagnie ins Leben gerufen. An der Erschließung fremder Bodenschätze war die Bank unter seiner Führung in China durch die Schantung-Bergwerksgesellschaft und in Südwestafrika durch die Otavi-Minen-Gesellschaft beteiligt.
Um die Jahrhundertwende vollzog er auch die Einschaltung seines Instituts in das Balkangeschäft, wo vor allem die Sanierung der rumänischen Eisenbahnen und ihr weiterer Ausbau übernommen wurde. Zusammen mit der Deutschen Erdöl AG stellte er das für die Erschließung der rumänischen Petroleumvorkommen notwendige Kapital zur Verfügung.
Auch auf dem Gebiet des Hypothekenbankwesens entfaltete Hansemann besondere Initiative. Nach überaus schwierigen Verhandlungen, an denen auch Bismarck ein lebhaftes Interesse bekundete, kam es 1870 zur Gründung der Preußischen Central-Bodenkredit-Aktiengesellschaft, in der die 1864 entstandene Preußische Hypotheken-Aktiengesellsebaft aufging. Daneben wirkte er an zahlreichen Bankgründungen in anderen europäischen Ländern sowie in Übersee mit.
Hansemann gehörte zu den reichsten Männer des Kaiserreichs; er war der Inbegriff des feudalistischen Bürgers. Er erwarb Güter im deutschen Osten und baute das Schloß Dwasieden auf der Insel Rügen. Insgesamt besaß er 7000 Hektar Ländereien. In seiner prunkvollen Villa in der Berliner Tiergartenstraße verkehrten führende Bankiers und Industrielle, Staatsmänner und Diplomaten aus aller Welt. Der politische Liberalismus, der in seinem Vater David Hansemann einen herausragenden Protagonisten hatte, war nicht die Sache Adolph von Hansemanns. Wie viele Industrielle und Bankiers des Kaiserreichs war er ein begeisterter Anhänger Bismarcks. Politisch sympathisierte er mit den Freikonservativen, den Anhängern Bismarcks, die sich auf Reichsebene "Deutsche Reichspartei" nannten.
weitere Informationen
Zeige Inhalt von Hansemann, David
| Lebensdaten: | 12.07.1790 Finkenwerder - 04.08.1864 in Schlangenbad |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1851-1864 |
Der Gründer der Disconto-Gesellschaft gehört zu den facettenreichsten Persönlichkeiten der deutschen Wirtschafts- und Finanzgeschichte im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Erst in fortgeschrittenem Alter begann David Hansemann, sich aktiv dem Bankgeschäft zuzuwenden. Bis dahin war er vor allem Kaufmann und Politiker gewesen.
Er wurde als jüngster Sohn einer kinderreichen Pfarrersfamilie geboren. Bereits mit 14 Jahren verließ er das Elternhaus und wurde kaufmännischer Lehrling. Als Handlungsgehilfe und Reisender für die Tuch- und Wollfabrik J. H. EIbers in Monschau und anschließend in seiner Tätigkeit für die Firma H. Eller und Orth in Elberfeld sammelte er die Kenntnisse, die es ihm ermöglichten, sich im Jahre 1817 selbständig zu machen. In Aachen gründete er mit seinen Ersparnissen in Höhe von 1000 Thalern ein Kommissionsgeschäft in Wolle. 1821 vermählte er sich mit der aus einer französischen Hugenottenfamilie stammenden Fabrikantentochter Fanny Fremery. Seine finanzielle Unabhängigkeit erlaubte es ihm, sich mehr und mehr öffentlichen Angelegenheiten zu widmen. Nach seiner Wahl in den Gemeinderat der Stadt Aachen sowie in die Aachener Industrie- und Handelskammer begann er, sich zunehmend mit sozialen Problemen zu beschäftigen. Dank seiner Initiative entstand 1824/25 die Aachener Feuerversicherungs-Gesellschaft, ein gemeinnütziges Unternehmen, das nicht nur dem Versicherungsbedürfnis breitester Kreise entgegenkam, sondern auch einen großen Teil seiner Gewinne der Arbeiter- und Jugendfürsorge zuführte.
Im Rahmen seines sozialen Wirkens gründete Hansemann 1834 den Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit, dem später Prämien- und Sparkassen, Abend- und Sonntagsschulen sowie Kinderhorte angegliedert wurden und dem stets seine besondere Anteilnahme galt. Sein rastloser Geist wandte sich bald neuen großen Aufgaben zu. Neben Friedrich Harkort und Friedrich List war er entscheidend an der Entwicklung des Eisenbahnwesens in Deutschland beteiligt. Von 1835 bis 1843 stand er als Präsident an der Spitze der von ihm mitbegründeten Rheinischen Eisenbahngesellschaft. Er bemühte sich vor allem auch um den Bau der Bahn zwischen Köln und Minden, die 1847 bis Hannover verlängert und dort an die bereits fertiggestellte Strecke Hannover-Berlin angeschlossen wurde. So war die erste Eisenbahnlinie zwischen den westlichen Provinzen des Landes Preußen und der Hauptstadt Berlin zu einem großen Teil der Initiative David Hansemanns zu verdanken. Die Kapitalbeschaffung für diese Projekte brachte ihn erstmals in engere geschäftliche Verbindung mit bekannten Kölner Bankiers.
Als Vertreter des liberalen rheinischen Bürgertums, zu dessen führenden Persönlichkeiten David Hansemann gehörte, trat er immer häufiger auch publizistisch hervor. 1845 war er Mitglied des Rheinischen Provinziallandtags, wo er u.a. für die volle Gleichberechtigung der Juden sowie die Beseitigung der Adelsprivilegien eintrat. 1847 wurde er als Abgeordneter in den Vereinigten Landtag in Berlin delegiert. Den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn bedeutete im Frühjahr 1848 die Berufung zum Preußischen Finanzminister im Kabinett Camphausen. Dieses Amt behielt er auch unter dem Ministerpräsidenten Auerswald bei, musste jedoch nach erneuter Kabinettsumbildung - als er mit seinen Reformplänen der Justiz-, Agrar- und Gemeindeverfassung zunehmend ins Kreuzfeuer der feudalen Reaktion geraten war - im September 1848 zurücktreten. Kurze Zeit später wurde er aufgrund seiner großen Erfahrungen auf finanzpolitischem Gebiet zum Chef der Preußischen Bank ernannt. 1852 lehnte er ein weiteres Mandat für das preußische Herrenhaus ab und zog sich wie viele Altliberale jener Zeit aus dem politischen Leben zurück. "Er war ein Bourgois entschieden westlicher Prägung, nach Ethos, Leistung und Denkgewohnheiten der Exponent einer bürgerlichen Führungsgruppe, in der die preußische Junkerpartei mit gutem Gespür ihren gefährlichsten Gegner sah." (Erich Angermann)
Inzwischen hatte Hansemann aber begonnen, sich ganz einer neuen Aufgabe zu widmen: der Gründung der Direction der Disconto-Gesellschaft in Berlin, die am 15. Oktober 1851 ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. David Hansemann hatte erkannt, dass die herkömmlichen Finanzierungsformen nicht ausreichten, um den wachsenden Kapitalbedarf der Industrie und des Verkehrswesens zu befriedigen.
1856 wurde die Disconto-Gesellschaft von einer Kreditgenossenschaft in die leistungsfähigere Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt. Damit war die Voraussetzung für ihre weitere Entwicklung zu einem der bedeutendsten Kreditinstitute Deutschlands geschaffen, das einen neuen Banktyp verkörperte und bald auch außerhalb Preußens die Konkurrenz mit der internationalen Haute Finance aufnehmen konnte. Viele der von Hansemann entwickelten bankpolitischen Methoden und Grundsätze wurden richtungweisend für das gesamte deutsche Bankwesen.
Mit der Führungsrolle der Disconto-Gesellschaft beim sogenannten Preußenkonsortium (das der Finanzierung der preußischen Mobilmachung diente) konnte Hansemann sein Institut ab 1859 im Emissionsgeschäft positionieren. Besondere Sorgfalt widmete er auch dem Depositengeschäft. Neben dem von Anfang an gepflegten Handels- und Diskontkredit nahm die Bank nach der Umwandlung von 1856 auch den Effektenhandel in eigener Rechnung auf.
David Hansemann blieb zu seinem Tod, seit 1857 gemeinsam mit seinem Sohn Adolph, Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft. Erst um die Jahrhundertwende musste die Disconto-Gesellschaft ihre Führungsrolle im deutschen Bankwesen auf vielen Gebieten an die Deutsche Bank abtreten, mit der sie schließlich 1929 fusionierte.
weitere Informationen:
Walther Däbritz – David Hansemann und Adolph von Hansemann
Historische Rundschau 2014/2, Nr. 31
Zitat
"Bei Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf, da muss bloß der Verstand uns leiten."
(aus einer Rede David Hansemanns als Abgeordneter der Preußischen Rheinprovinz am 8. Juni 1847 im Vereinigten Landtag, Berlin)
Zeige Inhalt von Hardt, Heinrich
| Lebensdaten: | 16.09.1822 in Lennep - 26.06.1889 in Berlin |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1889 |
Der Kaufmann Heinrich Hardt beteiligte sich bei der Gründung der Deutschen Bank mit 47 000 Talern, die er für sein in Berlin ansässiges Import- und Exportunternehmen Hardt & Co. erwarb. Bis zu seinem Tod war er Mitglied des Verwaltungsrats.
Seine Mutter Luise stammte aus der Kaufmannsfamilie Hasenclever und sein Vater Engelbert Hardt war Inhaber des Textilunternehmens Johann Wülfing & Sohn, das schon 1674 in Lennep gegründet worden war und Anfang des 19. Jahrhunderts in den Besitz der Familie Hardt überging. Früh wurde Heinrich an den Kaufmannsberuf herangeführt, so dass er schon in jungen Jahren, zusammen mit seinem jüngeren Bruder Richard, das väterliche Unternehmen in den USA vertrat. Dort gründeten die beiden 1847 die Vertriebsgesellschaft Hardt & Co., die sich anfangs vor allem um den Import und Export der Textilwaren von Johann Wülfing & Sohn kümmerte. Im Jahr 1854 konnte eine Niederlassung in Berlin eröffnet werden, weitere folgten in Lyon, Verviers, Sydney und in verschiedenen südamerikanischen Städten Argentiniens, Boliviens, Chiles und Perus.
Die vielen Standorte, deren wichtigste New York und Berlin waren, führten dazu, dass sich die Brüder im dreijährigen Turnus mit ihrer Präsenz an diesen zwei Orten abwechselten. Heinrich und seine Frau Ottilie, geborene Bernuths, pendelten zwischen Europa und den USA und waren Mitglied der German Society in New York und beteiligt an der German Life Insurance Company. Dort kam er in Verbindung mit anderen Geschäftsleuten, von denen mehrere 1870 ebenfalls Anteile an der Deutschen Bank erwarben.
Zeige Inhalt von Hauenschild, Manfred O. von
| Lebensdaten: | 29.07.1906 in Leobschütz - 10.08.1980 Königstein im Taunus |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1959-1972 |
Vor seinem Jurastudium absolvierte von Hauenschild eine Lehre bei einer Bremer Baumwollimportfirma. Nach dem Assessorexamen begann er seine berufliche Laufbahn 1934 als Syndikus bei der Deutsche Centralbodenkredit AG in Berlin. Von 1940 bis 1945 gehörte er dem Vorstand der Mecklenburgischen Hypotheken- und Wechselbank in Schwerin an.
Nach Kriegsende trat er 1946 in die Deutsche Bank ein und wirkte in der Zeit der Teilbanken an der Wiedererrichtung des Hauses mit; seit 1952 als Direktor mit Generalvollmacht bei der Norddeutschen Bank. 1959 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, dem er bis zu seiner Pensionierung angehörte. Er widmete sich vor allem organisatorischen und juristischen Aufgaben, die sich aus der Hinwendung der Deutschen Bank zum Mengengeschäft ab 1959 ergaben, namentlich dem Spar- und Kleinkreditgeschäft sowie der Automation in der Frühphase des Computereinsatzes in der Deutschen Bank. Die Veränderungen, die den breiten Einstieg ins Privatkundengeschäft für die Geschäftsabläufe innerhalb der Bank mit sich brachten, fasste von Hauenschild in neun "Grundsätzen des debitorischen und kreditorischen Mengengeschäfts" zusammen.
Als Regionalressort war er für den bayrischen Filialbezirk zuständig. Zu seinen wichtigen Aufsichtsratsmandaten gehörten der Vorsitz bei den Bayerischen Elektrizitäts-Werken, der Bremer Woll-Kämmerei und der Deutschen Linoleum-Werke AG.
Im Bundesverband deutscher Banken fungierte er als Leiter der Wettbewerbskommission. Außerdem war von Hauenschild viele Jahre Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags.
Zeige Inhalt von Hecker, Emil
| Lebensdaten: | 1837 - 31.05.1915 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1869-1883 |
Mit 21 Jahren trat Emil Hecker in die Disconto-Gesellschaft ein. Nachdem er Prokura erhalten hatte, war er für das Börsengeschäft der Bank zuständig. Infolge des Rückzugs Meyer Goldschmidts aus der Geschäftsleitung wurde Hecker, zusammen mit Johannes von Miquel und Adolph Salomonsohn, als Geschäftsinhaber berufen. Auch in dieser Eigenschaft gehörte der Börsenbesuch weiter zu seinem Aufgabenbereich, bis er - mit der Erweiterung des laufenden Geschäfts - die Leitung des Direktionsbüros übernahm. Für den Börsenbesuch wurden nun Börsendirektoren aus dem Kreis der Prokuristen bestellt. 1883 schied Hecker krankheitsbedingt aus der Geschäftsleitung aus, gehörte aber noch bis zu seinem Tod dem Verwaltungsrat (seit 1885 als Aufsichtsrat bezeichnet) der Disconto-Gesellschaft an.
Zeige Inhalt von Heinemann, Elkan
| Lebensdaten: | 17.01.1859 in Bayreuth - 19.09.1941 in Nizza |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1906-1923 |
"Von keinem Vorstandsmitglied der Deutschen Bank aus der Ära Georg v. Siemens und Arthur v. Gwinner ist so wenig bekannt wie von Elkan Heinemann. 38 Jahre gehörte er der Bank an, 17 Jahre war er Mitglied des Vorstandes. Sogar auf der Höhe seines Wirkens wußten die Zeitgenossen kaum etwas über ihn. Er lebte hinter seinem Schreibtisch." (Fritz Seidenzahl) Elkan Heinemanns Vater war Lehrer an der israelitischen Religionsschule in Bayreuth. Nach Lehrjahren, vermutlich in Antwerpen und Brüssel, trat er 1886 in das Sekretariat der Deutschen Bank in Berlin ein. 1893 erhielt er Prokura und wurde bald danach Leiter des Sekretariats. Von 1902 bis 1905 war er stellvertretender Direktor, Anfang 1906 wurde er auf Empfehlung von Hermann Wallich in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Heinemann galt im Vorstand eher als der präzise "Wissenschaftler", als Mann der zweiten Reihe, der turbulente und riskante Geschäftskomplexe eher scheute. Vor allem mit Arthur von Gwinner teilte er sich Aufgaben des Auslandsgeschäft. Sein Engagement galt hier namentlich der 1898 gegründeten Deutsch-Überseeischen Elektricitäts-Gesellschaft. Von den Senioren des Auslandsgeschäfts war er der einzige, der unter den völlig veränderten Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg weiter aktiv blieb und noch bis 1923 dem Vorstand angehörte. Schon sehr früh hatte er den Verfall der deutschen Währung vorhergesehen. Nach seinem Ausscheiden siedelte er nach Frankreich über, wo er während des Zweiten Weltkriegs starb.
Zeige Inhalt von Helfferich, Karl
| Lebensdaten: | 22.07.1872 in Neustadt - 23.04.1924 in Bellinzona |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1908-1915 |
Karl Helfferich ist vor allem in seiner Eigenschaft als Währungspolitiker bekannt, während seine Tätigkeit als Bankier außerhalb der Deutschen Bank weniger in Erinnerung geblieben ist.
Helfferich stammte aus einer Industriellenfamilie der Vorderpfalz; sein Vater war Inhaber einer Trikotagenfabrik. Nach einem Studium der Staatswissenschaften in München. Berlin und Straßburg, das er 1894 mit der Promotion zum Dr. rer. pol. abschloss, arbeitete er in Berlin als Wissenschaftler und Journalist über die Themen Geldtheorie, Währungsfragen und - verstärkt nach Ende des Ersten Weltkriegs - Politik (mehr als 150 Titel). 1899 habilitierte er über "Die Reform des Deutschen Geldwesens nach der Begründung des Deutschen Reiches". 1901 wurde er als Referent für wirtschaftliche Angelegenheiten in die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts berufen. 1903 erschien seine wohl bedeutendste Studie mit dem prägnanten Titel "Das Geld". Mit diesem umfangreichen Werk, das einen historischen und theoretischen Teil umfasst, war Helfferich als einer der führenden deutschen Geldtheoretiker ausgewiesen.
1906 übernahm Helfferich, auf Empfehlung Arthur von Gwinners, die Direktion der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft und siedelte nach Konstantinopel über. Dort erreichte er nach komplizierten Verhandlungen und der Gründung der Bagdadbahn-Gesellschaft, den Weiterbau der Bagdadbahn über das Taurusgebirge hinaus. 1908 kehrte er nach Deutschland zurück und trat in den Vorstand der Deutschen Bank ein, dem er bis 1915 angehörte. Neben dem Aufgabengebiet der Bagdadbahn, galt Helfferichs Interesse vor allem den Engagements der Deutschen Bank in den Kolonialgebieten. Seine Bemühungen um den Ausbau der deutsch-belgischen Beziehungen in Afrika zahlten sich für die Deutsche Bank in umfangreichen Schürfrechten in Katanga und einer erheblichen Beteiligung an der Kongo-Flußschiffahrts-Gesellschaft aus. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kamen die kolonialen Projekte zum Erliegen.
Helfferich schied 1915 aus dem Vorstand der Deutschen Bank aus und wurde, seit 1911 Mitglied im Zentralausschuss der Reichsbank, zum Staatssekretär des Reichsschatzamts berufen. 1916/17 war er Staatssekretär des Innern und Vizekanzler unter Reichskanzler Michaelis. Die Niederlage von 1918 führte bei Helfferich, der gerade in seiner Zeit als Bankier eher liberale Standpunkte vertrat, zu einem politischen Gesinnungswechsel nach rechts. 1919 trat er der Deutschnationalen Volkspartei bei. Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation legte er im August 1923 einen Plan zur Schaffung einer stabilen deutschen Währung ("Roggenwährung") vor. Auch wenn die schließlich realisierte Lösung erheblich von Helfferichs Vorschlägen abwich, wurde er später als "Vater der Rentenmark" bezeichnet. Obwohl vom Reichsbankdirektorium als neuer Reichsbankpräsident vorgeschlagen, entschied sich die Reichsregierung Ende 1923 bei der Besetzung des Amts gegen Helfferich und für Hjalmar Schacht. Wenig später wurde er Opfer eines Eisenbahnunglücks.
Helfferich war seit 1920 mit einer Tochter Georg von Siemens' verheiratet und schrieb die dreibändige Biographie über den ersten Vorstandssprecher der Deutschen Bank: "Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands großer Zeit".
Zeige Inhalt von Herrhausen, Alfred
| Lebensdaten: | 30.01.1930 in Essen - 30.11.1989 in Bad Homburg |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1970-1989 (Sprecher 1985-1989) |
Nach dem Besuch der Oberrealschule begann Herrhausen, der nach eigener Aussage ursprünglich Philosophie studieren wollte, 1949 mit dem Studium der Betriebswirtschaft in Köln. Der Diplom-Kaufmanns-Prüfung 1952 folgte 1955 die Promotion zum Dr. rer. pol. mit einer Arbeit über ein Gebiet der modernen Volkswirtschaft. Während der Doktorandenzeit war er als Direktionsassistent bei der Ruhrgas AG, Essen, beschäftigt. Sein weiterer Berufsweg führte ihn 1955 als Direktionsassistent in die Hauptverwaltung der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) nach Dortmund. Als Kredit-Sachbearbeiter und Finanz-Analytiker sammelte er zwischenzeitlich in New York Auslandserfahrungen im Bankgeschäft. 1957 wurde ihm bei den VEW Handlungsvollmacht erteilt und zwei Jahre später Prokura; gleichzeitig damit übernahm er die kaufmännische Leitung der VEW-Hauptverwaltung. 1960 wurde Herrhausen zum Direktor ernannt. Er war maßgeblich an den Vorarbeiten und der Verwirklichung der VEW-Teilprivatisierung im Jahre 1966 beteiligt. Nach deren Realisierung wurde er 1967 zum Vorstandsmitglied berufen.
Zwischen 1956 und 1968 veröffentlichte Herrhausen zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften zu Fragen der nationalen und internationalen Energieversorgung, der Unternehmensfinanzierung und des Aktienrechts. In dieser Zeit war er u. a. Lehrbeauftragter an der Sozialakademie Dortmund sowie im Rahmen der verbandseigenen Ausbildung der Arbeitsgemeinschaft Energie für Energiewirtschaft, Investitionsrechnung und Industriebetriebslehre. Sein besonderes berufliches Interesse galt allen Fragen der modernen Unternehmensführung, insbesondere der Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung einschließlich Investitionsrechnung und linearer Programmierung sowie Unternehmensbewertungen.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1970 wurde Herrhausen vom Aufsichtsrat der Deutschen Bank zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes berufen. Er war verantwortlich für das internationale Geschäft in Nord- und Südamerika, Australien, Neuseeland und Südafrika, das damals noch unterentwickelt war, sowie für die Außenhandelsfinanzierung der Bank und volkswirtschaftliche Fragen; außerdem betreute er den Filialbereich Essen. 1971 holte er sich gegen mancherlei Widerstände aus dem Kollegenkreis beim Vorstandssprecher Franz Heinrich Ulrich die Zustimmung zum Aufbau einer "strategischen Planung".
Je länger er dem Vorstand angehörte, desto mehr Aufsichtsratssitze fielen ihm naturgemäß zu. Herrhausen begann seine Bewährungsproben bei den sanierungsreifen Stollwerck AG und Continental AG, später rückte er in viele andere einflußreiche Positionen. 1979 strebte er die Nachfolge von Joachim Zahn als Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzender an, ein Karriereschritt, den er jedoch nicht verwirklichen konnte: "Immerhin ist Daimler-Benz das größte Investment der Deutschen Bank. Da hätte ich etwas gestalten können. Damit wäre das auch im Interesse der Deutschen Bank gewesen." Neun Jahre später setzte Herrhausen das SPD-Mitglied Edzard Reuter als Vorstandsvorsitzenden bei Daimler durch.
Bereits früh strebte der Bankier "politische" Ämter an. Der Bundesfinanzminister berief Herrhausen als Mitglied der Studienkommission "Grundsatzfragen der Kreditwirtschaft" ("Bankenstruktur-Kommission"), deren Auftrag es war, die Struktur der deutschen Kreditwirtschaft zu prüfen und Vorschläge zur Verbesserung des Kreditwesens zu erarbeiten. Auslöser war die Herstatt-Pleite 1974. Die Novellierung des Kreditwesengesetzes basiert wesentlich auf der Arbeit dieser Kommission. Später beauftragte die Bundesregierung ihn, zusammen mit zwei weiteren "Stahlmoderatoren" ein Konzept zur Neuordnung der deutschen Stahlindustrie zu erarbeiten; der Plan führte nicht zum Erfolg. Herrhausen gehörte zu den Initiatoren des "Initiativkreis Ruhrgebiet". Er war außerdem einer der Mitbegründer des "Aktionskomitees für Europa", eine Vereinigung einflussreicher europäischer Industrieller, die den europäischen Integrationsprozess unterstützen. Zudem war er Mitglied des Direktoriums der ersten deutschen Privatuniversität Witten-Herdecke.
1985 wurde Herrhausen zu einem der beiden Sprecher des Vorstandes, gewählt. Er übte das Amt zusammen mit F. W. Christians aus. Am 11. Mai 1988 wurde er alleiniger Sprecher. "Macht muss man auch wollen" war eine häufig zitierte Wendung Alfred Herrhausens, der mit der Besetzung einer Spitzenposition in der Wirtschaft auch die Chance begriff, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. In seiner Amtszeit griff er vielfach soziale und ökologische Fragestellungen auf. Angesichts der gravierenden Schuldenprobleme der Dritten Welt engagierte sich Herrhausen als erster Vertreter einer Großbank für einen an Wirtschaftsreformen geknüpften Schuldennachlass. Seine starke Präsenz in den Medien verschaffte ihm einen - bis dahin für einen Bankmanager eher ungewöhnlich - hohen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit.
Am 30. November 1989 wurde Alfred Herrhausen Opfer eines bis heute nicht aufgeklärten Terroranschlags. Er ist Namensgeber der 1992 gegründeten "Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog".
weitere Informationen
Friederike Sattler - Herrhausen – Banker, Querdenker, Global Player. Ein deutsches Leben
Kurt Weidemann (Hrsg.) - Alfred Herrhausen: Denken. Ordnen. Gestalten. Reden und Aufsätze
Ans Licht geholt - Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]
Zitate
"Freiheit - und Offenheit, die damit einhergeht - wird uns nicht geschenkt. Die Menschen müssen darum kämpfen, immer wieder."
"Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein."
"Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt."
"Es ist kein Luxus, Begabte zu fördern. Es ist ein Luxus, und zwar ein sträflicher, dies nicht zu tun."
Zeige Inhalt von Herz, Wilhelm
| Lebensdaten: | 26.04.1823 in Bernburg - 28.09.1914 in Berlin | 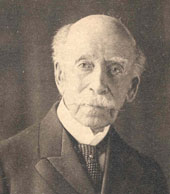 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1876-1889, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 1889-1907, Vorsitzender des Aufsichtsrats 1907-1914 |
Der Seniorchef der Berliner Öl- und Gummifabrik S. Herz, Geheimer Kommerzienrat Wilhelm Herz, war seit der Gründung der Deutschen Union-Bank in Berlin (1871) deren Aufsichtsratsvorsitzender gewesen und trat nach ihrer Liquidation 1876 in den Verwaltungsrat der Deutschen Bank über. Diesem Gremium hat er 38 Jahre bis zum seinem Tod angehört, seit 1889 als stellvertretender Vorsitzender und seit 1907 als Vorsitzender. Mit Georg von Siemens verband ihn eine enge Freundschaft. Er war eine im Berliner Geschäftsleben und darüber hinaus weitbekannte Persönlichkeit, die der Bank zahlreiche wertvolle Verbindungen vermittelte. Neben der Deutschen Bank war er im Aufsichtsrat der Deutschen Ueberseeischen Bank, der Hypothekenbank in Hamburg, der Schultheiss Brauerei, zu deren Gründern er auch gehörte, und der Berliner Land- und Transport-Versicherungs-Gesellschaft. Er war ausschlagend an der Entwicklung der Speiseölindustrie in Deutschland beteiligt und weithin als „Öl-Herz“ bekannt. Außerdem gründete er 1869 in Berlin eine Gummiwarenfabrik. Jahrzehntelang war er Mitglied des Ältesten-Kollegiums der Kaufmannschaft, seit 1895 sein Präsident. 1902 wurde er zum Präsidenten der neugegründeten Berliner Handelskammer gewählt und trat damit als Neunundsiebzigjähriger an die Spitze der größten und ersten amtlichen Wirtschaftsvertretung Berlins, was seine besondere Stellung im Wirtschaftsleben der Reichshauptstadt deutlich macht. An seinem 90. Geburtstag wurde ihm als erstem Kaufmann in Deutschland der ansonsten nur für die höchsten Beamten vorbehaltene Titel „Exzellenz“ verliehen.
Zeige Inhalt von Heydebreck, Tessen von
| Lebensdaten: | 09.01.1945 in Orth/Pommern |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1994-2007 |
Zeige Inhalt von Heydt, Eduard von der
| Lebensdaten: | 30.05.1828 in Elberfeld - 04.07.1890 in Berlin |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats 1870-1887 |
Unter den Gründern der Deutschen Bank würde man den Namen von der Heydt im Zusammenhang mit dem angesehenen Bankhaus von der Heydt-Kersten & Söhne erwarten, doch Eduard engagierte sich als Privatperson und zeichnete 63 400 Talern. Er war schon früh in den Planungsprozess involviert und wurde in der ersten Generalversammlung nicht nur in den Verwaltungsrat gewählt, sondern war auch Mitglied des wöchentlich zusammentreffenden Fünferausschusses, der das Geschäft koordinierte. Im Verwaltungsrat hatte er zusätzlich das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Die erste Finanzanzeige der Deutschen Bank in der Frankfurter Zeitung vom 24./25. März 1870 führt ihn als Inhaber des Unternehmens E. von der Heydt in Berlin auf, das nicht viele Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Aus dem Bankhaus schied er 1887 auf Grund von internen Auseinandersetzungen aus. Von der Heydt lehnte insbesondere politische Aktivitäten der Vorstandsmitglieder ab und sprach sich so gegen die parlamentarische Tätigkeit des Vorstandssprechers Georg Siemens aus. Siemens setzte sich jedoch durch, so dass von der Heydt schließlich die Bank verließ. Als Verwaltungsrat der Deutschen Bank galt sein Augenmerk zusammen mit Delbrück dem Aufbau der ersten Filialen der Deutschen Bank.
Die angesehenen Familie der Von der Heydts war mit Eduards Vater August 1863 in den Freiherrenstand erhoben worden. August von der Heydt war nicht nur erfolgreicher Bankier, sondern auch als Parlamentarier und Politiker aktiv. Auf Grund seiner politischen Karriere zog er sich aus dem Bankgeschäft zurück und überließ seinen zwei Brüdern die Leitung des Bankhauses von der Heydt-Kersten & Söhne, vor allem Carl von der Heydt tat sich dabei hervor. Von den Söhnen August von der Heydts war nur der älteste Mitinhaber der Bank, so dass Eduard als zweitgeborener einen anderen Weg einschlug. Er reiste nach New York, heiratete dort die Diplomatentochter Alice Rosalie Schmidt und wurde selbst zum preußischen Konsul berufen. In den USA knüpfte er etliche Beziehungen, so agierte er als Mitglied der Direktion der German Life Insurance Company und der dortigen German Society. In Folge dessen hatte er Kontakt mit weiteren Gründern der Deutschen Bank wie Hermann Marcuse, Heinrich Hardt und Gustav Kutter, die ebenfalls in den Verwaltungsrat gewählt wurden. Auf Grund seiner Erfahrungen in den Vereinigten Staaten war er eingebunden in die Amerika-Geschäfte der Bank.
Eduard von der Heydt war in seinen späteren Jahren in Berlin ansässig und an Gründungen und Finanzierungen beteiligt, teilweise auch zusammen mit anderen Führungspersönlichkeiten der Deutschen Bank. Gemeinsam mit Georg Siemens und Hermann Wallich gründete er unter anderem die Woll-Import Gesellschaft und mit Siemens, Delbrück und Kutter die Berliner Hotel- und Baugesellschaft. Im Jahr seines Todes wurde er in den Aufsichtsrat der mit der Deutschen Bank konkurrierenden Disconto-Gesellschaft gewählt.
Zeige Inhalt von Hoeter, Joseph
| Lebensdaten: | 03.07.1846 in Münster - 02.05.1924 in Berlin | 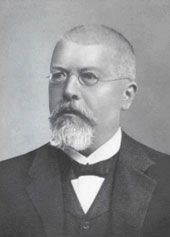 |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1900-1907 |
Nach einem Jurastudium arbeitete Hoeter zunächst im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Berlin. Hier wurde er zum Vortragenden Rat und später zum Geheimen Oberregierungsrat befördert und kam schließlich als Eisenbahndirektionspräsident nach Köln. Aus dieser Stellung holte ihn Adolph von Hansemann im Jahre 1900 in die Geschäftsleitung der Disconto-Gesellschaft. 1907 wechselte er in die Geschäftsleitung der von der Bank mitbegründeten Schantung-Eisenbahngesellschaft, um sich dort erneut als Eisenbahnfachmann zu betätigen, gehörte aber bis zu seinem Tod noch weiter dem Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft an.
Zeige Inhalt von Hooven, Eckart van
| Lebensdaten: | 11.12.1925 in Hamburg - 28.12.2010 in Hamburg |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1972-1991 |
Der in Hamburg geborene Eckart van Hooven verbrachte den größten Teil seiner Schulzeit in Berlin, wo er 1943 sein Abitur ablegte und anschließend zur Wehrmacht eingezogen wurde. Nach Kriegsende widmete er sich zunächst journalistischen Aufgaben und war zeitweilig beim Sender Hamburg tätig. 1947 nahm er ein Jurastudium in Hamburg auf (1951 Referendarexamen, 1955 Assessorexamen und Promotion zum Dr. jur.). 1955 trat er in die Filiale Hamburg der Norddeutschen Bank ein, wie damals die noch nicht wiedervereinigte Deutsche Bank firmierte. Nach einem Jahr wurde er Zweigstellenleiter in der Hansestadt, bald darauf Mitleiter der Filiale Hamburg-Harburg. 1967 wurde er Direktor und drei Jahre später Generalbevollmächtigter. 1972 folgte die Berufung in den Vorstand der Deutschen Bank, dem er bis 1991 angehörte.
Eckart van Hoovens Name ist eng mit der Entwicklung des Mengengeschäfts in der Deutschen Bank verbunden, das 1959 mit der Einführung des Persönlichen Klein-Kredits begann. Unter Manfred O. von Hauenschild war van Hooven mit der Organisation dieses neuen Geschäftszweigs betraut, nach seiner Berufung in den Vorstand war er dort für das Privatkundengeschäft zuständig. An der Entwicklung des für den bargeldlosen Zahlungsverkehr bahnbrechenden eurocheques, der 1969 in 18 europäischen Ländern eingeführt wurde, war van Hooven maßgeblich beteiligt. Auch die Aktivitäten der Deutschen Bank im Versicherungs- und Bauspargeschäft wurden von ihm vorangetrieben.
In seine regionale Zuständigkeit als Vorstandsmitglied fielen die Filialbezirke der Deutschen Bank in den Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck. Mit besonderem Nachdruck setzte sich van Hooven für die Wirtschaft Norddeutschlands und eine enge Zusammenarbeit mit den skandinavischen Ländern ein. 1990 übernahm er den Aufsichtsratsvorsitz der Deutschen Maschinen- und Schiffsbau AG in Rostock, einer Holding, die aus dem früheren Kombinat Schiffbau der DDR hervorgegangen war.
Während und nach dem Ende seiner beruflichen Tätigkeit engagierte sich Eckart van Hooven in der Hamburger Kommunalpolitik.
Zeige Inhalt von Hunke, Heinrich
| Lebensdaten: | 08.12.1902 in Heipke/Lippe - 08.01.2000 in Hannover |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1944-1945 |
Mit der Ernennung von Heinrich Hunke zum Vorstandsmitglied der Deutschen Bank im September 1943 gab die Bank dem seit Ende 1942 deutlich gewordenen Drängen nach, einen weiteren Nationalsozialisten in ihre Leitung aufzunehmen. Zwar war mit Karl Ritter von Halt bereits seit 1938 ein prominenter Parteimann im Vorstand vertreten, doch dieser, der sich stets loyal gegenüber der Bank verhielt, war immer weniger in der Lage, politisch motivierte Angriffe abzuwehren.
Hunke hatte sich nicht wie viele Angehörige der Wirtschaftselite aus Opportunismus für eine Mitgliedschaft in der NSDAP entschieden, sondern war schon 1928 aus Überzeugung der Partei beigetreten. Ursprünglich hatte er eine Ausbildung zum Volksschullehrer durchlaufen, studierte dann aber Volkswirtschaft und wurde 1927 zum Dr. rer. nat. promoviert. Von 1927 bis 1933 war er als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter und Referent im Reichswehrministerium tätig. Daneben wirkte er seit 1928 als sogenannter Gauwirtschaftsberater des Gaues Berlin der NSDAP und gründete 1932 die führende nationalsozialistische Wirtschaftszeitschrift „Die deutsche Volkswirtschaft“. Dem Reichstag gehörte er als NSDAP-Abgeordneter seit 1932 an. 1935 erhielt er eine Honorarprofessur an der Technischen Hochschule Berlin. 1933 wurde Hunke vom Reichspropagandaministerium zum stellvertretenden Präsidenten des Werberats der deutschen Wirtschaft ernannt, womit die Aufgabe der Neuordnung des Werbewesens verbunden war. 1939 wurde er Präsident des Werberats der deutschen Wirtschaft. Außerdem übernahm er Anfang 1941 als Ministerialdirektor die Leitung der Abteilung Ausland des Reichspropagandaministeriums, die die Aufgabe hatte, das Konzept einer europäischen Wirtschaftsordnung unter deutscher Führung in den besetzten Staaten zu popularisieren.
Hatte Hunke noch Ende 1942 ein Angebot, in den Vorstand der Deutschen Bank einzutreten, abgelehnt, so war er ein halbes Jahr später von seiner Tätigkeit im Propagandaministerium derart enttäuscht, dass er unter Vermittlung von Reichswirtschaftsminister Walther Funk zur Deutschen Bank wechselte. Nachdem seine Nachfolgefrage im Propagandaministerium geklärt war, trat er am 1. Februar 1944 in den Vorstand der Bank ein. In dem verbleibenden Jahr bis zum Kriegsende konnte er keine merkliche Geschäftstätigkeit entfalten, leistete der Bank aber in einigen kritischen Konfliktsituationen mit dem NS-Staat nützliche Dienste.
Ende April 1945 floh Hunke vor der Roten Armee von Berlin nach Hamburg, wo er auf Anweisung der Militärregierung aus der Deutschen Bank entlassen werden musste. Nach amerikanischer Haft gelang Hunke in den frühen 1950er Jahren die Rückkehr in den Beamtenstatus. Er wurde im niedersächsischen Finanzministerium tätig, wo er zuletzt den Rang eines Ministerialdirigenten bekleidete.
Zeige Inhalt von Jain, Anshu
| Lebensdaten: | 07.01.1963 in Jaipur (Indien) - 13.08.2022 London |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 2009 bis 2015 (von 2012 bis 2015 Co-Vorsitzender des Vorstands) |
Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften am Shri Ram College in Delhi, studierte Anshu (Anshuman) Jain ab 1983 Betriebswirtschaft an der University of Massachusetts. Seine wissenschaftliche Ausbildung schloss er 1985 mit einem MBA (Master of Business Administration) in Finanzwissenschaften ab. Im Anschluss war er für Kidder Peabody, New York, im Derivate Research tätig. 1988 wechselte er zu Merrill Lynch, New York, wo er den Bereich Globale Hedge-Fonds aufbaute und verantwortete.
1995 trat Jain in die Deutsche Bank ein und leitete ab 2001 das globale Kapitalmarktgeschäft des Konzerns. 2009 wurde er in den Vorstand berufen, wo er seit 2010 für den Geschäftsbereich Unternehmens- und Investmentbank zuständig war. Von 2012 bis 2015 war er, gemeinsam mit Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands.
Zu seinen Auszeichnungen zählten die Ehrendoktorwürde der TERI-Universität in Neu-Delhi und die Wahl zum Honorary Fellow der London Business School.
Zeige Inhalt von Janberg, Hans
| Lebensdaten: | 17.04.1909 in Recklinghausen - 19.09.1970 |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1957-1970 |
Nach einem rechtswissenschaftlichen Studium und einer Zeit als Richter am Landgericht Münster trat der promovierte Jurist 1936 als Volontär bei der Deutschen Bank Filiale Freiburg ein und wechselte später in die Filiale Mannheim. Nach dem Krieg war er in verschiedenen Niederlassungen der Rheinisch-Westfälischen Bank tätig, in deren Vorstand er 1953 berufen wurde. Nach der Wiedererrichtung der Deutschen Bank gehörte er ihrem Vorstand bis zu seinem Tod an. In seine Zuständigkeit fielen die Bereiche Personal, Oberbuchhalterei und die Volkswirtschaftliche Abteilung sowie die Filialbezirke Düsseldorf und Münster. Wichtige Aufsichtsratsmandate waren der Vorsitz bei Hoesch und Gebr. Stollwerck. Janbergs großes Interesse galt der Entwicklung der Arbeitswelt, vor allem im Zuge der rasch fortschreitenden Automation in Großunternehmen. Intensiv widmete er sich den Gebieten Mitarbeiterförderung und Ausbildungsfragen. Seine 1958 erschienene Sozialstudie "Die Bankangestellten" gilt als Standardwerk in der Darstellung des gesellschaftlichen Standorts dieses Berufszweiges in der Nachkriegszeit. Hans Janberg war nach 1945 der erste Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankgewerbes. Weiterhin gehörte er dem Kuratorium der Gesellschaft zur Förderung des Unternehmernachwuchses an.
Zeige Inhalt von Jentges, Wilhelm
| Lebensdaten: | 15.06.1825 in Krefeld - 16.06.1884 in Krefeld |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1884 |
Wilhelm Jentges war einer der rheinischen Vertreter der Textilbranche im Verwaltungsrat der Deutschen Bank, dem er seit der ersten Sitzung bis zu seinem Tod angehörte. Er war der Sohn von Isaak Wilhelm Jentges und Anna Jentges, geborene von Beckerath, die einer angesehenen Krefelder Unternehmerfamilie angehörte. Die Familienmitglieder besaßen verschiedene Textilfabriken, unter anderem die 1841 von Jacob von Beckerath gegründete Jac. Von Beckerath Joh. Sohn, deren Teilhaber Jentges wurde. Für dieses Unternehmen erwarb er bei der Gründung der Deutschen Bank für 37 600 Taler Aktien, außerdem vertrat er drei weitere rheinische Textilunternehmen. Jentges engagierte sich auch bei anderen Unternehmen; so war er ab 1875 Mitglied im Administrationsrat des A. Schaaffhausen’schen Bankverein und saß in verschiedenen Verwaltungsräten von Eisenbahn- und Industriegesellschaften.
Neben seinen kaufmännischen Tätigkeiten widmete sich Jentges der Politik. Er war in der Kommunalpolitik Krefelds tätig, und später im Provinziallandtag der Rheinprovinz. Zum Jahreswechsel 1882/83 wurde er Vertreter seiner Stadt im Preußischen Herrenhaus.
Zeige Inhalt von Jonas, Paul
| Lebensdaten: | 19.02.1830 in Schwerinsburg - 21.01.1913 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1881-1887, Aufsichtsratsmitglied 1887-1910 |
Paul Jonas stammte aus einer ursprünglich jüdischen Familie. Sein Großvater, Kaufmann in Neustadt an der Dosse, war 1796 zum Christentum übergetreten. Dessen Sohn Ludwig Jonas studierte Theologie bei Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher in Berlin, dessen Nachlass er später herausgab, und lernte bei einem längeren Aufenthalt in Schwerinsburg Elisabeth Gräfin von Schwerin kennen, die er im April 1829 heiratete. Er betätigte sich als theologischer Schriftsteller und trat als liberaler Politiker hervor. Einer der Söhne von Ludwig Jonas war Paul Jonas. Nach seinem juristischen Studium in Berlin, Heidelberg, Halle und zuletzt wieder Berlin wurde er im Jahre 1860 zunächst Regierungsassessor und danach Eisenbahndirektionspräsident in Berlin und Elberfeld. Wohl unter Einfluss seines Schwagers Adelbert Delbrück, der seit 1853 mit Luise Jonas verheiratet war, quittierte er 1880 seinen Dienst. Der Privatbankier Delbrück, der als eigentlicher Initiator der Deutschen Bank gilt, wollte Jonas für die Deutsche Bank gewinnen. Am 1. Dezember 1881 trat Jonas in Direktion der Deutschen Bank ein, die, wie es offiziell hieß, aufgrund der „Erhöhung des Gesellschafts-Capitals und [der] zu erwartende[n] Vermehrung der Arbeit“ verstärkt wurde. Delbrück wollte ihn Georg Siemens an die Seite geben und, wie Siemens selbst vermutete, zu seinem Nachfolger aufbauen. Jonas beschäftigte sich vor allem mit Eisenbahnfinanzierung, an denen sich die Deutsche Bank in diesen Jahren zu beteiligen begann. Vor allem die Beteiligung an der Northern Pacific Railway in der USA stand auf dem Programm. Der unternehmenslustige Siemens und der besonnene, kenntnisreiche Verwaltungsbeamte Jonas waren aber zu entgegengesetzte Naturen, um auf Dauer zusammenzuarbeiten. 1887 kam es zum Bruch zwischen beiden. Paul Jonas schied aus dem Vorstand aus und ging in den Aufsichtsrat, dem er bis 1910 angehörte.
Zeige Inhalt von Kaiser, Hermann
| Lebensdaten: | Unbekannt |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1872-1875 |
Zeige Inhalt von Kehl, Werner
| Lebensdaten: | 27.03.1887 in Bochum - 04.01.1943 in Hannover | 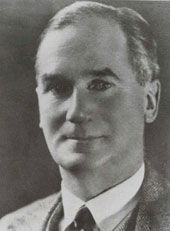 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied der Geschäftsleitung 1928-1932 |
Der Sohn eines Fabrikanten trat nach einem rechtswissenschaftlichen Studium im November 1919 in die Deutsche Bank Filiale Düsseldorf ein, wo er binnen weniger Jahre zum Direktor aufstieg (1922). In der Berliner Zentrale wurde man schnell auf Kehl aufmerksam, der eine Reihe großer Abschlüsse im rheinisch-westfälischen Industrierevier getätigt hatte. Bereits 1926 wurde er stellvertretendes, 1928 ordentliches Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Sein Aufgabenbereich bestand vor allem in der Pflege der westdeutschen Industriebeziehungen. Im Aufwind der Konzentrationsbewegung Ende der 1920er Jahre gelangen Kehl einige spektakuläre Transaktionen, so die Fusion zwischen Hammersen und Dierig zum größten deutschen Baumwollkonzern, der Schaffung des Westwaggon-Trusts und schließlich die Angliederung der Essener Steinkohlebergwerke an die Gelsenkirchener Bergwerks-Gesellschaft. Doch schon die missglückte Finanzierung der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen schwächten seine Stellung im Vorstand. Die Manipulationen eines Düsseldorfer Filialdirektors, der Beträge in Millionenhöhe veruntreut hatte, veranlassten Kehl - in dessen Zuständigkeit der Filialbereich Düsseldorf gehörte - 1932 zum Rückzug aus dem Vorstand der Deutschen Bank.
In der Folgezeit führte er eine Reihe wirtschaftlicher Sonderaufgaben durch. 1939 wurde er zum Generaldirektor der Vereinigten Glaswerke Aachen (Gruppe St. Gobain) bestellt. In dieser Eigenschaft wurde er auch zum Vorsitzenden des Vereins Deutscher Spiegelglasfabrikanten ernannt.
Werner Kehl kam Anfang 1943 bei einem Eisenbahnunglück ums Leben.
Zeige Inhalt von Kiehl, Johannes
| Lebensdaten: | 16.09.1880 in Carthaus - 20.05.1944 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1938-1944 |
Kiehl - dessen Vorfahren aus Masuren stammten - war, wie sein Vater (der Reichsgerichtsrat Johannes Kiehl), von Hause aus Jurist. Nach dem Besuch des Domgymnasiums in Naumburg absolvierte er ein rechtswissenschaftliches Studium in München und Berlin und trat im Anschluss an sein Assessorexamen 1906 als Korrespondent und juristischer Sachbearbeiter in das Sekretariat der Deutschen Bank ein. Im Jahre 1909 wurde er Prokurist, 1914 stellvertretender Direktor, 1926 stellvertretendes Vorstandsmitglied. Er war viele Jahre der Chef des vielseitigen Sekretariatsgeschäfts, das neben der Bearbeitung großer Kapitaltransaktionen, Aktien und Anleihe-Emissionen auch die verschiedenartigsten sonstigen Finanzierungsaufgaben umfaßte. Auch als ordentliches Vorstandsmitglied (ab 1938) galt Kiehls Interesse weiterhin dem Emissions- und Konsortialgeschäft. Bei der erfolgreichen Reorganisation innerhalb der großen oberschlesischen Industriekonzerne nach dem Ersten Weltkrieg konnte Kiehl sowohl seine kaufmännischen wie juristischen Fähigkeiten einsetzen. Im laufenden Geschäft der Bank war er für die ostdeutschen Filialen zuständig. Kiehl stellte weiterhin die Geschäftsbeziehung zu Reemtma her, war an der Sanierung der Ufa sowie der Fusion der Lokomotivfabriken "J.A. Maffei" und "Krauss & Comp." zu "Krauss & Maffei" maßgeblich beteiligt.
Zeige Inhalt von Kimmich, Karl
| Lebensdaten: | 14.09.1880 in Ulm - 10.09.1945 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1933-1942 (Sprecher 1940-1942), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1942-1945 |
Karl Kimmich absolvierte zunächst eine Lehre in einem Ulmer Privatbankhaus. Nach dem Studium der Staatswissenschaften, das er mit der Promotion abschloss, trat er im Jahre 1906 in die Berliner Niederlassung des A. Schaaffhausen'schen Bankvereins ein, wo er insbesondere für das Konsortialgeschäft zuständig war. Von Berlin aus wechselte er am 1. Januar 1915 in die Zentrale nach Köln über und wurde 1919 stellvertretendes und 1921 ordentliches Vorstandsmitglied des A. Schaaffhausen'schen Bankvereins. Durch sein Wirken in Köln blieb Kimmich zeitlebens dem rheinisch-westfälischen Industrierevier besonders verbunden und galt als einer seiner besten Kenner.
Als im Jahre 1929, im Zuge der Verschmelzung der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft, auch der A. Schaaffhausen'sche Bankverein in dem neuen Institut aufging, schied Kimmich aus dem Vorstand aus. Er wurde aber von der Deutschen Bank weiterhin mit bedeutenden Sonderaufgaben betraut, so u.a. mit der Sanierung von Gebrüder Stollwerck und mit der schwierigen Neuordnung der Bergbau AG Lothringen.
"Herr Dr. Kimmich verfügt über sehr großes konstruktives Geschick und die Fähigkeit, sich in industrielle Fragen hineinzudenken, und hat sich auf allen Posten, auf die er bisher gestellt wurde, glänzend bewährt" beschrieb Vorstandsmitglied Georg Solmssen im November 1932 Kimmichs Fähigkeiten.
Diese Erfolge veranlassten die Deutsche Bank denn auch im Mai 1933, Kimmich in den Vorstand nach Berlin zu berufen. Auch hier widmete er sich wiederum dem großen Industriegeschäft und im besonderen der rheinisch-westfälischen Montanindustrie. Zahlreiche Unternehmen der Schwerindustrie sicherten sich dabei seine Mitarbeit, indem sie ihn in ihre Aufsichtsräte beriefen. In den Jahren 1940 bis 1942 war Kimmich der Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank. Die Reichsbank gewann seine Fachkompetenz durch die Berufung zum Vorsitzenden ihres Kreditausschusses.
Das Verhältnis Karl Kimmichs zum Nationalsozialismus war sicherlich enger als das der meisten anderen älteren Vorstandsmitglieder. Bei den von der Deutschen Bank durchgeführten "Arisierungen" tritt seine Person innerhalb des Vorstands am deutlichsten in Erscheinung. Familiär war eine Nähe zur NS-Spitze durch die Heirat von Kimmichs Bruder mit der jüngsten Schwester von Joseph Goebbels bedingt. Nachdem Kimmich im Frühjahr 1942 aus Gesundheitsgründen sein Amt im Vorstand niedergelegt hatte, übernahm er bis zu seinem Tod den Vorsitz im Aufsichtsrat der Bank.
Zeige Inhalt von Klasen, Karl
| Lebensdaten: | 23.04.1909 in Hamburg - 22.04.1991 in Hamburg | 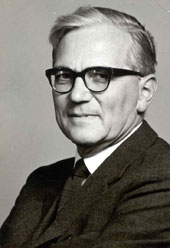 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1952-1969 (Sprecher 1967-1969) |
Karl Klasen, Sohn eines Hamburger Reederei-Angestellten, studierte ab 1928 Rechtswissenschaften. In den ersten Semestern arbeitete er als Werkstudent im Hamburger Hafen und als Reiseführer bei der Hapag. Nach der Promotion (1933) und bestandenem Assessorexamen trat er 1935 als Justitiar in die Rechtsabteilung der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Hamburg ein, wo er bis zu seiner Einberufung im Zweiten Weltkrieg tätig war. Eine Aufnahme in den Staatsdienst kam für Klasen, der 1931 in die SPD eingetreten war, im Nationalsozialismus nicht in Frage.
Nach Kriegsende kehrte er bereits im Juli 1945 in die Filiale Hamburg zurück, wo er Anfang 1948 zum Direktor ernannt wurde. Kurz darauf übernahm Klasen jedoch im April 1948 für eine Wahlperiode das Amt des Präsidenten der Landeszentralbank in Hamburg. 1952 kehrte er in seinen alten Wirkungsbereich zurück und wurde in den Vorstand der Norddeutschen Bank berufen, eines der drei Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank. Nach der Wiedererrichtung gehörte er ab 1957 dem Vorstand der Deutschen Bank an, wo ihm neben den Filialbezirken Hamburg, Bremen, Hannover und Osnabrück auch die Werbeabteilung unterstand.
Wichtige Aufsichtsratsmandate waren für Klasen, dessen besonderes Augenmerk auch dem Auslandsgeschäft galt, der Vorsitz bei den Deutsche Bank-Töchtern Deutsch-Asiatische Bank und Deutsche Ueberseeische Bank, sowie bei der Hapag und den Howaldtswerken. In der Nachfolge von Hermann J. Abs wurde Klasen 1967, gemeinsam mit Franz Heinrich Ulrich, die Sprecherfunktion des Vorstands der Deutschen Bank übertragen.
Anfang 1970 trat Klasen, als Nachfolger von Karl Blessing, das Amt als Präsident der Deutschen Bundesbank an. Es war das erste Mal in der hundertjährigen Geschichte der Deutschen Bank, dass eine Persönlichkeit aus ihren Reihen als Währungshüter einer zentralen deutschen Notenbank vorstand. Seinen Wechsel aus der Deutschen Bank in die schlechter dotierte Position des Bundesbankpräsidenten kommentierte er mit den Worten: "Wer ein solches Amt ablehnt, verdient nicht, was ihm das Leben bisher gegeben hat." Klasen setzte sich in seiner siebeneinhalbjährigen Amtszeit - zu einer Zeit als das Währungssystem von Bretton Woods auseinanderfiel und die Ölkrise ausbrach - nachhaltig und erfolgreich für die Stabilität der DM und der Notenbank-Autonomie ein.
Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Bundesbankpräsidenten wurde Klasen 1978 in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt, dem er bis 1984 angehörte.
Karl Klasen galt als Inbegriff eines Hanseaten. Seine Zuständigkeit in der Deutschen Bank für die nördlichen Filialbezirke und seine enge Verbindung zu den von Hamburg aus operierenden internationalen Unternehmen ergaben eine sinnfällige Verbindung von Herkunft und Tätigkeit.
Zeige Inhalt von Kleffel, Andreas
| Lebensdaten: | 03.07.1916 Schwerin - 14.08.2003 |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1963-1982 |
Nach bestandenem Abitur begann Andreas Kleffel 1934 mit dem Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg und Hamburg. 1938 legte er seine Referendarprüfung ab, promovierte 1939 zum Dr. jur. und 1941 folgte – während einer Unterbrechung des Wehrdienstes – das Assessor-Examen. Nach Entlassung aus dem Kriegsdienst wurde er 1944 Geschäftsführer der damaligen Reichsverkehrsgruppe Seeschiffahrt, einer Unterabteilung des Reichsverkehrsministeriums. Seine Banklaufbahn begann Kleffel kurz nach Kriegsende bei der Norddeutschen Bank in Hamburg, einem der Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank. Er übernahm Aufgaben auf dem Gebiet der Rechtsabteilung und des sogenannten Sekretariats, in dem das Konsortialgeschäft angesiedelt war. Bereits 1954 wurde er als Leiter dieser Abteilungen in der damaligen Zentrale der Norddeutschen Bank zum stellvertretenden Direktor ernannt. Als Direktor trat Kleffel 1956 in die Leitung der Filiale Hamburg ein. Nach dem Zusammenschluss der drei Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank ging er 1958 als Generalbevollmächtigter zur Zentrale Düsseldorf. Dort wurde er 1963 als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand berufen. Von 1967 bis 1982 gehörte er dem Vorstand als ordentliches Mitglied an. Kleffel betreute die Filialbereiche Wuppertal und Krefeld. Sein besonderes Interesse galt den Strukturwandlungen im modernen Bankgewerbe. Seiner Zuständigkeit unterstanden im Bereich der Zentrale Düsseldorf das Mengengeschäft und die Verkaufsförderung sowie die Rechtsabteilung. Außerdem gehörte er dem Aufsichtsrat einer Reihe von Unternehmen an. So war er beispielsweise Vorsitzender des Aufsichtsrats der Girmes-Werke AG, Oedt b. Krefeld, und der Schiess AG, Düsseldorf, und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hugo Stinnes AG, Mülheim, und der Rheinisch-Westfälischen Boden-Credit-Bank, Köln.
Zeige Inhalt von Klönne, Carl
| Lebensdaten: | 26.05.1850 Solingen - 20.05.1915 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1900-1914 |
Aus einfachen Verhältnissen stammend hatte sich Klönne bereits in jungen Jahren zum Direktor der Westfälischen Bank in Bielefeld emporgearbeitet. 1878 gelang ihm, gemeinsam mit einem jüngeren Kollegen, die Sanierung dieses in Liquiditätsschwierigkeiten geratenen Instituts. Ein Jahr später trat er in den Vorstand des A. Schaaffhausen'schen Bankvereins in Köln ein. Er widmete sich dort vor allem dem industriellen Finanzierungsgeschäft. Schon bald erkannte Klönne, daß die finanziellen Bedürfnisse der rheinisch-westfälischen Industrie aus den Kapitalquellen dieses Raumes allein auf die Dauer nicht befriedigt werden konnten. Auf sein Drängen wurde daher eine Niederlassung in Berlin gegründet, deren Leitung er persönlich übernahm.
Um die Jahrhundertwende wurde Klönne in die Deutsche Bank berufen, zunächst in den Aufsichtsrat, im Jahre 1900 in den Vorstand. Er befasste sich auch hier hauptsächlich mit dem großen Industriegeschäft. Dabei ließ er sich besonders die Förderung des Aktien-Emissionsgeschäfts angelegen sein, das bis dahin gegenüber dem Anleihegeschäft der Deutschen Bank etwas im Hintergrund gestanden hatte. Auf seine Initiative war es zurückzuführen, dass die Deutsche Bank und die Essener Credit-Anstalt, in deren Aufsichtsrat er eingetreten war, bei Konsortialgeschäften eng zusammenwirkten. Diese Interessengemeinschaft wurde 1903 dadurch untermauert, dass die Deutsche Bank ein Aktienpaket der Essener Credit-Anstalt übernahm. Mit diesem Vorgang war der erste Schritt zur Übernahme getan, die 1925 erfolgte.
Aus gesundheitlichen Gründen schied Klönne 1914 aus dem Vorstand der Deutschen Bank aus. Sein Nachfolger wurde Oscar Schlitter, der ihm bereits acht Jahre zuvor als stellvertretendes Vorstandsmitglied von Essen nach Berlin gefolgt war.
Zeige Inhalt von Koch, Rudolph von
| Lebensdaten: | 24.11.1847 in Gandersheim - 20.03.1923 in Berlin | 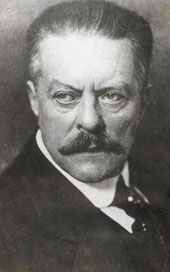 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1878-1909 (Sprecher 1901-1909), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1914-1923 |
Rudolph von Koch war bereits kurze Zeit nach der Errichtung der Deutschen Bank 1870 in deren Dienste getreten. Schon 1872 rückte er vom Prokuristen zum stellvertretenden Direktor auf und wurde schließlich 1878 in den Vorstand berufen. Das Schwergewicht seiner Tätigkeit lag dabei im Innenbetrieb der Bank. Koch wandte seine Aufmerksamkeit in erster Linie dem Kontokorrent- und dem Depositengeschäft zu. Die Pflege dieser Geschäftszweige ließ sich jedoch nicht von einem einzigen Platz aus durchführen, sondern hierzu bedurfte es einer umfassenden Zweigstellenorganisation, die Koch mit aufzubauen suchte.
Hand in Hand mit diesen Arbeiten ging Kochs Bestreben, Beziehungen zwischen der Zentrale in Berlin und verschiedenen Provinzbanken zu knüpfen. Er gehörte dem Aufsichtsrat bedeutender Provinzbanken an, wie z.B. der Bergisch Märkischen Bank, der Hannoverschen Bank, dem Schlesischen Bankverein. Alle diese Institute übernahm die Deutsche Bank in den Jahren zwischen 1914 und 1920 und erhielt so ein bedeutendes Filialnetz.
Aber auch im Auslandsgeschäft war Koch tätig. Als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Ueberseeischen Bank widmete er sich den südamerikanischen Ländern Argentinien, Chile und Peru. Darüber hinaus förderte Koch insbesondere die deutsch-türkischen Beziehungen, sowohl auf wirtschaftlichem als auch auf politischem und kulturellem Gebiet. Seit der Jahrhundertwende leitete er viele Jahre das türkische Generalkonsulat und wurde von der türkischen Regierung zum Ehren-Generalkonsul ernannt. Im Jahre 1908 wurde Koch außerdem in den preußischen Adelsstand erhoben.
Nach dem Rückzug von Georg von Siemens aus dem Vorstand im Jahre 1900 vertrat Koch offiziell die Bank nach außen, obgleich schon zu dieser Zeit sein Vorstandskollege Arthur von Gwinner als eigentliche Führungspersönlichkeit des Unternehmens galt. Im Jahre 1909 schied Koch aus dem Vorstand der Deutschen Bank aus und wechselte als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat über. Von 1914 bis zu seinem Tode hatte er den Vorsitz in diesem Gremium inne.
Zeige Inhalt von Kopper, Hilmar
| Lebensdaten: | 13.03.1935 in Oslanin (Polen) - 11.11.2021 Rothenbach/Westerwald |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1977-1997 (Sprecher 1989-1997), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1997-2002 |
Kopper wurde 1935 als Sohn eines Gutsverwalters in der Nähe von Danzig geboren. Nach Kriegsende kam er mit seiner Familie nach Niedersachsen, sein Abitur machte er in Köln. Ein väterlicher Freund riet ihm seinerzeit: „Mach eine Banklehre, das schadet nie.“ So kam er 1954 zur Filiale Köln-Mülheim der Rheinisch-Westfälischen Bank, wie die Deutsche Bank in Nordrhein-Westfalen von 1948 bis 1957 hieß.
Schon ein Jahr nach Ende der Lehrzeit schickte ihn die Bank als Trainee nach New York, wo er bei der J. Henry Schroder Banking Corp. erste Auslandserfahrungen sammelte. Zurück in Deutschland arbeitete er in der Auslandsabteilung der Düsseldorfer Zentrale der Deutschen Bank. 1960 wechselte er nach Leverkusen und übernahm zum Ende des Jahrzehnts die Leitung der dortigen Filiale. Zwei Jahre später wurde Kopper Vorstandsmitglied der damaligen European Asian Bank in Hamburg, an der die Deutsche Bank maßgeblich beteiligt war. 1975 kehrte er, inzwischen Direktor mit Generalvollmacht, nach Düsseldorf zurück.
1977 rückte er in den Vorstand der Deutschen Bank auf. Der Bau der neuen Zentrale in Frankfurt, die Deutsche-Bank-Türme, die zwischen 1979 und 1984 entstanden, fiel in seine Zuständigkeit. Bald trieb er auch die internationale Entwicklung der Bank voran, so gingen der Erwerb der Banca d’America e d’Italia und des Banco Comercial Transatlántico in Spanien maßgeblich auf sein Konto.
Kopper unterstützte Vorstandssprecher Alfred Herrhausen beim Erwerb von Morgan Grenfell in London im Jahr 1989. Nach dessen Ermordung wählten ihn die Vorstandskollegen innerhalb weniger Stunden zum neuen Vorstandssprecher. Den von seinem Vorgänger eingeleiteten Umbau der Deutschen Bank im In- und Ausland setzte er konsequent fort. Er forcierte nach dem Mauerfall das Engagement der Deutschen Bank in der DDR. Und unter seiner Führung gelang der Anschluss an die führenden anglo-amerikanischen Investmentbanken.
Nicht nur wegen dieser Neuausrichtung der Bank rieb sich die Öffentlichkeit mitunter an seiner Person. Dass er 1994 die Schadenssumme von 50 Millionen DM, die Handwerkern durch den Konkurs des Immobilienunternehmers Schneider entstanden war, im Verhältnis zum Gesamtschaden als "Peanuts" bezeichnete, wurde in der deutschen Öffentlichkeit kritisiert. Zugleich blieb Kopper immer bodenständig, war nie abgehoben und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Hierarchiestufen ansprechbar.
Die Auseinandersetzung der Bank mit ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus unterstützte Kopper vorbehaltlos, was 1995 zur Veröffentlichung der viel beachteten Studie des Historikers Harold James im Band „Die Deutsche Bank 1870-1995“ führte. Wie wichtig ihm die Geschichte des eigenen Hauses war, bewies 1991 die Gründung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank.
Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand rückte Kopper an die Spitze des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, dessen Vorsitz er bis 2002 innehatte. Zugleich gehörte er mehr als ein Vierteljahrhundert den Gremien einer Vielzahl deutscher und internationaler Unternehmen an. Insbesondere war er von 1990 bis 2007 Aufsichtsratsvorsitzender der damaligen Daimler-Benz AG und nachfolgend der DaimlerChrysler AG. Ebenso engagierte er sich mit Leidenschaft für Kultur und Wissenschaft, wie etwa als langjähriger Vorsitzender der Freunde und Förderer der Goethe-Universität in Frankfurt.
Video: Hilmar Kopper im Interview mit Corinna Wohlfeil am 6. März 2013 (10 Minuten)
weitere Informationen:
Zeige Inhalt von Krause, Stefan
| Lebensdaten: | 1962 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 2008 bis 31. Oktober 2015 |
Zeige Inhalt von Krumnow, Jürgen
| Lebensdaten: | 18.05.1944 in Grünberg/Schlesien |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1988-1999 |
Zeige Inhalt von Krupp, Georg
| Lebensdaten: | 1936 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1985-1998 |
Zeige Inhalt von Kuhnke, Frank
| Lebensdaten: | 1967 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2019-2021 |
Zeige Inhalt von Kutter, Gustav
| Lebensdaten: | 01.06.1829 in Verviers - 21.01.1876 in Berlin |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrat 1870-1876 |
Die Beziehungen Gustav Kutters zu verschiedenen Industriellen, Bankhäusern und vor allem in die USA machten ihn zu einem wichtigen Mitgründer der Deutschen Bank. Der Kaufmann gehörte dem Komitee an, das die Gründung der Deutschen Bank vorantrieb und die Verhandlungen mit dem preußischen Staat führte. Kutter selbst beteiligte sich als Privatperson mit 63.400 Talern und wurde von der ersten Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt, dem er bis zu seinem Tod angehörte. Als Teil dieses Gremiums wurde er zum Mitglied des sich wöchentlich treffenden Fünferausschusses, in dem neben den Direktoren drei Delegierte des Verwaltungsrats saßen und der die Geschäfte der Deutschen Bank koordinierte.
Gustav Kutter war Inhaber von Kutter, Luckemeyer & Co., die Niederlassungen in Berlin, New York, Lyon und Zürich hatten und mit Kurz- und Textilwaren handelten. Seine Familie war in Ravensburg im Textilgewerbe tätig gewesen und Eduard Luckemeyer, Mitinhaber von Kutter, Luckemeyer & Co., war der Bruder von Mathilde Wesendonck, die mit dem aus Elberfeld stammenden Textilhändler Otto Wesendonck verheiratet war und als Muse Richard Wagners bekannt geblieben ist. Wesendonck zeichnete ebenso wie sein Geschäftspartner Loeschigk Aktien der Deutschen Bank, deren Stimmrechte sie von Kutter vertreten ließen. Die hervorragenden Beziehungen in die USA machten Kutter zu einem wichtigen Gründungsmitglied, da er der Bank helfen sollte auf den amerikanischen Markt Fuß zufassen. So hatte Kutter Anteil an der Gründung von Knoblauch & Lichtenstein, die als Kommandite der Deutschen Bank in New York im 1872 ihr Geschäft begann, indem er Charles Knoblauch den führenden Vertretern der Bank vorstellte.
Zeige Inhalt von Lamberti, Hermann-Josef
| Lebensdaten: | 1956 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstand von 1999 - 31. Mai 2012 |
Zeige Inhalt von Leibkutsch, Hans
| Lebensdaten: | 30.03.1924 in Hamburg - 14.02.1979 in Paris |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1968-1979 |
Nach dem Abitur, das Hans Leibkutsch, Sohn eines Wirtschaftsprüfers, 1942 ablegte, folgten unmittelbar Kriegsdienst und Gefangenschaft. 1945 nahm er in Hamburg das Jurastudium auf, promovierte 1949 zum Dr. jur. und legte 1951 das Assessor-Examen ab. Von 1951 bis 1954 war er als Rechtsanwalt in Hamburg tätig. Es folgten eine zweijährige Bankausbildung sowie eine Tätigkeit als Leiter des Vorstandssekretariats bei der Hermes Kreditversicherung. 1958 wurde er als kaufmännisches Vorstandsmitglied in die Geschäftsleitung der Europa-Carton AG berufen. 1960 trat er in die Direktion der Deutschen Bank in Hamburg ein. 1965 wurde er zum Generalbevollmächtigten der Bank für den Zentralbereich Düsseldorf ernannt. Drei Jahre später erfolgte seine Berufung zum stellvertretenden, und Anfang 1971 zum ordentlichen Vorstandsmitglied. In der Gesamtbank war Leibkutsch insbesondere für den Bereich der Außenhandelsfinanzierung und der Gelddisposition verantwortlich. Darüber hinaus war er für den Filialbereich seiner Heimatstadt Hamburg zuständig. Seine großen Erfahrungen auf dem Gebiet der Außenhandelsfinanzierung kamen ihm als Aufsichtsratsvorsitzenden der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft zugute. In bedeutenden Industrie-, Handels- und Schiffahrtsunternehmen war er im Aufsichtsrat vertreten. Vorsitzender dieses Gremiums war er bei der Hoesch AG, Dortmund, bei der Mobil Oil AG in Deutschland, Hamburg, bei der O&K Orenstein & Koppel AG, Berlin/Dortmund sowie der Phonix AG, Hamburg-Harburg. Außerdem war er lange Jahre im Ostasiatischen Verein in Hamburg als Vorsitzender tätig.
Zeige Inhalt von Leithner, Stephan
| Lebensdaten: | 1956 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands vom 1. Juni 2012 bis 31.Oktober 2015 |
Zeige Inhalt von Lent, Alfred
| Lebensdaten: | 07.06.1836 in Berlin - 04.01.1915 in Berlin | 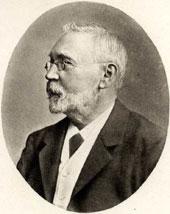 |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1878-1902 |
Alfred Lent ist das Beispiel für einen Seiteneinsteiger im Bankgeschäft. Er studierte Architektur, vor allem bei dem Berliner Baumeister Eduard Hitzig - der u.a. die Fassade der alten Zentrale der Disconto-Gesellschaft in der Behrenstraße entworfen hatte und Vorsitzender der 1864 von der Disconto-Gesellschaft gegründeten Berliner Immobiliengesellschaft war -, gewann mit dem Schinkel-Preis eine Studienreise nach Rom und errichtete danach als Architekt in Berlin eine Reihe von Großbauten, darunter den (im Zweiten Weltkrieg zerstörten) Lehrter Bahnhof. Sein Interesse für den Eisenbahnbau brachte den Kontakt zu Adolph von Hansemann, der ihn nach dem Deutsch-Französischen Krieg - an dem er als Offizier teilgenommen hatte - als technischen Berater für die zahlreichen Eisenbahnprojekte der Disconto-Gesellschaft in die Bank holte. 1878 wurde er Geschäftsinhaber. Sein Tätigkeitsfeld blieb der technische Bereich bei Eisenbahn- und Industriefinanzierungen sowie die Projektierung und Ausführung neuer Eisenbahnlinien im In- und Ausland. Auch im Anleihegeschäft der Disconto-Gesellschaft spielte er eine wichtige Rolle. Nach dem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung gehörte Lent noch bis 1914 dem Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft an.
Zeige Inhalt von Leukert, Bernd
| Lebensdaten: | 1967 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit 2020 |
Zeige Inhalt von Lewis, Stuart
| Lebensdaten: | 1965 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands vom 1. Juni 2012 bis 19. Mai 2022 |