Zeige Inhalt von Salomonsohn, Adolph
| Lebensdaten: | 19.03.1831 in Hohensalza - 04.06.1919 in Berlin | 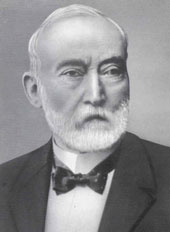 |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1869-1888 |
Mit drei Persönlichkeiten in der Geschäftsleitung hat die Familie Salomonsohn sechzig Jahre (1869-1929) die Entwicklung der Disconto-Gesellschaft mitgeprägt.
Der erste unter ihnen war Adolph Salomonsohn. Er stammte aus einer alten Rabbinerfamilie und gehörte zur ersten Generation, die eine weltliche Laufbahn einschlug. Nach einem Jurastudium arbeitete er als Assessor und Vormundschaftsrichter in Berlin, wo David Hansemann auf ihn aufmerksam wurde, als Salomonsohn den Syndikus der Disconto-Gesellschaft in einigen juristischen Arbeiten vertrat.
Im Juli 1863 kam er als Syndikus in die Disconto-Gesellschaft, nachdem er eine bereits angetretene Stelle als Notar in Cosel wieder aufgegeben hatte. 1866 erhielt er Prokura und schon 1869 wurde er in den Kreis der Geschäftsinhaber aufgenommen. In seiner Eigenschaft als Jurist und Kaufmann ergriff Salomonsohn die Gelegenheit, dem jungen deutschen Aktienbankgeschäft einen passenden Rahmen zu geben. "Die Geschäftsbedingungen der Aktienbanken, die juristische Konstruktion des Konsortialgeschäfts und die Behandlung des Aktienwesens wurden von ihm maßgeblich beeinflußt." (Georg Solmssen).
Seine besondere Neigung richtete sich auch auf die Finanzierung des Eisenbahnbaus; so war die Disconto-Gesellschaft wesentlich am Bau der Gotthardbahn beteiligt. Während des Baus wurde 1876 ein neuer Kostenplan aufgestellt, der einen gewaltigen Mehrbedarf vorsah und das Projekt dem Scheitern nahebrachte. Salomonsohn gelang es, in zähen Verhandlungen das Finanzvolumen stark zu reduzieren und die Regierungen der Schweiz, Deutschlands Italiens an den Mehrkosten zu beteiligen sowie die Aktionäre zu den noch fehlenden Einzahlungen auf ihre Aktien zu bewegen.
Auch in anderen Fällen erwies sich Salomonsohn als zuverlässiger Schadensbegrenzer: Frühzeitig verfolgte die Disconto-Gesellschaft im Inland das Prinzip von Tochterbanken durch die Errichtung einer besonderen Provinzial-Disconto-Gesellschaft, zumeist unter ihrem alten Namen. Als eine dieser Kommanditen, das Bankhaus Frensdorff in Hannover durch Fehlspekulationen in Schwierigkeiten geraten war, übersiedelte Salomonsohn zeitweilig dorthin, um das Haus ohne Schaden für das Mutternehmen zu liquidieren.
Bedeutende Verdienste erwarb er sich auch im Geschäft mit Staatsanleihen, wobei ihm Platzierungen preußischer, bayerischer und badischer Papiere in großem Umfang gelangen. Er war der Gründer und erste Leiter der Stempelvereinigung, jener zur einheitlichen Regelung von Stempelsteuerfragen und Geschäftsbedingungen geschaffenen Vereinigung Berliner Banken und Bankiers. Die Freundschaft mit Emil Kirdorf, einer der Schlüsselfiguren der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie, führte zu engen Verbindungen mit der Kohle- und Eisenindustrie, vor allem mit der Gelsenkirchener Bergwerks-AG.
1888 zog er sich aus der Geschäftsleitung der Disconto-Gesellschaft zurück - deren Aufsichtsrat er aber noch bis zu seinem Tod angehörte - und widmete sich intensiv philosophischen und naturwissenschaftlichen Studien. Anders als sein Sohn Georg Solmssen hielt Adolph Salomonsohn zeitlebens an seiner jüdischen Herkunft fest, die er mit seiner patriotischen Gesinnung (gegenüber Deutschland nicht aber gegenüber Kaiser Wilhelm II.) zu verbinden suchte.
Zeige Inhalt von Salomonsohn, Arthur
| Lebensdaten: | 03.04.1859 in Hohensalza - 15.06.1930 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber / Vorstand 1895-1929 |
Als Adolph Salomonsohn 1888 aus der Geschäftsleitung der Disconto-Gesellschaft ausschied, trat sein Neffe Arthur Salomonsohn als Justitiar in die Bank ein. "Seine Laufbahn gleicht der des Onkels, wenn auch die beiden Männer von Natur aus sehr verschieden sind. Adolph knorrig und urwüchsig, Arthur dagegen zurückhaltend und konziliant, ein pflichtbewußter, aber kühler Geschäftsmann." (Kurt Zielenziger).
Ebenso wie Adolph Salomonsohn hatte Arthur nach einem Jurastudium zunächst als Gerichtsassessor in Berlin gearbeitet, bevor er zur Disconto-Gesellschaft kam. Bereits 1895 wurde er persönlich haftender Gesellschafter und 1912 als Nachfolger von Alexander Schoeller an die Spitze des Geschäftsinhaberkollegiums berufen. Er übernahm damit auch das Aufgabengebiet seines Vorgängers, das hauptsächlich den Bereich internationaler Finanzierungen umfasst hatte. So vertrat er die Interessen der Disconto-Gesellschaft bei Anleiheverhandlungen in Südamerika. Als etwa Argentinien aufgrund leichtfertiger Papiergeldvermehrung in Zahlungsschwierigkeiten geraten war, gelang es Salomonsohn, in zähen Verhandlungen mit den dortigen Behörden die Ansprüche der deutschen Gläubiger erfolgreich wahrzunehmen.
Seinem Wirken im Verwaltungsrat der Neu-Guinea-Compagnie war die erfolgreiche Weiterentwicklung dieses schon von Adolph von Hansemann gegründeten Unternehmens zu verdanken. Im Inlandsgeschäft bestand seine Aufgabe vor allem darin, die Beziehungen der Bank zum rheinisch-westfälischen Industrierevier auszubauen. 1912 wurde er Aufsichtsratsvorsitzer der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, zu der schon sein Onkel enge Kontakte gepflegt hatte.
Nach dem Ersten Weltkrieg wirkte er bei den Umgruppierungen in der Montanindustrie mit, die nach dem Verlust der Fördergebiete in Lothringen notwendig geworden waren. An der Gründung der Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Union war er maßgeblich beteiligt. Ebenso wichtig war seine Tätigkeit in der Kaliindustrie, vor allem an der 1922 zustandegekommenen Interessengemeinschaft zwischen den Kaliwerken Aschersleben, den Kaliwerken Salzdetfurth und den Alkaliwerken Westeregeln.
Im Jahre 1901 gehörte Arthur Salomonsohn zusammen mit Jacob Riesser zu den Gründern der neu geschaffenen Spitzenorganisation der Privatbanken, die unter dem Namen Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes die Vertretung der Gesamtinteressen des privaten Bankgewerbes übernahm. Dort war Salomonsohn bis zu seinem Tode stellvertretender Vorsitzender.
Seit 1926 engagierte sich S. im Vorstand des Künstleratelierhauses ”Villa Romana e.V.” in Florenz mäzenatisch.
Die vor allem in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg auftretenden Interessenkonflikte der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank wurden im wesentlichen zwischen Arthur Salomonsohn und Arthur von Gwinner ausgetragen, seine Begeisterung über die sich ab Mitte der 1920er Jahre verdichtenden Fusionspläne hielt sich in Grenzen. Nach der Verschmelzung im Oktober 1929 wurde er für die kurze Zeit bis zu seinem Tod Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft, gemeinsam mit Max Steinthal.
Zeige Inhalt von Schenck, Marcus
| Lebensdaten: | 1965 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2015-2018, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 2017-2018 |
Zeige Inhalt von Schinckel, Max von
| Lebensdaten: | 26.10.1849 in Hamburg - 11.11.1938 in Hamburg | 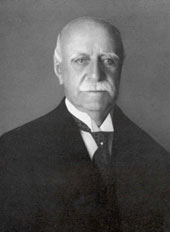 |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1895-1919 |
Schinckel stammte aus einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie. Sein Vater hatte allerdings als Teilhaber des Handelshauses ”Blessig & Co.” mehrere Jahrzehnte in Rußland verbracht. Erst im Sommer 1849, kurz vor der Geburt Schinckels, war die Familie nach Hamburg zurückgekehrt.
Nach dem Schulabschluss an der Realschule des Johanneums absolvierte Sch. von 1864 bis 1867 eine kaufmännische Lehre im Hamburger Handelshaus Burmester & Stavenhagen, wo er im Anschluss an seine Ausbildung noch ein Jahr als "Commis" verblieb. 1868/69 leistete er als Einjährig-Freiwilliger Militärdienst beim preußischen Dragoner-Regiment. Nr. 6 in Hadersleben/Nordschleswig, den er als Reserveoffizier abschloss. 1869 nahm er eine Stellung in dem Handelshaus des aus Frankfurt am Main stammenden Geschäftsmanns Moritz Ponfick in St. Petersburg an, die er 1870/71 wegen seiner aktiven Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg unterbrach.
Nachdem er im Sommer 1871 zunächst in seine alte Stellung nach St. Petersburg zurückgekehrt war, trat er am 12. November 1872, gerade 23jährig, seine Tätigkeit als dritter Direktor der Norddeutschen Bank in Hamburg an. Diese damals neben der Vereinsbank bedeutendste Hamburger Aktienbank beschäftigte sich hauptsächlich mit der Finanzierung des Überseegeschäfts und besaß weitverzweigte Geschäftsinteressen in Südamerika. 1878 avancierte Schinckel als Nachfolger von Siegmund Hinrichsen zum zweiten Direktor und seit 1891 war er der Senior-Direktor der Bank.
Nicht zuletzt die Heirat mit der Tochter des Hamburger Großkaufmanns Gustav Berckemeyer verschaffte Schinckel den Zutritt in die Wirtschaftselite der Hansestadt. Es gelang ihm, die bedeutendsten Hamburger Reederfamilien Laeisz und Woermann, die bislang mit der Vereinsbank bzw. mit der Commerz- und Disconto-Bank zusammengearbeitet hatten, enger an die Norddeutsche Bank zu binden. Durch die Bekanntschaft mit Emil Russell konnte Schinckel die Disconto-Gesellschaft in Berlin gewinnen, sich mit der Norddeutschen Bank an einer Reihe von südamerikanischen Geschäften zu beteiligen, wie z.B. der Gründung der Brasilianischen Bank für Deutschland, der Großen Venezuela-Eisenbahngesellschaft und der Errichtung einer "Konversionskasse zur Stabilisierung der argentinischen Währung".
Als Experte für Auslandsgeschäfte stand er Adolph von Hansemann, dem Chef der Disconto-Gesellschaft, bei vielen Gelegenheiten beratend zur Seite. 1895 wurde schließlich die Norddeutsche Bank von der Disconto-Gesellschaft übernommen und in eine Kommandit-Gesellschaft auf Aktien umgewandelt, wobei die Norddeutsche Bank weiter unter ihrem bisherigen Namen firmierte. Schinckel wurde Geschäftsinhaber beider Institute, war jedoch weiter von Hamburg aus tätig. Bis zum Ersten Weltkrieg betreute er neben den traditionellen südamerikanischen Interessen und dem starken Engagement im Reedereiwesen vor allem das Geschäft in Hamburg.
1919 schied er aus dem aktiven Bankgeschäft aus, blieb aber in den Aufsichtsräten der Disconto-Gesellschaft und der Norddeutschen Bank, deren Vorsitzender er bis zur Fusion mit der Deutschen Bank 1929 war. Danach war er noch bis 1933 Ehrenpräsident des Aufsichtsrats des vereinigten Instituts.
Schinckel galt als Inbegriff eines Bankiers hanseatischer Prägung, bei ihm verbunden mit einer großen Begeisterung für Kaiser Wilhelm II. 1917 wurde Schinckel in den preußischen Adelsstand erhoben. Die Weimarer Republik und den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel der Zwanziger Jahre lehnte er zutiefst ab: ”Die Zeiten haben sich eben geändert, bloß Herr von Schinckel nicht.” (Frankfurter Zeitung 1929) Unter den Geschäftsinhabern der Disconto-Gesellschaft zählte er zu den Konservativsten. Politisch engagierte er sich im ”Stahlhelm”.
Er fungierte als Aufsichtsratsvorsitzender u.a. bei folgenden Unternehmen: Bank für Chile und Deutschland, Brasilian. Bank für Deutschland, Dynamit AG, Hapag, Hamburg-Südamerik. Dampfschiffahrts-Gesellschaft und Norddeutsche Affinerie. 1907 wurde er Präsident der Hamburger Handelskammer. Er war Mitglied des Vorstands des Centralverbands des deutschen Bank- und Bankiergewerbes, Vorsitzender der Synode der evangelischen Landeskirche und Präsident des Hamburger Rennklubs (Pferdesport).
Zeige Inhalt von Schlieper, Gustaf
| Lebensdaten: | 28.02.1880 in Berlin - 24.08.1937 in Bühlerhöhe |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber / Vorstand 1914-1937 |
Schlieper stammte aus einer Elberfelder Bankiersfamilie. Sein Vater Eugen Schlieper betrieb ein eigenes Bankhaus in Berlin. Nach einer Lehre im Bankhaus Georg Fromberg & Co ging er zur weiteren Ausbildung nach Amsterdam, London und New York. Anschließend unternahm er Studienreisen nach Mexiko und in die USA.
1902 trat er in die Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft ein, wo er zunächst hauptsächlich im Chefkabinett tätig war. 1905 erhielt er Prokura. In dieser Zeit wirkte er an der Gründung der Kreditbank in Sofia mit, deren Aufsichtsratsvorsitzender er später wurde. Ab 1908 war er Direktor der Frankfurter Filiale der Disconto-Gesellschaft, bis er 1914 zum Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft berufen wurde.
Nach der Verschmelzung mit der Deutschen Bank gehörte er bis zu seinem Tod dem Vorstand des vereinigten Instituts an. Sein Arbeitsfeld erweiterte sich beträchtlich, als nach der Fusion von 1929 die oberste Leitung des gesamten Auslandsgeschäfts der Deutschen Bank in seine Hände überging. Hier konnte der weltgewandte Schlieper, der seine banktechnische Ausbildung vor allem im Ausland erworben hatte, seine Fähigkeiten voll entfalten. Er prägte den Begriff des "Kaufmännischen Idealismus", den gerade der in der Außenwirtschaft tätige Bankier besitzen müsse.
Eine wertvolle Plattform für seine Arbeit fand er in der Deutschen Ueberseeischen Bank (DUB), in der die spanischen und südamerikanischen Interessen der Bank zusammengefasst waren. Von 1933 bis zu seinem Tod war er Aufsichtsratsvorsitzender der DUB.
Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Schlieper durch die Stillhalteverhandlungen infolge der Bankenkrise von 1931 bekannt, als die ausländischen Banken versuchten, ihre kurzfristig nach Deutschland ausgeliehenen Gelder schlagartig zurückzuziehen. Sowohl in Basel, wo im August 1931 der erste Stillhaltevertrag über mehr als sechs Milliarden Reichsmark deutscher Auslandskredite abgeschlossen wurde, wie bei den späteren Stillhaltekonferenzen hat Schlieper die deutsche Delegation angeführt.
Darüber hinaus stellte er sich in einer Reihe von wichtigen außenwirtschaftlichen Gremien sowie im Beirat der Deutschen Golddiskontbank für allgemeine Aufgaben der Kreditwirtschaft zur Verfügung. Schliepers herausragende Leistungen für das Auslandsgeschäft der Disconto-Gesellschaft, die er ab 1929 in das vereinigte Institut einbrachte, trugen im wesentlichen dazu bei, die nach dem Ersten Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogenen internationalen Beziehungen wiederherzustellen. Die Nachfolge Schliepers im Auslandsgeschäft und in der Stillhaltekommission nahm ab 1938 der neu in den Vorstand berufene Hermann J. Abs wahr.
Zeige Inhalt von Schlitter, Oscar
| Lebensdaten: | 10.01.1868 in Lennep - 30.11.1939 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1912-1932, Vorsitzender des Aufsichtsrats 1933-1939 |
Schlitters väterliche Vorfahren stammten aus Schlitters im Zillertal (Tirol), gelangten als protestantische Glaubensflüchtlinge aber in den mitteldeutschen Raum. Schlitters Vater diente als Soldat und betrieb später in Lennep bei Remscheid eine Posthalterei. Nach Aufnahme des Bahnbetriebs wurde er Eisenbahnpostkondukteur. 1869 übersiedelte die Familie nach Düsseldorf. Oscar Schlitter verbrachte dort die Schulzeit und absolvierte im Anschluss daran eine kaufmännische Lehre.
1887 trat er in die "Bergisch Märkische Bank" ein, zunächst als Korrespondent, später in der Wertpapierabteilung. 1894 wechselte er zur "Essener Credit-Anstalt" über, die ihm als führende Industriebank des Reviers ein größeres Arbeitsfeld eröffnete. Schon 1901 rückte er dort in deren Vorstand auf. 1906 trat er auf Vermittlung von Carl Klönne als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand der "Deutschen Bank" ein. 1908 wechselte er allerdings für vier Jahre zurück zur "Bergisch Märkischen Bank", die mittlerweile bereits eng mit der "Deutschen Bank" verbunden war.
Auf Grund seiner hervorragenden Kenntnisse der westdeutschen Industrie hielt man ihn für besonders geeignet, das industrielle Finanzierungsgeschäft der "Bergisch Märkischen Bank" zu leiten. Erst 1912 kehrte Schlitter wieder in den Vorstand der "Deutschen Bank" zurück nach Berlin zurück, wo er den Zusammenschluss der "Bergisch Märkischen Bank" mit der "Deutschen Bank" vorbereitete (1914). Es war dies die größte Fusion, die es bis dahin im deutschen Aktienwesen gegeben hatte und zugleich der Auftakt für weitere Bankenzusammenschlüsse, die das Filialnetz der Großbanken vergrößerten und erstmals zu einer wirklichen Präsenz in der Fläche führten.
In den folgenden Jahren war Schlitter an der Weiterentwicklung der industriellen Konzentration in Westdeutschland maßgeblich beteiligt, so u.a. bei der Schaffung der finanziellen Voraussetzungen zur Gründung der "Vereinigten Stahlwerke" und zur Neuordnung des Stummkonzerns. Schlitters Tätigkeit als Industriebankier blieb nicht auf die Montanindustrie beschränkt. Der Ausbau des Industriegeschäfts der Bank, brachte es mit sich, dass sich Schlitter auch Mandate für Unternehmen aus dem Kalibergbau, dem Maschinenbau und der Elektoindustrie wahrnahm, darunter den Aufsichtsratsvorsitz bei den Deutschen Kaliwerken, der Demag und bei Mannesmann. Sein Engagement galt weiterhin dem Versicherungsgewerbe. Innerhalb der "Nordstern"-Versicherungsgruppe war als Transaktion vor allem die Übertragung der "Vaterländischen" und "Rhenania" auf "Nordstern" von Bedeutung (1929); eine Maßnahme, die, nach dem Zusammenbruch der Frankfurter Versicherungs-AG, wesentlich zur Wiederherstellung des Vertrauens in die deutsche Versicherungswirtschaft beitrug.
Nach der Fusion der "Deutschen Bank" mit der "Disconto-Gesellschaft" blieb Schlitter noch drei Jahre im Vorstand des vereinigten Instituts, um Mitte 1932 in den Aufsichtsrat überzuwechseln, dessen Vorsitz er von 1933 bis 1939 - jährlich alternierend mit Franz Urbig - übernahm. Nach dem Tod von Eduard Mosler im August 1939 gab es Überlegungen, Schlitter als Vorstandsmitglied zu reaktivieren. Altersbedingt, aber auch vor dem Hintergrund der politischen Verhältnisse, wollte er diese Verantwortung aber nicht noch einmal übernehmen.
"Schlitter - das ist ein Mann der keine Feinde hat" war das über eine Führungspersönlichkeit im Bankgewerbe selten geäußerte Diktum. Sie galt einem Vorstand, der durch seine engen Kontakte zum westdeutschen Industrierevier - in der Nachfolge von Carl Klönne - der Deutschen Bank diese zentrale Wirtschaftsregion erschließen half. Seiner Neigung nach gelehrtem Diskurs ging Schlitter seit 1932 als Mitglied der Berliner "Mittwochsgesellschaft" nach.
Zeige Inhalt von Schmitz, Ronaldo H.
| Lebensdaten: | 1938 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1991-2000 |
Zeige Inhalt von Schneider-Lenné, Ellen Ruth
| Lebensdaten: | 28.05.1942 in Berlin - 25.12.1996 in Königstein |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1988-1996 |
Nach einem betriebswirtschaftlichen Studium begann Schneider-Lenné 1967 ihre Laufbahn bei der Deutschen Bank als Kredit-Sachbearbeiterin in der Filiale Hamm. 1971 sammelte sie erste Auslandserfahrungen als Delegierte der Deutschen Bank bei der European American & Trust Co. in New York. 1973 holte sie der damalige Vorstandssprecher Franz Heinrich Ulrich als seine Assistentin in die Zentrale. 1975 folgte ein zweiter Auslandsaufenthalt in London. Sie gehörte dem "Team London" an, das 1975/76 die Umwandlung der Londoner Repräsentanz in eine Filiale vorbereitete (als erste Auslandsfiliale der Deutschen Bank nach dem Zweiten Weltkrieg). 1980 nach Deutschland zurückgekehrt, wurde sie 1985 - mittlerweile als Spezialistin für Außenhandelsfinanzierung ausgewiesen - Dezernentin für das Ressort Internationale Handelsfinanzierung in der Geschäftsleitung der Zentrale Internationale Abteilung.
1988 wurde Schneider-Lenné in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, dem sie bis zu ihrem Tod angehörte. Hier war sie für die Ressorts Kreditrisikomanagement und Financial Institutions zuständig, im Inland fiel die Region Wuppertal im Ausland Großbritannien und Irland in ihre Verantwortung. Sie war Aufsichtsratsvorsitzende der AKA Ausfuhrkreditgesellschaft und betreute unter anderem Mandate bei der Industriebank von Japan AG und der Readymix AG für Beteiligungen.
Ellen Ruth Schneider-Lenné, die über ein ausgesprochenes Verhandlungsgeschick verfügte, war die erste Frau im Vorstand einer deutschen Großbank.
Zeige Inhalt von Schoeller, Alexander
| Lebensdaten: | 24.03.1852 in Elberfeld - 22.11.1911 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1884-1911 |
Alexander Schoeller gehört zu den wenigen Führungskräften, die vor der Fusion nacheinander sowohl für die Deutsche Bank als auch für die Disconto-Gesellschaft in leitender Stellung tätig gewesen sind.
Schoeller entstammte einer rheinisch-westfälischen Industriellenfamilie. Nach einer Lehre beim Elberfelder Bankhaus Arthur Blanck nahm er als Freiwilliger am Deutsch-Französischen Krieg teil. Es schlossen sich weitere Lehrjahre in Brüssel und London an.
Im Auftrag der Deutschen Bank reiste er Mitte der 1870er Jahre nach Montevideo, vermutlich im Zusammenhang mit der Deutsch-Belgischen La Plata Bank, an der sich die Deutsche Bank 1874 beteiligt hatte. Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde er 1877 zum stellvertretenden Direktor der Deutschen Bank Filiale Hamburg ernannt, wo er allerdings schon 1880 ausschied, als er in die Leitung der Preußischen Seehandlung berufen wurde. Bereits 1881 führte er den Titel eines Geheimen Seehandlungsrats. In der Preußischen Seehandlung war er in erster Linie für das Konsortialgeschäft zuständig.
Seine hervorragende Kenntnis der Bank- und Kapitalmarktverhältnisse führte dazu, dass Adolph von Hansemann auf ihn aufmerksam wurde und Schoeller 1884 für die durch das Ausscheiden Emil Heckers vakant gewordene Stelle des fünften Geschäftsinhabers der Disconto-Gesellschaft gewann. Hier war er zunächst im Direktionsbüro tätig, in dem die Leitung des laufenden Geschäfts der Bank zusammengefasst war.
Nach dem Tod Adolph von Hansemanns sowie dem Ausscheiden Emil Russells und Alfred Lents aus der Geschäftsführung übernahm er 1903 als ältester Geschäftsinhaber das sogenannte Chefkabinett der Disconto-Gesellschaft, dem die allgemeine Geschäftsorganisation, die Beteiligungen, die Emissionsgeschäfte und die Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen außerhalb des laufenden Bankverkehrs unterstanden. Hier führte er auch Hansemanns Engagement in den Kolonialgebieten fort, etwa in der Neu-Guinea-Gesellschaft, der Schantung-Eisenbahn oder als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Otavi Minen AG. Weitere wichtige Mandate nahm er in den Aufsichtsräten der Banca Commerciale Italiana, der Preußischen Central-Bodenkredit AG und dem RWE wahr.
Zeige Inhalt von Schröter, Gustav
| Lebensdaten: | 11.07.1852 in Berlin - 18.11.1931 in Berlin | 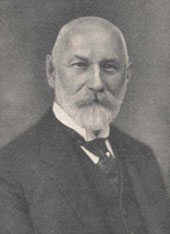 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1906-1925 |
Nach der kaufmännischen Lehre in einer Berliner Eisenhandlung und Metallwarenfabrik trat Schröter 1870 in den Berliner Bankverein ein, der 1875 als eines der ersten Bankhäuser von der Deutschen Bank übernommen wurde. Als die Deutsche Bank 1876 in das Quartier Behren-/Mauerstraße umzog, war der Depositenverkehr bereits so angewachsen, daß die Kasse als eigenständige Stadtfiliale - als erste Depositenkasse - am bisherigen Standort in der Burgstraße verblieb. Ihr Leiter wurde Gustav Schröter. 1881 erhielt er Prokura, 1900 wurde er zum stellvertretenden Direktor ernannt, 1906 in den Vorstand berufen.
In dem halben Jahrhundert seiner Tätigkeit für die Deutsche Bank war Schröter fast ausschließlich für das Depositengeschäft zuständig, woher sein Beiname "Vater der Depositenkassen" rührte; allein am Stammsitz der Deutschen Bank Berlin wurden im Laufe der Zeit über sechzig Stadtzweigstellen eingerichtet. Unter seiner Obhut wurden deren Aufgaben den sich verändernden Verhältnissen im Depositengeschäft angepasst. Schließlich konnte eine Depositenkasse fast die gleichen Dienstleistungen wie die Zentrale anbieten (mit Ausnahme des Konsorital- und des überseeischen Geschäfts). Ein besonderes Anliegen war Schröter die gründliche Schulung der Depositenkassenvorsteher (Filialleiter).
Seine Erfahrungen im Depositengeschäft machten Schröter zu einem großen Befürworter des bargeldlosen Zahlungs- und Scheckverkehrs. Schröter galt mit seinem Aufgabenbereich als ausgesprochener Innenarbeiter, der als Persönlichkeit außerhalb der Deutschen Bank kaum in Erscheinung trat.
Zeige Inhalt von Seeling, Otto
| Lebensdaten: | 01.03.1891 in Fürth - 28.02.1955 in Fürth |  |
| Bank: | Süddeutsche Bank AG | |
| Funktion: | Aufsichtsratsvorsitzender 1952-1955 |
Otto Seeling wuchs als Sohn eines Handwerksmeisters in nur mäßigem Wohlstand auf. Nach Abschluss der Realschule (1908) absolvierte er eine kaufmännische Lehre und war von 1910-1913 in kaufmännischen Stellungen beschäftigt. Diese Jahre nutzte er zum Selbststudium; er machte das Abitur und studierte in Erlangen und Frankfurt a.M. Staatswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre. 1917 legte er an der Universität Frankfurt sein Diplomexamen ab. Anschließend wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Handelskammer Nürnberg und promovierte 1918 mit einer Arbeit über Industrieobligationen. Dadurch wurde man in Wirtschaftskreisen auf ihn aufmerksam. Er war zunächst Vertrauensmann der Außenhandelsstellen der Lederwirtschaft, der Glasindustrie und des Deutschen Buchgewerbes. 1923 wurde er Vorstandsmitglied der Tafel-Salin-und Spiegelglasfabriken AG in Fürth (seit 1932 Deutsche Tafelglas AG) und 1926 schließlich Vorstandsvorsitzender dieser Firma. Damit hatte er eine Spitzenposition in der süddeutschen Wirtschaft errungen, die er bis zu seinem Tode beibehielt, und die ihn auch bei den entstehenden größeren Interessenverbänden der deutschen Tafelglasindustrie, die teilweise seiner Initiative entsprangen, an die Spitze brachte. Seit 1934 stand er in enger Beziehung zur Deutschen Bank; zunächst als Mitglied des bayerischen Beirats, eine Funktion die er bis 1945 innehatte, und von 1952-1955 als Aufsichtsratsvorsitzender der Süddeutschen Bank AG, in München. Der Kontakt zur Deutschen Bank kam u.a. durch Hans Rummel zustande (Mitglied des Vorstands der Bank von 1933-1945), der seinerseits seit 1938 als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Tafelglas AG fungierte.
Zeige Inhalt von Sewing, Christian
| Lebensdaten: | 1970 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit 2015, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 2017-2018, Vorstandsvorsitzender seit April 2018 |
Zeige Inhalt von Short, Rebecca
| Lebensdaten: | 1974 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit 1. Mai 2021 |
Zeige Inhalt von Siemens, Georg von
| Lebensdaten: | 21.10.1839 in Torgau - 23.10.1901 in Berlin | 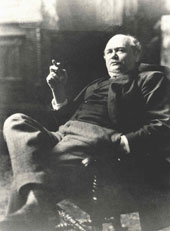 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1870-1900 (Sprecher 1870-1900) |
Georg von Siemens war die zentrale Gründerpersönlichkeit der Deutschen Bank. Er hat ihre Geschicke über drei Jahrzehnte maßgeblich gestaltet.
Der Sohn eines Juristen und preußischen Beamten hatte 1857 sein Abitur am Französischen Gymnasium in Berlin absolviert und dann Jurisprudenz in Heidelberg studiert, wo er auch - beruflich und politisch bereits arriviert - 1875 promoviert wurde. Nach Jahren als Referendar an preußischen Kreisgerichten, Militärdienst im preußisch-österreichischen Krieg und bestandenem Assessorexamen trat er 1867 in die Firma Siemens & Halske ein. Der Kontakt zu Werner von Siemens, dem Gründer des Elektrokonzerns und Vetter seines Vaters, gestaltete sich sehr eng, und so beauftragte dieser den jungen Mann, in den Jahren 1868/69 in London und Teheran für die Firma Siemens die Verhandlungen über den Bau der Indo-Europäischen Telegraphenlinie zu führen. Hier fiel Georg von Siemens durch sein großes Verhandlungsgeschick Adelbert Delbrück auf, dem Leiter des Bankhauses Delbrück Leo & Co. in Berlin. Delbrück betrieb damals zusammen mit dem nationalliberalen Politiker und Währungsexperten Ludwig Bamberger die Gründung einer Außenhandelsbank und suchte für sie einen Direktor. Delbrück schlug Siemens, obwohl bislang im Bankfach gänzlich ohne Erfahrung, für die Direktion der 1870 neugegründeten Deutschen Bank vor. Mit Hermann Wallich stand Siemens dabei ein erfahrener Bankkaufmann zur Seite.
Siemens erkannte schnell, dass die Deutsche Bank ihre Ziele, den Handels- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland zu stützen und auszubauen, nur erreichen konnte, wenn sie auf einer breiten inländischen Geschäftsgrundlage aufbaute. Diese schuf Siemens ab 1877 durch die Aufnahme des Depositengeschäfts, mit dem sich bislang nur Sparkassen systematisch befasst hatten, und sicherte damit der Deutschen Bank einen großen Vorsprung. Ihr Beispiel wurde richtunggebend für das gesamte deutsche Bankgewerbe. Siemens unterstützte das Depositengeschäft außerdem durch seine Bemühungen um die Entwicklung des Scheckverkehrs. Auf dieser Grundlage des Inlandsgeschäfts konnte die Bank ihr ursprüngliches Programm der Außenhandelsfinanzierung durchführen und durch die schon 1873 errichtete Filiale in London sowie durch die Gründung der Deutschen Ueberseeischen Bank (1886) und Deutsch-Asiatischen Bank (1889) erweitern.
Die Erfolge, welche die Deutsche Bank unter Georg Siemens' Leitung im Inlandsgeschäft erzielte, brachten es mit sich, daß schon im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts im Inland eine Reihe von Filialen entstanden (Bremen, Hamburg, Frankfurt, München) und mit anderen Banken enge Beziehungen geknüpft wurden. Beteiligungen an der Württembergischen Vereinsbank, am Schlesischen Bankverein und an der Bergisch Märkischen Bank wurden erworben. Damit entstand eine Bankengruppe, mit der Siemens auch an größere Finanzierungsaufgaben herantreten konnte. Unter diesen ragt die Mitwirkung bei der Schaffung der deutschen elektrotechnischen Industrie besonders hervor. Im Jahre 1887 übernahm die Deutsche Bank zusammen mit Delbrück Leo & Co. den größten Teil der Kapitalerhöhung der Deutschen Edison-Gesellschaft, die zugleich in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft umbenannt wurde. Sieben Jahre gehörte er dem Aufsichtsrat der AEG an. Ebenso stellte er seine Erfahrungen den Unternehmungen der Siemens & Halske AG zur Verfügung. Gleichzeitig beteiligte sich die Deutsche Bank an einer Reihe bedeutender Elektrizitätswerke und Straßenbahnunternehmen. Auch an der Entstehung der Berliner Hoch- und Untergrundbahn hat Siemens noch entscheidend mitgearbeitet. Zusammen mit Max Steinthal wirkte er bei der Gründung der Mannesmannröhren-Werke mit.
Die Verbindungen, die Georg Siemens für die junge Deutsche Bank im Inland geknüpft hatte, führten frühzeitig auch ins Ausland. Die auf sein Betreiben in Zürich gegründete Bank für elektrische Unternehmungen leitete die Interessen der deutschen Banken auf das internationale Gebiet. Den Höhepunkt erreichte Georg Siemens' Auslandstätigkeit in der Beteiligung der Deutschen Bank an der Finanzierung des nordamerikanischen Eisenbahnbaus, insbesondere der Northern Pacific Railroad Company Als das Unternehmen 1893 nach Fehlspekulationen zusammenbrach, errichtete Siemens in New York ein Reorganisationskomitee für die Besitzer der Eisenbahnbonds. Unterdessen hatte Siemens in Deutschland eine Gesellschaft zum Schutz und zur Förderung deutscher Investitionen in den USA initiiert. Das Unternehmen wurde im März 1890 als Deutsch-Amerikanische Treuhand-Gesellschaft (seit 1892 Deutsche Treuhand-Gesellschaft) gegründet.
Immer weiter spannte sich der Bogen der großen Finanzgeschäfte, mit denen Siemens den internationalen Ruf der Deutschen Bank festigte: Anleihegeschäfte mit der Stadt Bukarest und dem Fürstentum Bulgarien, Mitwirkung bei der Gründung der Banca Commerciale Italiana (1894). Die von Siemens 1889 betriebene Gründung der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft markiert den Beginn der Orientinteressen der Deutschen Bank, wenngleich Siemens dem Großprojekt Bagdadbahn lange mit großer Skepsis gegenüber stand. Für seine Leistungen in der Türkei wurde Siemens im Jahre 1899 der erbliche Adel verliehen.
Siemens' Wirken ging dabei auch weit über seine Tätigkeit für die Deutsche Bank hinaus. Über viele Jahre engagierte er sich u.a. im Verein Deutscher Banken und im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Im Ausschuss des Deutschen Handelstages wirkte er am Scheckgesetz mit. Als Abgeordneter des Deutschen Reichstags, dem er über 13 Jahre zunächst für die nationalliberale, später für die freisinnige Fraktion angehörte, nahm er besonders zu Fragen der Bankenverfassung, der Münzgesetzgebung, der Börsensteuer und zur Erneuerung der Handelsverträge Stellung.
Dem vaterländischen Zeitgeist frönende Töne waren Siemens fremd. In der Deutschen Bank sah er ein international wirkendes Institut, nicht nur im Hinblick auf die territoriale Ausdehnung ihrer Geschäftstätigkeit, sondern auch bezüglich einer weltläufigen Gesinnung.
"Siemens war bei seinem Eintritt in die Deutsche Bank 1870 völlig fachfremd, verfügte aber über ein großes Selbstbewusstsein und, ausgerüstet mit großer Dynamik, weitausgreifende Pläne. Zudem war er gar kein Bankier im klassischen Sinne, also ein mit seinem persönlichen Kapital haftender Privatbankier, sondern ein einfacher Angestellter, ein, wie man dann sagte, Bankmanager, also ein ganz neuer Typus, und als ein solcher trug er in diese gepflegte und gediegene Welt der Privatbankiers, die die Bank im Frühjahr 1870 gegründet hatten, auch sprachlich einen ganz neuen, saloppen und zugleich aggressiven, dabei ironischen und selbstironischen Ton." (Lothar Gall)
Am Ende seiner Amtszeit, dreißig Jahre später, im Jahre 1900, war die Deutsche Bank die größte in Deutschland und auf dem Sprung, die größte der Welt zu werden. Nicht nur alle Privatbanken, sondern auch die bisherige unbestrittene Nummer Eins unter den Aktienbanken, die von David Hansemann 1851 gegründete Disconto-Gesellschaft, waren ebenso überflügelt worden wie die 1870 und 1872 gegründeten Konkurrenzinstitute Commerzbank und Dresdner Bank.
weitere Informationen:
Karl Helfferich – Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands großer Zeit
Ans Licht geholt - Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2] [3] [4] [5]
Zitate
"Von dem amerikanischen und indischen Bankgeschäft verstehe ich zwar wenig, ich tue indessen sehr gelehrt, zucke ab und zu die Achseln, ziehe das Maul bis an die Ohren - wenn ich nämlich spöttisch lache - und schlage zu Hause heimlich das Konversationslexikon resp. Fremdwörterbuch oder die Kunst, in 24 Stunden Bankier zu werden, auf, um nachzulesen, wenn ich ein mir unverständliches Wort hörte. Den Unterschied zwischen Brief und Geld habe ich denn auch schon annähernd erfasst."
(Siemens über seine anfängliche Unkenntnis des Bankgeschäfts)
"Wenn 24 Leute eine Bank leiten wollen, dann ist das wie mit einem Mädchen, das 24 Freier hat. Es heiratet sie keiner. Aber am Ende hat sie ein Kind!" (Siemens über die Versuche des Verwaltungsrats, die Deutsche Bank zu leiten)
Zeige Inhalt von Simon, Stefan
| Lebensdaten: | 1969 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands vom 1. August 2020 - 30. April 2025 |
Zeige Inhalt von Sippell, Karl Ernst
| Lebensdaten: | 04.02.1889 in Bad Sooden-Allendorf - 02.05.1945 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstand 1933-1945 |
Sippell stammte aus einer Pfarrer- und Medizinerfamilie. Nach abgeschlossenem Jurastudium und Promotion trat Sippell im Jahre 1918 in das Chefkabinett der Disconto-Gesellschaft ein. Das Chefkabinett war das Spezialbüro des Hauses, in dem alle Fäden des großen Finanz- und Industriegeschäfts zusammenliefen und zugleich alle technischen Arbeiten erledigt wurden, die mit der Abwicklung des Emissions- und Konsortialgeschäfts zusammenhingen. Für einen jungen Bankkaufmann war es die hohe Schule der banque d'affaires, die mit ihren weitverzweigten Beziehungen in der in- und ausländischen Wirtschaft Gelegenheit zu umfassender Ausbildung bot.
Sippell erwarb sich in diesem Rahmen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen, die zusammen mit seiner geschäftlichen Begabung dazu führten, dass er nach der Fusion von 1929 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft berufen wurde. Nach einjähriger Tätigkeit in der Leitung der Filiale Frankfurt am Main kehrte Sippell 1933 als Vorstandsmitglied nach Berlin zurück. Gebietsmäßig war er verantwortlich für Süddeutschland.
Zu seinen wichtigen Aufsichtsratsmandaten, die er vor allem von dem 1933 aus dem Vorstand gedrängten Theodor Frank übernahm, gehörten u.a. der Vorsitz bei der Heinrich Lanz AG in Mannheim und der Zellstofffabrik Waldhof, sowie der stellvertretende Vorsitz bei der Deutsch-Asiatischen Bank und der Süddeutschen Zucker AG. Außerdem war er nach 1933 zeitweilig für das Personalressort zuständig, ein Amt, das er aufgrund der vielen internen Auseinandersetzungen mit Parteimitgliedern 1938 gerne an Karl Ritter von Halt abgab.
Bei Kriegsbeginn wurde Sippell zur Wehrmacht eingezogen. Erst nach dem überraschenden Tod Johannes Kiehls gelang es Mitte 1944, Sippells endgültige Entlassung aus der Wehrmacht zu erreichen. Wieder in die Bank zurückgekehrt, oblag ihm in den letzten Kriegsmonaten u.a. die Leitung der Rechtsabteilung.
Sippell starb im Kampf um Berlin einen gewaltsamen Tod. Bei dem Versuch von seinem Privathaus in Grunewald zur Deutschen Bank-Zentrale in der Mauerstraße zu gelangen, wurde er am 2. Mai 1945 von russischen Soldaten erschossen.
Zeige Inhalt von Solmssen, Georg
| Lebensdaten: | 07.08.1869 in Berlin - 10.01.1957 in Lugano |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber / Vorstand 1911-1934 (Sprecher 1933) |
Als Georg Salomonsohn geboren, studierte der Sohn des früheren Geschäftsinhabers der Disconto-Gesellschaft Adolph Salomonsohn Rechtswissenschaften und promovierte mit einer Arbeit über die Bauhandwerkergesetzgebung zum Dr. jur. Als Gerichtsassessor schied er 1900 aus dem Staatsdienst aus und trat in die Disconto-Gesellschaft ein. Solmssen machte rasch Karriere: 1904 war er bereits Direktor und 1911 wurde er in das Gremium der Geschäftsinhaber, das Chefkabinett, aufgenommen. In der Disconto-Gesellschaft widmete sich Solmssen vor allem dem großen Industrie- und Konsortialgeschäft und pflegte insbesondere die Beziehungen zur westdeutschen Montanindustrie.
Solmssen reorganisierte den A. Schaaffhausen'schen Bankverein in Köln und bereitete die stufenweise Eingliederung dieser bedeutenden rheinischen Industriebank in den Konzern der Disconto-Gesellschaft vor. Nach der Verschmelzung 1914 war er eine Reihe von Jahren im Vorstand des Kölner Instituts tätig. Darüber hinaus galt seine Vorliebe neuen Wirtschaftszweigen, deren Aufbau ihn fesselte. So vertrat er die Petroleuminteressen der Bank in Rumänien und widmete sich den Geschäften der Deutschen Erdöl AG in Berlin.
Nach dem Ersten Weltkrieg hielt sich Solmssen wiederholt zu geschäftlichen Zwecken in Amerika auf. Er schloss, zum Wiederanschluss Deutschlands an das internationale Kabelnetz, für die Deutsch-Atlantische Telegraphen-Gesellschaft, deren Aufsichtsratsvorsitz er innehatte, verschiedene Verträge mit ausländischen Telegraphengesellschaften ab.
Der vitale und weltaufgeschlossene Bankier nahm trotz seiner Beanspruchung in der Bank und seiner zahlreichen Aufsichtsratsmandate in führenden Unternehmen der deutschen Wirtschaft auch an den Fragen des öffentlichen Lebens regen Anteil. So wurde Solmssen im Dezember 1930 zum Vorsitzenden des Centralverbandes des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes gewählt und konnte bis 1933 die Interessen der Kreditwirtschaft in der Öffentlichkeit vertreten. Auch publizistisch war er sehr aktiv: Seine Schriften, Vorträge und Reden erschienen im Jahre 1934 als zweibändiges Werk unter dem Titel "Beiträge zur Deutschen Politik und Wirtschaft 1900-1933" und sind wichtige wirtschaftshistorische Augenzeugenberichte der damaligen Zeit.
Zum Thema Politik und Wirtschaft äußerte sich Solmssen u.a. 1931 auf einer Tagung des Centralverbandes des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes in Berlin: "Politik und Wirtschaft sind heterogene Betätigungen, die sich ergänzen müssen, sich aber nicht decken dürfen. Verlassen Politik oder Wirtschaft die ihnen nach ihrem Wesen zugewiesenen Räume und geraten sich gegenseitig ins Gehege, so muß Unheil entstehen. Weder darf die Wirtschaft Politik treiben noch die Politik Wirtschaft."
Georg Solmssen wurde nach der Fusion der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 Vorstandsmitglied des vereinigten Instituts.
Solmssen war bereits um die Jahrhundertwende konvertiert und hatte den jüdischen Namen Salomonsohn "verdeutscht", da er für seine Person nur in der vollständigen Assimilation eine Zukunft sah. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten setzte Solmssens Wirken dennoch ein Ende. In einem denkwürdigen Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Urbig vom April 1933 äußerte sich Solmssen prophetisch über das kommende Schicksal der Wirtschaftselite jüdischer Herkunft: "Ich fürchte, wir stehen noch am Anfange einer Entwicklung, welche zielbewußt, nach wohlaufgelegtem Plane auf wirtschaftliche Vernichtung aller in Deutschland lebenden Angehörigen der jüdischen Rasse gerichtet ist." Zwar fungierte er 1933 auf der Hauptversammlung der Bank als deren Sprecher, doch 1934 musste er den Vorstand der Bank verlassen und gehörte dann noch bis zur Hauptversammlung 1938 ihrem Aufsichtsrat an. Schließlich emigrierte er in die Schweiz.
Zeige Inhalt von Stauß, Emil Georg von
| Lebensdaten: | 06.10.1877 in Friedrichsthal - 12.12.1942 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1915-1932 |
Der Sohn eines Lehrers begann seine Laufbahn 1893 bei der Königlich Württembergischen Hofbank in Stuttgart. 1898 trat Stauß in die Deutsche Bank ein, wo er in der Berliner Zentrale in der Effektenverwaltung, im sogenannten "toten Depot", tätig war. Daneben hatte er eine Prüfung als Stenographielehrer absolviert. So fiel die Wahl auf ihn, als Georg von Siemens einen neuen Sekretär suchte. Damit begann Stauß' Karriere. Nach Siemens' Tod war er unter Arthur von Gwinner im Sekretariat der Bank tätig. Hier bearbeitete er die Gründung der Europäischen Petroleum-Union, in die die Deutsche Bank das Aktienkapital der rumänischen Steaua Romana einbrachte, und übernahm vorübergehend deren Leitung. Auch als er nach dem Ausscheiden Karl Helfferichs 1915 in den Vorstand der Deutschen Bank eingetreten war, blieb das Petroleumgeschäft bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eines seiner wesentlichen Betätigungsfelder. Des weiteren war der versierte Kenner des Balkans und des Orients im Ersten Weltkrieg zuständig für die Verwaltung der von der Deutschen Bank initiierten Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft und widmete sich dem Weiterbau der Bagdadbahn. Im letzten Kriegsjahr noch geadelt, befasste er sich nach 1918 vor allem mit der Flug- und Automobilindustrie. Stauß war nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender von Daimler-Benz, sondern seit 1925 auch von BMW. In dieser Eigenschaft überwachte er nicht nur die Entwicklung der Unternehmensfinanzen, sondern kümmerte sich sogar um Fragen der Produktpalette, Qualitätskontrolle und Vermarktung. Einen weiteren wichtigen Aufsichtsratsvorsitz nahm Stauß für die Vereinigten Glanzstoff-Fabriken wahr. In Erinnerung ist vor allem auch Stauß' Engagement bei der Gründung des bedeutendsten deutschen Filmunternehmens geblieben, der 1917 mit Hilfe von privatem und staatlichem Kapital errichteten Ufa, deren Aufsichtsratsvorsitzender er ebenfalls über viele Jahre war. Der Skandal um die Berliner Schultheißbrauerei, bei der Stauß als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nicht angemessen reagierte, führte 1932 zum Rückzug aus dem Vorstand (eine Reihe von Banken hatten lebhafte Spekulationskäufe bei Schultheiß unternommen, obwohl eigentlich die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Emissionsbank des Unternehmens war). Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehörte er jedoch bis zu seinem Tod an. Obwohl er nach 1932 nicht mehr in das Tagesgeschäft der Bank involviert war, behielt Stauß ein Büro in der Zentrale und kümmerte sich nach wie vor um die Interessen der Bank. Stauß galt als ausgesprochen politischer Bankier. Geprägt durch die umfassenden Erfahrungen, die er während des Kaiserreichs und der Weimarer Republik gewonnen hatte, sah er in seinem Engagement für die Politik vor allem die Aufgabe, Verbindungen zur Regierung aufzubauen, unabhängig davon, welche Gestalt diese Regierung hatte. Er war Mitglied der Deutschen Volkspartei, für die er 1930 in den Reichstag gewählt wurde. Seine politische Betätigung setzte sich auch im Nationalsozialismus fort, ohne dass er jemals der NSDAP beitrat. 1933 wurde er von Hermann Göring, zu dem er eine persönliche Freundschaft pflegte, in den Preußischen Staatsrat berufen. Seit 1934 war er Vizepräsident des Reichstags. "Im ungünstigen Wirtschaftsklima der Zwischenkriegszeit die 'aufgehenden Sterne' - Filmindustrie, Autobranche, Luftfahrt - zum Leuchten zu bringen, war keine leichte Aufgabe, und so kurzsichtig Stauß in seinem politischen Urteil gewesen sein mag, über die Art und Weise, wie er die ihm anvertrauten Unternehmen voranzubringen versuchte, läßt sich viel Gutes sagen. Die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutscher Bank und Automobilindustrie in der Zwischenkriegszeit ist jedenfalls in weitesten Teilen seine Geschichte." (Gerald D. Feldman)
Zeige Inhalt von Steinmüller, Werner
| Lebensdaten: | 1954 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1. August 2016 - 31. Juli 2020 |
Zeige Inhalt von Steinthal, Max
| Lebensdaten: | 24.12.1850 in Berlin - 08.12.1940 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1873-1905, Vorsitzender des Aufsichtsrats 1923-1932 |
Mit Georg von Siemens und Hermann Wallich gehört Max Steinthal zu den wichtigsten Persönlichkeiten aus der Frühzeit der Deutschen Bank. Nach dem Besuch der König-Städtischen Realschule begann der Sohn eines jüdischen Berliner Großkaufmanns 1866 eine Lehrzeit im Bankhaus A. Paderstein. Nach seiner Lehre war er zunächst im Börsengeschäft tätig. Bereits im Jahre 1871 erhielt Steinthal Einzelprokura und ein Jahr später wurde er zum Direktor des aus seiner Lehrfirma hervorgegangenen A. Paderstein'schen Bankvereins.
Zur Deutschen Bank kam Steinthal durch die Reisebekanntschaft mit Hermann Wallich. Dieser empfahl ihn Georg von Siemens. Als Siemens den jungen Mann zu einem Gespräch in die Deutsche Bank einlud, fragte er ihn: "Also Sie wollen Prokurist der Deutschen Bank werden?" "Nein", erklärte Steinthal daraufhin, "nicht Prokurist sondern Direktor". Am 13. Dezember 1873 wurde Max Steinthal neben Georg von Siemens und Hermann Wallich Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank. Durch die Tätigkeit Steinthals war die Deutsche Bank bald in der Lage, sich einen guten Platz im internationalen Devisengeschäft zu erobern. Bis 1876 wurden die Silberkäufe der Reichsregierung ausschließlich durch die Deutsche Bank vermittelt. Steinthal kümmerte sich in jener Zeit aber auch um die Pflege des einheimischen Kontokorrent- und Finanzierungsgeschäfts. Gleichzeitig organisierte er das Börsengeschäft der Deutschen Bank. In der Periode von 1873 - 1880, in der das Aktienkapital der Deutschen Bank unverändert blieb, stieg der Anteil des Effektenumsatzes der Zentrale an dem Gesamtumsatz der Bank von 9,7 % auf 16,4%. Die große Rolle, die in Berlin das Arbitragegeschäft spielte, ist ebenfalls der Pionierarbeit Steinthals zu verdanken.
Nach etwa zwei Jahrzehnten ihres Bestehens begann die Deutsche Bank auf breiterer Grundlage als bisher ihre Emissionstätigkeit auch auf die Finanzierung industrieller Unternehmungen auszudehnen. Steinthal kennzeichnete bei dem Jubiläum seiner 25jährigen Tätigkeit in der Deutschen Bank im Dezember 1898 diese Wandlung mit den Worten: "Bisher haben wir Bankdirektoren Geschäfte gemacht, die wir verstanden; jetzt befassen wir uns mit Dingen, in die wir uns erst einarbeiten müssen". Diese Quintessenz resultierte aus der Erfahrung, die Steinthal als Leiter einiger Syndikatsbeteiligungen an industriellen Unternehmungen gesammelt hatte. Es waren dies Geschäfte, deren erste Anfänge in die 1880er Jahre fielen, aber hauptsächlich in der Zeit nach 1890 an Steinthals Arbeitskraft und Ausdauer große Anforderungen stellten. Eines der bedeutendsten Werke Steinthals war die Umwandlung der im Besitz der Familie Mannesmann befindlichen Werke in Remscheid, Bous und Komotau in die Aktiengesellschaft Deutsch-Österreichische Mannesmann-Röhrenwerke AG und die nachfolgende Reorganisation des Unternehmens. Die Deutsche Bank war im Juni 1890 auf Anregung von Werner von Siemens an die Spitze dieses Umwandlungskonsortiums getreten. Nach dem Tode Werner von Siemens', der der erste Mannesmann-Aufsichtsratsvorsitzende war, trat im Jahre 1896 Steinthal an dessen Stelle. Weitere Engagements Steinthals galten der Görz-Gesellschaft im südafrikanischen Goldbergbau mit zahlreichen Beteiligungen, der Deutsch-Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft sowie den Bayerischen Stickstoffwerken, die zur Nutzbarmachung des Verfahrens der Stickstoffgewinnung aus der Luft gegründet wurden. Steinthal war auch entscheidend an der Finanzierung und dem Ausbau der 1897 gegründeten Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin beteiligt, in deren Aufsichtsrat er zunächst als stellvertretender Vorsitzender und von 1908 ab als Vorsitzender fungierte. Die neue Gesellschaft konnte auf den Plänen von Werner von Siemens aufbauen, der schon im Jahre 1880 den Bau einer Hochbahn in Berlin geplant hatte. In organisatorischer Angliederung an die Hochbahngesellschaft wurden auf Betreiben und unter Führung der Deutschen Bank die Gesellschaft Neu-Westend-Aktiengesellschaft für Grundstücksverwertung und die Bodengesellschaft am Hochbahnhof Schönhauser Allee AG errichtet. Im Jahre 1900 brach die Preußische Hypotheken-Actienbank, die noch ein Jahr zuvor unter allen Berliner Hypothekeninstituten den größten Pfandbriefabsatz hatte, wegen einer langjährigen Misswirtschaft zusammen. Am 12. Dezember 1900 bildete sich auf Betreiben der Deutschen Bank die "Vereinigung zum Schutze der Inhaber von Pfandbriefen der Preußischen Hypotheken-Actienbank", um zunächst die einzelnen Pfandbriefbesitzer zur Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen zusammenzuführen. Bereits im Mai 1901 konnte Steinthal der Versammlung der Schutzvereinigung das Fazit der Untersuchungen darlegen und einen Reorganisationsplan vorschlagen. Steinthals große wirtschaftliche Leistung bestand darin, daß er das Vertrauen in den deutschen Pfandbrief- und Hypothekenmarkt erhielt und gleichzeitig verhinderte, dass damals mehr als 350 Millionen Mark der deutschen Volkswirtschaft verloren gingen.
Als Steinthal Ende 1905 aus dem Vorstand der Deutschen Bank ausschied und in den Aufsichtsrat überwechselte, dessen Vorsitz er in den Jahren 1923-1932 übernahm, hatte er über drei Jahrzehnte die Entwicklung der Deutschen Bank zum führenden Kreditinstitut Deutschlands entscheidend mitgestaltet und auch die gesamte deutsche Wirtschaft mit wichtigen Impulsen bereichert. Diese überragenden Verdienste, die er für das deutsche Bankwesen in sechzig Jahren erworben hatte, galten im Nationalsozialismus nichts mehr. Im Mai 1935 schied er aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank aus, um der Bank, wie er es formulierte, keine Schwierigkeiten zu machen. Zur Emigration konnte sich Steinthal, der zeitlebens seine Heimatstadt Berlin niemals länger als für ein paar Wochen verlassen hatte, trotz rapide sich verschlechternder Lebensverhältnisse nicht entschließen. Steinthal starb zwei Wochen vor seinem 90. Geburtstag in einem Berliner Hotelzimmer, nachdem er im Jahr zuvor sein Anwesen in Charlottenburg zwangsweise hatte verkaufen müssen. 2004 fand im Jüdischen Museum Berlin eine Ausstallung statt, die dem Bankier und Kunstsammler Max Steinthal gewidmet war.
Zeige Inhalt von Strauß, Frank
| Lebensdaten: | 03.02.1970 in Heide - 23.05.2024 |  |
| Bank: | Postbank, Deutsche Bank | |
| Funktionen: | Vorstandsvorsitzender Postbank 2012-2018 Vorstandsmitglied Deutsche Bank 2017-2019 |
Frank Strauß begann seine berufliche Laufbahn 1989 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann in Iserlohn. 1995 kam er nach Frankfurt, wo er in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Bank und der damaligen Tochter Deutsche Bank 24 arbeitete. Ab 2002 koordinierte er für die Privat- und Geschäftskundensparte das Geschäft in Europa, ab 2005 in Indien und China. Ein Jahr später übernahm er die Leitung der Privat- und Geschäftskundensparte auf dem deutschen Heimatmarkt. 2011 wechselte er als Vertriebsvorstand zur Postbank, deren Vorstandsvorsitz er ein Jahr später übernahm. Von 2017 bis 2019 gehörte er dem Konzernvorstand der Deutschen Bank mit Verantwortung für die Privat- und Firmenkundenbank an.
Parallel zu seiner beruflichen Laufbahn verfolgte Strauß bis Ende der 1990er-Jahre eine Sportlerkarriere als Eishockey-Profi.
Zeige Inhalt von Sulzbach, Rudolf
| Lebensdaten: | 09.04.1827 Frankfurt am Main - 23.01.1904 Frankfurt am Main |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1904 |
Der Bankier Rudolf (bis 1864 Ruben) Sulzbach erwarb als Vertreter seines Bankhauses Gebr. Sulzbach, welche die Interessen mehrere Frankfurter Aktionäre vertrat, Aktien im Wert von 799 000 Talern, dem größten Einzelbetrag aller Beteiligungen. Er war seit der ersten Generalversammlung bis zu seinem Tod Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Bank.
Rudolf Sulzbach gründete mit seinem älteren Bruder Siegmund 1856 in Frankfurt am Main das Bankhaus S. Sulzbach, welches 1866 in Gebr. Sulzbach umbenannt wurde. Die Geschwister waren über mütterlicherseits mit der Familie der Rothschilds verwandt und stiegen selbst zu einem der erfolgreichsten jüdischen Bankhäuser ihrer Zeit auf. Sulzbach konzentrierte sich beim Börsengeschäft auf den Handel mit Eisenbahnaktien und Staatsanleihen; so vermittelte er nach dem amerikanischen Bürgerkrieg United States Bonds über eine ab 1865 zeitweilig in New York eingegangene Beteiligung. Großes Augenmerk richtete Sulzbach auf die Förderung neuer Technologien. So bildete er gemeinsam mit dem Berliner Bankier Jacob Landau und der Nationalbank für Deutschland ein Konsortium, das die Edison’schen Lizenzrechte für die Glühlampe erwarb, und finanzierte eine Studiengesellschaft, die die Verbreitung dieser Erfindung in Deutschland vorbereiten sollte.
Nach der Gründung der Deutschen Bank etablierte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Gebr. Sulzbach. So wurde die erste Beteiligung der Deutschen Bank in London an der dafür gegründeten German Bank of London im Jahre 1871 erst durch Gebr. Sulzbach möglich. Auch bei der Gründung der Deutschen Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität (später AEG) 1883 erfolgte eine enge Kooperation beider Banken.
Ab 1872 gehörte Sulzbach der Frankfurter Handelskammer an, deren Ehrenmitglied er vor seinem Tod wurde. 1892/93 fungierte er als Sachverständiger der Börsenenquetekommission im Reichstag.
Zeige Inhalt von Thierbach, Hans-Otto
| Lebensdaten: | 30.04.1923 in Leipzig - 15.05.2012 in Kronberg |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1971-1980 |
Der Sohn eines Deutsche Bank-Direktors begann 1946 eine Banklehre bei der Deutschen Bank in Fürth, die er 1948 in Hamburg beendete. In den folgenden Jahren war er bei der Zentrale der Rheinisch-Westfälischen Bank in Düsseldorf, einem der Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank beschäftigt, unterbrochen durch einen Auslandsaufenthalt in Großbritannien (1949) und einem Volontariat bei New Yorker Banken (1951). Daraufhin durchlief er eine Laufbahn im Filialbereich der Deutschen Bank: 1953 Prokurist in der Filiale Essen, 1955 Filialleiter in Gelsenkirchen, 1956 stellvertretender Direktor in Oberhausen, 1957 in Essen. Ab 1960 widmete sich Thierbach in der Deutschen Bank Zentrale Düsseldorf dem Ausbau des Auslandsgeschäfts. 1961 erfolgte die Ernennung zum Direktor, 1967 zum Generalbevollmächtigten. Als 1969 das Auslandsgeschäft der Gesamtbank in Frankfurt zentralisiert wurde, wechselte er in die dortige Zentrale. 1971 wurde er zum stellvertretenden, 1973 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank ernannt, dem er bis 1980 angehörte. Auch im Vorstand bildete das internationale Geschäft seinen Arbeitsschwerpunkt. Daneben oblag Thierbach die Zuständigkeit für das Devisen- und Edelmetallgeschäft sowie die Betreuung des Hauptfilialbezirks Hannover. Zu seinen wichtigen Aufsichtsratsmandaten zählten die Euro-Pacific Finance Corporation in Melbourne, Banque Européenne de Crédit à Moyen Terme in Brüssel und der Compagnie Financière de la Deutsche Bank AG in Luxemburg.
Zeige Inhalt von Tron, Walter
| Lebensdaten: | 29.04.1899 in Pforzheim - 14.12.1962 in München |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands: Süddeutsche Bank 1952-1957 und Deutsche Bank 1957-1962 |
Unter den Vorfahren von Walter Tron befanden sich französische Glaubensflüchtlinge, die Anfang des 18. Jahrhunderts zu den Gründern der Waldensersiedlung Palmbach bei Karlsruhe zählten. Im Anschluss an den Heeresdienst im Ersten Weltkrieg absolvierte Tron ab 1919 eine Ausbildung bei der „Süddeutschen Disconto-Gesellschaft“ in seiner Heimatstadt Pforzheim. Parallel studierte er Staats- und Rechtswissen in Heidelberg, Freiburg und Gießen. Nach dem Studium, das er mit der Promotion abschloss, setzte er 1923 seine Tätigkeit bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft fort, die 1929 in der „Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft“ (1937 Umbenennung in „Deutsche Bank“) aufging. 1932 wurde er zum Oberbeamten ernannt und ein Jahr später erhielt er Prokura. Nach einer kurzen Station in Mannheim wurde Tron 1936 stellvertretender Direktor und im folgenden Jahr Direktor der Filiale Pforzheim. Noch 1937 wurde er in die Direktion der wesentlich größeren Filiale Mannheim berufen. Von dort aus wechselte er als Direktor 1939 zur Filiale Leipzig, einer der wichtigsten Niederlassungen der Deutschen Bank.
Als die Deutsche Bank im Frühjahr 1942 eine Mehrheitsbeteiligung bei der „Creditanstalt-Bankverein“ in Wien erreichte, wurde Tron dort auf Vorschlag von Deutsche Bank-Vorstand Hermann Josef Abs in die Geschäftsleitung des Creditanstalt-Bankvereins aufgenommen und verblieb dort bis Kriegsende als Vorstandsmitglied. Diese Entsendung war als heikle Mission anzusehen und erforderte ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick. Als einziger Vertreter aus dem „Altreich“ und des Hauptaktionärs Deutsche Bank wurde Trons Handeln von seinen Wiener Kollegen sehr skeptisch beobachtet.
In den Jahren nach 1945 musste sich Tron neu orientieren, da seine Mitgliedschaft in der NSDAP (ab 1937) eine unmittelbare Wiederbeschäftigung in der Deutschen Bank zunächst verhinderte. Ende 1948 wurde er, wiederum auf Initiative von Hermann Josef Abs, als Vorstandsmitglied in die neugegründete „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ berufen. Am Aufbau dieses mit Geldern des Marshall-Plans ausgestatteten Finanzierungsinstruments der westdeutschen Wirtschaft hatte er bedeutenden Anteil. Im April 1951 kehrte Tron zur Gruppe Deutsche Bank zurück, indem er in die Leitung der „Bayerischen Creditbank“ eintrat, dem Nachfolgeinstitut der Deutschen Bank in Bayern (ab September 1952 „Süddeutsche Bank“). Nach der Neuerrichtung der Deutsche Bank AG im Mai 1957 gehörte er deren Vorstand bis zu seinem Tod an. Dort oblagen ihm die Ressorts Personal, Organisation und Revision, seine regionale Zuständigkeit in der Deutschen Bank erstreckte sich auf die Filialbezirke München und Mannheim.
Obgleich Tron in der Öffentlichkeit wenig hervortrat, war sein Einfluss auf die süddeutsche Wirtschaft und vor allem auf die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Bayerns in den 1950er und frühen 1960er Jahren erheblich. Dieser ergab sich nicht zuletzt aus seinem vielfältigen Betätigungsfeld als Vorsitzender in den Aufsichtsräten von Unternehmen der Textilindustrie, der Bayerischen Elektrizitätswerke, der Glas- und Porzellanindustrie sowie der Verkehrsmittel- und der Maschinenindustrie.
Zeige Inhalt von Ulrich, Franz Heinrich
| Lebensdaten: | 06.07.1910 in Hannover - 16.03.1987 in Meerbusch | 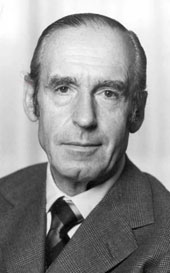 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1957-1976 (Sprecher 1967-1976) und Vorsitzender des Aufsichtsrats 1976-1984 |
Der Sohn des Hauptgeschäftsführers der Bremer Handelskammer trat nach einem Jurastudium 1936 in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank ein. Mit ausgeprägten wirtschaftlichen Interessen absolvierte Franz Heinrich Ulrich eine umfassende Bankausbildung. Zur Wehrmacht eingezogen, kehrte er nach einer schweren Kriegsverwundung Anfang 1941 als Abteilungsdirektor in die Deutsche Bank zurück, wo er bis zum Kriegsende persönlicher Mitarbeiter von Hermann J. Abs war. Seine Hauptaufgabe bestand in der juristischen Betreuung von Abs' schon damals zahlreichen Aufsichtsratsmandaten. Nach dem Krieg wurde Ulrich von den Engländern bis 1947 interniert (er hatte von 1933 bis 1939 der SS angehört und war seit 1937 Mitglied der NSDAP). 1948 kehrte er als Filialdirektor in Wuppertal in die Bank zurück. Seit 1952 war er Vorstandsmitglied der Norddeutschen Bank in Hamburg. Ab 1957 gehörte er dem Vorstand der wiedererrichteten Deutschen Bank an. Nach dem Wechsel von Hermann J. Abs in den Aufsichtsrat, übernahm er von 1967 bis 1969 gemeinsam mit Karl Klasen das Sprecheramt. Nach der Ernennung von Klasen zum Bundesbankpräsidenten, war Ulrich bis 1976 alleiniger Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Seine Maxime zur Außenwirkung der Bank hieß: "Wir drängen uns nicht in die Öffentlichkeit, aber wir stellen uns ihr." Ulrich galt als ausgesprochener Praktiker, als "Macher". In seiner Sprecherzeit trug Ulrich maßgeblich zur Internationalisierung des Geschäfts der Deutschen Bank bei; diese wurde auch durch Leitungsfunktionen in länderübergreifenden Gremien sichtbar, die Ulrich übernahm. So amtierte er drei Jahre als Präsident der Internationalen Handelskammer und wurde als erster Deutscher zum Präsidenten der International Monetary Conference für 1973/74 gewählt. Am Ende seiner Sprecherzeit wurde in London 1976 die erste Deutsche Bank-Auslandsfiliale der Nachkriegszeit eröffnet. Als Mitinitiator bei der Gründung der DWS galt sein besonderes Engagement der Förderung des Wertpapiersparens. Wichtige Mandate waren der Vorsitz im Aufsichtsrat von Klöckner-Humboldt-Deutz, Mannesmann und der Deutschen Texaco. Als Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler-Benz wusste er 1974/75 den Verkauf der Daimler-Beteiligung von Flick an den Iran zu verhindern. Ebenfalls in seine Amtszeit fiel die grundlegende Modernisierung des Erscheinungsbilds der Deutschen Bank, wozu vor allem die Einführung des neuen Logos von Anton Stankowski 1974 gehörte. Zur gleichen Zeit leitete er die erste bedeutende Strukturreform der Bank in die Wege. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand gehörte er noch bis 1984 dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank an. Ulrich war bekannt dafür, kontroverse Themen und Tabus im Kreditgewerbe aufzugreifen (u.a. Abbau von industriellem Anteilsbesitz der Banken, Patronatserklärungen für Tochterunternehmen) und konstruktive Lösungen zu finden. Seine letzten Lebensjahre waren von körperlichen Leiden als Spätfolge seiner Kriegsverletzung überschattet, die er schließlich mit dem Freitod beendete. Das 1973 eröffnete Ausbildungszentrum der Deutschen Bank in Kronberg erhielt nach seinem Tod den Namen Franz-Heinrich-Ulrich-Haus, den es bis zur Schließung Ende 2006 trug.
Zeige Inhalt von Urbig, Franz
| Lebensdaten: | 23.01.1864 in Luckenwalde - 28.09.1944 in Babelsberg bei Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber / Vorstand: 1902-1929 und Vorsitzender des Aufsichtsrats 1930-1942 |
Sechzig Jahre war Franz Urbig, der aus einfachen Verhältnissen im märkischen Luckenwalde stammte, mit der Disconto-Gesellschaft und der Deutschen Bank verbunden. Nach dem frühen Tod des Vaters begann Urbig 1878 seine berufliche Laufbahn als Schreiber beim Amtsgericht Luckenwalde. Aufgrund mangelnder Aufstiegschancen bemühte er sich um den Einstieg in ein Unternehmen der privaten Wirtschaft, was ihm 1884 mit der Einstellung in die Disconto-Gesellschaft in Berlin gelang, obgleich er sich hier in den ersten Jahren mit einfachen Tätigkeiten im Wechselbüro und der Effektenabteilung begnügen musste. Die neben der Arbeit privat betriebenen Sprachstudien ermöglichten es ihm, 1889 die Registratur des Chefkabinetts zu übernehmen. In dieser Eigenschaft war Urbig auch am Aufbau des Archivs der Disconto-Gesellschaft beteiligt. Die Gründung der Deutsch-Asiatischen Bank (DAB), unter der Federführung der Disconto-Gesellschaft, eröffnete Urbig interessante Aufstiegschancen. Ende 1894 erhielt er Prokura für die DAB, reiste nach Ostasien und übernahm 1895 die Leitung der Filiale Tientsin. Hier schloss er gemeinsam mit der Hongkong and Shanghai-Banking-Corporation die erste chinesische Anleihe ab, an der Deutschland beteiligt war. 1896 wurde er Vorstandsmitglied der DAB. 1897 kehrte Urbig nach Berlin zurück, wurde jedoch schon 1898 von Adolph von Hansemann wiederum nach China geschickt, um über die Gründung einer Deutsch-Chinesischen Eisenbahngesellschaft zu verhandeln. Während dieses Aufenthalts wurde mit Hilfe Urbigs in Hongkong eine weitere Filiale der DAB errichtet. 1900 wurde Urbig stellvertretender Direktor der neu errichteten Londoner Filiale der Disconto-Gesellschaft. Seine Verdienste um den Aufbau des Auslandsgeschäfts der Disconto-Gesellschaft führten 1902 zur Berufung als Geschäftsinhaber. Ein Angebot der Deutschen Bank in deren Vorstand einzutreten, hatte Urbig zuvor abgelehnt. Als Geschäftsinhaber übernahm er die Mitleitung des Direktionsbüros, dem die Abteilungen des laufenden Geschäfts unterstanden. Bis zum Ersten Weltkrieg versuchte Urbig vor allem auch seine im Ausland gemachten Erfahrungen in das Außenhandelsgeschäft der Disconto-Gesellschaft einzubringen. Neben der DAB saß er im Aufsichtsrat der Banca Commerciale Italiana, der Compagnie Internationale d'Orient, der Kongo-Eisenbahn und der Otavi Minen und Eisenbahn-Gesellschaft. Wesentlich arbeitete Urbig am Aufbau der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft mit. Der Erste Weltkrieg, der das Ende der kolonialen Bestrebungen Deutschlands und vieler Auslandsinteressen zur Folge hatte, bedeutete für Urbig die Aufgabe eines Großteils seines bisherigen Aufgabengebiets. In den zwanziger Jahren gelang es Urbig jedoch, einen Teil der alten Auslandsbeziehungen wieder in Gang zu bringen. 1919 wurde Urbig als Finanzsachverständiger bei den Vorbereitungen des Versailler Vertrags eingeschaltet. In zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen versuchte er, allerdings eher vergeblich, die Siegermächte von den fatalen wirtschaftlichen Folgen der Reparationsforderungen zu überzeugen. 1923 war er Vorsitzender des Währungsausschusses im Centralverband des deutschen Bank- und Bankiergewerbes. Als Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Rentenbank hatte er wesentlichen Anteil an der Einführung der Reichsmark, die das Ende der Inflation brachte. 1924 wurde er in den neugebildeten Generalrat der Reichsbank berufen. Zu dieser Zeit wirkte er auch an der Gründung der Deutschen Golddiskontbank mit. Seit 1927 führte Urbig mit Oscar Wassermann Gespräche über eine möglich Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank. Nach der Verschmelzung schied Urbig 1929 als Geschäftsinhaber aus und war von 1930 bis 1942 Vorsitzender des Aufsichtsrats des vereinigten Instituts, zeitweise alternierend mit Max Steinthal und Oscar Schlitter. Von 1942 bis zu seinem Tod war er Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Mit seiner Person blieb am längsten das "Erbteil" der Disconto-Gesellschaft im vereinigten Institut wirksam. Sein Biograph Maximilian Müller-Jabusch charakterisierte ihn als "Logiker des Geschäfts, einen Mann des unerbittlich exakt arbeitenden Gehirns - mit Mut zur Verantwortung". Urbig, der durch die Internationalität des Bankgeschäfts vor 1914 geprägt war, stand dem Nationalsozialismus weitgehend verständnislos gegenüber. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft war er bemüht, die Weiterführung des Geschäfts nach sachlichen Grundsätzen zu gewährleisten. Die Verdrängung der jüdischen Vorstandsmitglieder 1933/34 konnte er natürlich nicht aufhalten, im Falle von Oscar Wassermann meinte er sogar fachliche Gründe vorzufinden, die eine Ablösung rechtfertigten.
Zeige Inhalt von Urwin, Jeffrey
| Lebensdaten: | 1956 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2016-2017 |
Zeige Inhalt von Vallenthin, Wilhelm
| Lebensdaten: | 24.07.1909 in Hamburg - 15.12.1992 in Hamburg | 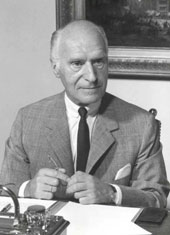 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1959 - 1975 |
Nach dem Abitur in Hamburg studierte Wilhelm Vallenthin in Freiburg i.B. und München Rechts- und Staatswissenschaft und legte seine juristischen Prüfungen in Hamburg ab. Seine berufliche Laufbahn begann er nach kurzer Tätigkeit am Landgericht in Hamburg im Reichsarbeitsministerium, zuletzt als Oberregierungsrat. Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ wechselte er 1946 aus seiner Laufbahn als Ministerialbeamter zum Führungsstab der Deutschen Bank in Hamburg über, wo er für das Konsortialgeschäft im sogenannten Sekretariat tätig war. Bei der Auflösung der Führungsstabs ging er 1948 zunächst nach Wuppertal und übernahm die Leitung verschiedener Filialen des Wuppertaler Bezirks. Von 1950 bis 1958 war er im Düsseldorfer Bereich, und zwar überwiegend im Konsortialgeschäft der Zentrale sowie als Mitglied der Filiale Köln, tätig. In seiner Düsseldorfer Zeit wirkte er an der Aufhebung der aus der Nachkriegszeit stammenden gesetzlichen Beschränkungen für die Großbanken mit, der rechtlichen Voraussetzung für den 1957 vollzogenen Wiederzusammenschluss der Deutsche Bank AG. 1958 wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt und von 1959 bis 1975 gehörte er dem Vorstand der Deutschen Bank an. Im Zentralbereich Hamburg betreute er die Filialbezirke Hamburg, Braunschweig und Schleswig-Holstein. In der Gesamtbank war er für Rechtsangelegenheiten zuständig, wobei er besonders an der Novellierung des Aktiengesetzes mitwirkte. Bei der Volkswagen AG, der Salzgitter AG, der Norddeutschen Affinerie, der Rudolf Karstadt AG und der Zeiss Ikon AG stellte er seinen Rat als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung. Außerdem engagierte er sich in der Verbandsarbeit beim Bundesverband der Deutschen Industrie, bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und beim Bundesverband des privaten Bankgewerbes.
Zeige Inhalt von Waller, Hermann
| Lebensdaten: | 04.01.1873 in Dinslaken - 03.03.1922 in Berlin |  |
| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |
| Funktion: | Geschäftsinhaber 1911 - 1922 |
Seine berufliche Laufbahn begann Hermann Waller in Duisburg, wo er bei dem Bankhaus S. Meyer & Co. als Kassierer tätig war. Diese Firma ging im Herbst 1897 auf die Filiale Duisburg der Rheinischen Bank über, die kurz zuvor in Mülheim a. d. Ruhr mit Leo Hanau als Vorsitzendem und August Thyssen als stellvertretendem Vorsitzenden gegründet worden war. Von diesem Institut wurde ein sehr umfangreiches internationales Effektengeschäft betrieben, das in der Krise des Jahres 1901 schwere Rückschläge erlitt. Als im Zusammenhang damit die Duisburger Filiale geschlossen wurde, ging Waller nach Mannheim, wo er in einem Alter, in dem andere noch in der Ausbildung und Entwicklung begriffen sind, in den Vorstand der damals noch als Notenbank tätigen Badischen Bank eintrat. Dank seiner Energie gelang es, aus einem in veralteten Formen arbeitenden Betrieb ein modernes Bankunternehmen zu gestalten. Im Jahre 1905 verließ Waller die Badische Bank, um einem Ruf der Disconto-Gesellschaft nach Berlin zu folgen. Am 1. April 1911 rückte er zum Geschäftsinhaber der Bank auf. Sein besonderes Arbeitsgebiet lag im Börsengeschäft und in der zentralen Gelddisposition. Daneben gehörte die Pflege der Beziehungen zu den der Disconto-Gesellschaft nahestehenden Banken zu seinem Betätigungsgebiet. So vertrat er die Disconto-Gesellschaft u. a. im Aufsichtsrat der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim, der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt und der Bank für Thüringen. Noch vor Vollendung seines 50. Lebensjahres erlag Waller einem Herzleiden. Sein Sohn Herbert Waller war von 1933 bis 1938 Vertreter der Deutschen Bank in New York. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung kehrte er nicht nach Deutschland zurück, sondern blieb in den USA. Sein Bruder Gert Waller, der einige Zeit bei der Deutschen Bank in Berlin tätig gewesen war, verließ Deutschland 1937, und Anfang 1941 gelang die Ausreise der Mutter Rosa Waller geb. Strauß in die USA. Später lebte sie in Zürich und London, wo sie 1959 verstarb.
Zeige Inhalt von Wallich, Hermann
| Lebensdaten: | 28.12.1833 in Bonn - 30.04.1928 in Berlin |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1870 - 1894 |
Hermann Wallich ist neben Georg von Siemens und Max Steinthal die dritte Persönlichkeit, die die Entwicklung der Deutschen Bank von der Gründungsphase bis zur Jahrhundertwende maßgeblich gestaltet hat. Wallich stammte aus einer seit Jahrhunderten im Rheinland ansässigen jüdischen Familie. Seine berufliche Laufbahn begann er 1850 als Lehrling beim Bankhaus Jacob Cassel in Bonn. 1854 ging er nach Paris, wo sein Onkel ein Bankgeschäft unterhielt. 1860 wechselte er in das neu gegründete Pariser Bankhaus Trivulzi, Holländer & Co. Ende 1862 bewarb er sich um einen Direktorenposten beim Pariser Comptoir d'Escompte und leitete ab 1864 dessen Zweigniederlassung in der französischen Kolonie Réunion. 1867 ging er für den Comptoir d'Escompte nach Shanghai, wo es ihm gelang, die heruntergewirtschaftete Filiale erfolgreich zu reorganisieren. 1870 verließ Wallich den Comptoir d'Escompte und kehrte nach Europa zurück. Ludwig Bamberger, einer der prominenten Gründer der Deutschen Bank, empfahl, ihn in die Geschäftsleitung des neu gegründeten Instituts aufzunehmen. Die Deutsche Bank gewann in ihm einen Mitarbeiter, der die Technik des Auslandsgeschäfts souverän beherrschte. Er baute das Übersee- und Remboursgeschäft der Bank auf. Er war verantwortlich für die Einrichtung der Filialen in den Hafenstädten Bremen (1871) und Hamburg (1872) sowie die Eröffnung der Niederlassungen in Shanghai, Yokohama (beide 1872) und London (1873). Das Engagement im überseeischen Geschäft der Deutschen Bank fand seinen ersten Höhepunkt in der Gründung der Deutschen Uebersee Bank (1886), der späteren Deutschen Ueberseeischen Bank. Neben dem Aufbau des Auslandsgeschäfts befasste sich Wallich vor allem mit der Errichtung und Pflege des Depositenverkehrs. Nach seinem Austritt aus dem Vorstand der Deutschen Bank 1894 gehörte er noch bis zu seinem Tod im hohen Alter von 94 Jahren ihrem Aufsichtsrat an. Sein Vorstandskollege Max Steinthal charakterisierte den Bankier Wallich folgendermaßen: "Er kannte lange Jahre den täglichen Stand des Obligos mit jedem Debitor, er brauchte die Bücher nicht ad hoc nachzusehen, er war immer orientiert, teils durch seinen Instinkt, teils durch anscheinend absichtsloses Blättern in den Büchern. Sein unglaubliches Gedächtnis, in dem auch alle Phasen komplizierter Finanzgeschäfte geordnet beieinander lagen, machte ihn so zu einem lebendigen Kompendium für die Deutsche Bank."
Zeige Inhalt von Wassermann, Oscar
| Lebensdaten: | 04.04.1869 in Bamberg - 08.09.1934 in Garmisch |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1912 - 1933 (Sprecher 1923 - 1933) |
Wassermann entstammte einer etablierten und angesehenen jüdischen Bankiersfamilie in Bamberg. Anders als etwa Georg Solmssen hielt Wassermann zeitlebens an seiner jüdischen Herkunft fest und brachte der zionistischen Bewegung großes Interesse entgegen, etwa mit seiner Unterstützung des Palästina-Aufbaufonds „Keren Hajessod“.
Das Bankgeschäft erlernte er zuerst im väterlichen Bankhaus und baute anschließend dessen Filiale in Berlin auf. Die Deutsche Bank berief den inzwischen bekannt gewordenen Fachmann im Wertpapierhandel 1912 in den Vorstand, wo er zusammen mit Paul Mankiewitz das Börsengeschäft betreute. Ein Spezialgebiet fiel ihm außerdem mit der Behandlung des Hypothekenwesens zu. Hier vertrat er die Bank in den Aufsichtsräten verschiedener Hypothekenbanken. Auf dem Gebiet der Industriefinanzierung widmete er sich besonders der Kali- und der Schiffahrtsindustrie, deren verwickelte Probleme er mit großem Geschick zu meistern verstand. Nach dem Ersten Weltkrieg richteten sich Wassermanns Anstrengungen vor allem darauf, die Bank durch die Inflation und die anschließenden Jahre, die durch die angespannte Lage an den Kapitalmärkten geprägt waren, hindurchzuführen. Er spielte darüber hinaus eine maßgebliche Rolle bei der Pflege der internationalen Beziehungen der Bank. Wassermann war Mitglied des Generalrats der Reichsbank und beriet die Regierung vielfach in Fragen des Geld- und Währungswesens. So entwarf er 1922 einen Plan zur Lösung der Reparationsfrage des Reiches, der jedoch nicht berücksichtigt wurde. Auch im Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes vertrat Wassermann als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes die Interessen der Kreditwirtschaft. In einer großen Rede auf dem Bankiertag 1925 präsentierte er die grundlegenden und repräsentativen Ansichten der Berliner Bankenwelt. So erklärte er unter anderem, der Spekulation komme zwar eine wichtige wirtschaftliche Funktion zu, dennoch sei es nicht Aufgabe des Bankiers zu spekulieren, denn "wer spekuliert, denkt notwendigerweise subjektiv, der Bankier sollte aber stets objektiv und kühl bleiben". Von 1923 bis 1933 war Wassermann Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Entscheidenden Einfluss nahm er auf die Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft im Jahre 1929. Die Verschmelzung der beiden größten deutschen Banken erregte damals im In- und Ausland großes Aufsehen. Wassermann hielt die Fusion für unbedingt notwendig, da sie aus dem "Zwang der Rationalisierung" entstanden sei. Die Bankenkrise sollte schließlich zeigen, dass die Fusion gerechtfertigt war und die solide Kapitalbasis und die hohen Reserven dem vereinigten Institut den erforderlichen Rückhalt gaben. Die bald einsetzende Weltwirtschafts- und Bankenkrise zeigte, dass die Fusion gerechtfertigt war und die solide Kapitalbasis und die hohen Reserven dem vereinigten Institut den erforderlichen Rückhalt gaben. Die Rolle Wassermanns während der Bankenkrise 1931 ist bis heute umstritten. Ihm wurde vorgeworfen, er habe der in der Krise zusammengebrochenen DANAT-Bank die Hilfe verweigert, um einen lästigen Konkurrenten auszuschalten. Neuere Forschungen haben diesen Vorwurf größtenteils zurückgewiesen. Die Deutsche Bank steuerte er jedenfalls vergleichsweise unbeschadet durch diese existentielle Krise des Kreditwesens.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war die Verdrängung Wassermanns aus dem Vorstand der Deutschen Bank, zumal in seiner besonders hervorgehobenen Position als Sprecher des Unternehmens, nur eine Frage der Zeit, auch wenn offiziell altersbedingte Gründe für sein Ausscheiden angegeben wurden. Um die Form zu wahren, sollte Wassermann ursprünglich noch bis Ende 1933 im Amt bleiben, schließlich entschloss sich jedoch der Vorstand, seinen Rücktritt schon vor der Hauptversammlung im Juni 1933, deren Leitung Wassermann als Vorstandssprecher oblegen hätte, bekanntzugeben. Wassermann starb bereits im folgenden Jahr.
2005 erschien die biographische Studie „Oscar Wassermann und die Deutsche Bank. Bankier in schwieriger Zeit“ des israelischen Historikers Avraham Barkai.
Zeige Inhalt von Weiss, Ulrich
| Lebensdaten: | 03.06.1936 in Bremen |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1979-1998 |
Zeige Inhalt von Wendelstadt, Victor
| Lebensdaten: | 22.05.1819 in Linden - 15.07.1884 in Bad Godesberg |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1884 |
Bei der Gründung der Deutschen Bank zeichnete der Kaufmann und Bankier Victor Wendelstadt 1870 für den Kölner A. Schaaffhausen'schen Bankverein Aktien im Wert von 141 000 Talern und vertrat außerdem das Bankhaus Deichmann & Co. sowie drei weitere Erstzeichner. Wendelstadt blieb von der ersten Generalversammlung bis zu seinem Tod 1884 im Verwaltungsrat der Deutschen Bank.
Bis in das Jahr 1874 gehörte Victor Wendelstadt zur zweiköpfigen Direktion des A. Schaaffhausen‘schen Bankvereins, dann schied er aus dem Amt, um der Nachfolger von Gustav Mevissen als Leiter des Aufsichtsrats zu werden. Mit Wilhelm Ludwig Deichmann, dem Begründer der Privatbank Deichmann & Co., war er durch die Heirat mit dessen Tochter Amelie familiär verbunden. Eine weitere persönliche Beziehung hatte Wendelstadt zur Bank für Handel und Industrie in Darmstadt. Diese konnte 1853 mit Unterstützung des A. Schaaffhausen’schen Bankvereins im Jahr 1853 gegründet warden und Victors Bruder Theodor, der seine Karriere ebenfalls beim Bankverein begonnen hatte, wurde dort Direktor.
Unter der Leitung von Wendelstadt und Deichmann gewann der A. Schaaffhausen’sche Bankverein eine führende Rolle bei der Finanzierung von Banken und Unternehmen verschiedener Sektoren und hatte eine enge Beziehung zur rheinisch-westfälischen Montanindustrie. 1929 ging der A. Schaaffhausen’sche Bankverein in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft auf.
Zeige Inhalt von Wintermantel, Fritz
| Lebensdaten: | 26.04.1882 in St. Georgen - 25.07.1953 in Bühlerhöhe |  |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1933-1945 |
Wie seine Vorstandskollegen Rummel und Rösler stammte Fritz Wintermantel aus eher einfachen Verhältnissen. Sein Vater betrieb im Schwarzwald eine Posthalterei, die mit dem Aufkommen des Eisenbahnverkehrs ihre Existenzgrundlage verlor. 1896 begann Wintermantel eine Lehre beim Schwarzwälder Bankverein in Villingen, die er später in Triberg fortsetzte. Danach verbrachte er zur Erweiterung seiner Kenntnisse zwei Jahre in Paris und London. Ende 1902 trat er als Handlungsgehilfe in die Deutsche Bank ein, wo er in der Berliner Zentrale zunächst in der überseeischen Abteilung tätig war. Dort befasste er sich hauptsächlich mit den Rembourskrediten und den Geschäften der Waren- und Zuckerabteilung. 1912 erhielt er Prokura, 1917 wurde er Abteilungsdirektor. Die Berufung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied erfolgte 1927, zum ordentlichen Vorstandsmitglied 1933. Wintermantel übernahm die Leitung der Berliner Stadtzentrale, in der das sehr umfangreiche Depositen- und Kreditgeschäft der Bank in der Hauptstadt zusammengefaßt war. Zu den von ihm betreuten Filialen gehörten die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck. Wintermantels wichtige Mandate waren der Vorsitz in den Aufsichtsräten von Orenstein & Koppel und Knorr-Bremse. Bei Kriegsende war Wintermantel das einzige von den in Berlin verbliebenen Vorstandsmitgliedern, das von den Russen nicht verhaftet wurde und noch in der Zentrale weiter arbeiten konnte, wenn auch unter ständiger Kontrolle. Erst im Frühjahr 1946 verließ er Berlin und übernahm die Leitung des "Führungsstabs" Hamburg, der in Erwartung der kommenden Entwicklung schon zu Beginn des Jahres 1945 als Ausweichstelle gebildet worden war, um die Aufgaben der stillgelegten Berliner Zentrale für die westdeutschen Filialen weiterzuführen. Als der Führungsstab Hamburg mit der Großbankenentflechtung in der britischen Zone 1948 aufgelöst wurde, trat Wintermantel in die Geschäftsleitung der neu geschaffenen Rheinisch-Westfälischen Bank in Düsseldorf ein und übernahm nach deren Umwandlung zur Aktiengesellschaft 1952 den Vorsitz im Aufsichtsrat.
Zeige Inhalt von Zapp, Herbert
| Lebensdaten: | 15.03.1928 - 27.06.2004 | 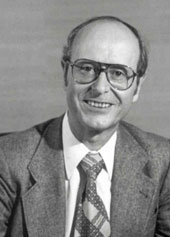 |
| Bank: | Deutsche Bank | |
| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1977-1994 |
Der promovierte Jurist Zapp war zunächst als Rechtsanwalt und anschließend als Beamter im baden-württembergischen Finanzministerium tätig, bevor er 1960 zur Deutschen Bank kam. Nach fünfjähriger Mitleitung der Filiale Ulm übernahm er die Leitung der Hauptfiliale Mannheim. 1972 wechselte er in die Zentrale nach Frankfurt, wo er den Auftrag erhielt, den Konzernbereich Unternehmensplanung aufzubauen. Fünf Jahre später folgte 1977 seine Berufung in den Vorstand, dem er bis 1994 angehörte. Im Vorstand war er zuletzt für das Firmenkundengeschäft sowie für die Rechts- und Steuerabteilung verantwortlich, regional betreute er den Filialbezirk Düsseldorf und im Auslandsgeschäft Lateinamerika. Sein besonderes Interesse galt der Weiterentwicklung des Firmenkundengeschäfts mit mittleren und kleineren Unternehmen. Darüber hinaus war es für Zapp, der sich in vielfältiger Weise sozial und kulturell engagierte, ein besonderes Anliegen, den Mitarbeitern am Arbeitsplatz die Kunst näherzubringen. Er war der Initiator der Kunstsammlung der Deutschen Bank. Für seinen Einsatz in Wirtschaft und Kultur erhielt Zapp zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen wie den Adam-Elsheimer-Preis.
Zeige Inhalt von Zwicker, Hermann
| Lebensdaten: | Unbekannt - 03.07.1885 |
| Bank: | Deutsche Bank |
| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1885 |
Von 1870 bis zu seinem Tod vertrat Hermann Zwicker das Berliner Bankhaus Gebr. Schickler im Verwaltungsrat der Deutschen Bank, das bei deren Errichtung Aktien im Wert von 141 000 Talern übernahm. Zwicker hatte bereits dem Gründungskomitee der Deutschen Bank angehört, das die Statuten des neuen Instituts ausarbeitete und die Verhandlungen mit dem preußischen Staat führte.
Im Gründungsjahr der Deutschen Bank war Zwicker Gesellschafter bei Gebr. Schickler geworden (den Anteil Schicklers am Gründungskapital der Deutschen Bank hatte noch sein Mitgesellschafter Gustav Sonntag gezeichnet). Das Privatbankhaus ging aus dem im Jahre 1712 gegründeten Handelshaus Daum & Comp. hervor. Die Bank besaß eigene Schiffsflotten und handelte mit verschiedenen Waren wie Zucker und Kolonialwaren. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Einnahmen machte der Eisen- und Kriegsmaterialhandel für den preußischen Staat aus. Unter der Führung der Familie Schickler, die das Unternehmen übernommen hatte, wandelte sich 1795 nicht nur der Name, sondern auch die Geschäftsausrichtung. Im Mittelpunkt stand nun das Bankengeschäft. Die Familie Schickler übernahm im Laufe der Zeit nur noch Funktionen im Aufsichtsrat, so dass die Leitung der Bank bei Prokuristen lag. Zu diesen gehörten auch Mitglieder der Familie Zwicker, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts im Unternehmen tätig waren. Im Jahre 1859 übernahm Hermann Zwicker zusammen mit Gustav Sonntag das Amt des Disponenten. 1870 stieg Hermann Zwicker zum Gesellschafter auf, um selbständig im Namen der in Berlin ansässigen Bank die Geschäfte zu leiten.
Zwicker gehörte neben der Deutschen Bank noch weiteren Verwaltungsräten von Unternehmen an, bei denen das Bankhaus Gebr. Schickler Beteiligungen hielt, vor allem im Bereich der Maschinenindustrie und im Berg- und Hüttenbau.